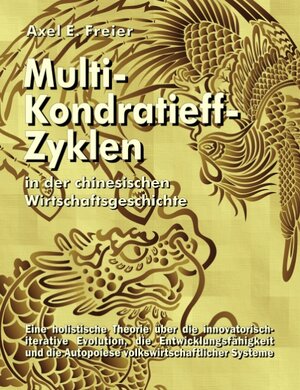
×
![Buchcover ISBN 9783833494215]()
Multi-Kondratieff-Zyklen in der chinesischen Wirtschaftsgeschichte
Eine holistische Theorie über die innovatorisch-iterative Evolution, die Entwicklungsfähigkeit und die Autopoiese volkwirtschaftlicher Systeme
von Axel E. FreierVon Schumpeter über Röpke zu Kondratieff - lange Wellen in China?
Das theoretische Fundament für das Phänomen der „langen Wellen“ in der ökonomischen Entwicklung liefert Josef Schumpeters Interpretation von Konjunkturzyklen, die er 1939 nach Nikolai Kondratieff benannt hat. In der heutigen ökonomischen Theorie werden die Begriffe „lange Wellen“, „Kondratieff-Zyklen“ oder „Business Cycles“, die mit einer Fülle von Erklärungsansätzen von „wirtschaftlicher Entwicklung“ einhergehen, vielfältig verwendet. Das vorliegende Konzept integriert diese Aspekte metatheoretisch zu einem Ganzen und kehrt dabei dem reinen inputlogischen Denken den Rücken. Als Grundannahme über individuelles Agieren wird zu diesem Zweck von einer Innovationstheorie ausgegangen, die das Konzept des Schumpeterschen „Innovators“ um den „evolutorischen Unternehmer“ (nach der Theorie Röpkes) erweitert und mit der soziologischen Theorie der Autopoiese (Luhmann, Maturana und Varela) verknüpft. Durch diese Herangehensweise lassen sich in jedem Wirtschaftssystem Zyklenbewegungen in ihrem Entstehen, Ablaufen und Enden erfassen sowie unterschiedliche Theorieansätze vereinen. Vor etwa drei Jahrzehnten begann in China ein Umdenken, eine „große Umkehr“. Diese chinesische, gegebenenfalls sogar daoistische Kondratieff-Welle scheint China aus seinem tausendjährigen innovationsökonomischen Schlaf zu reißen - und eine neue „Super-Welle“ zu initiieren, die nun an die ökonomischen Grenzen Europas brandet. Es handelt sich um eine gravierende Veränderung, die nicht die erste dieser Art in der Geschichte Chinas ist. Bereits vor eintausend Jahren entstand eine solche Welle von Veränderungen. Eine der innovativsten Entwicklungsetappen der Menschheitsgeschichte fand in der Wirtschaftsgeschichte Chinas zur Zeit der Sung-Dynastie (960-1279 n. Chr.) statt. Warum aber gelang China nicht der Sprung in die industrielle Revolution? Warum vollzog sich diese letztendlich in Europa, rund 800 Jahre später? Auch hierfür existiert eine Vielzahl von Erklärungen. Unter Verwendung des vorliegenden Theoriekonzeptes wird das Bild des damaligen chinesischen Wirtschaftssystems vor dem Hintergrund seines eigenen Geschichtsraumes und fernab von eurozentrischen Erklärungsmustern auf endogene Weise erklärt. Der Schwerpunkt wird dabei auf die ökonomische Entfaltung der Nord-Sung-Zeit gelegt, wobei die Kausalkette bis hin zur ur- und frühgeschichtlichen Entwicklung reicht. Dadurch gelingt eine Darstellung der Prozesse in Form von Multi-Kondratieff-Zyklen, die zahlreiche Parallelen zur heutigen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas aufweisen.
Das theoretische Fundament für das Phänomen der „langen Wellen“ in der ökonomischen Entwicklung liefert Josef Schumpeters Interpretation von Konjunkturzyklen, die er 1939 nach Nikolai Kondratieff benannt hat. In der heutigen ökonomischen Theorie werden die Begriffe „lange Wellen“, „Kondratieff-Zyklen“ oder „Business Cycles“, die mit einer Fülle von Erklärungsansätzen von „wirtschaftlicher Entwicklung“ einhergehen, vielfältig verwendet. Das vorliegende Konzept integriert diese Aspekte metatheoretisch zu einem Ganzen und kehrt dabei dem reinen inputlogischen Denken den Rücken. Als Grundannahme über individuelles Agieren wird zu diesem Zweck von einer Innovationstheorie ausgegangen, die das Konzept des Schumpeterschen „Innovators“ um den „evolutorischen Unternehmer“ (nach der Theorie Röpkes) erweitert und mit der soziologischen Theorie der Autopoiese (Luhmann, Maturana und Varela) verknüpft. Durch diese Herangehensweise lassen sich in jedem Wirtschaftssystem Zyklenbewegungen in ihrem Entstehen, Ablaufen und Enden erfassen sowie unterschiedliche Theorieansätze vereinen. Vor etwa drei Jahrzehnten begann in China ein Umdenken, eine „große Umkehr“. Diese chinesische, gegebenenfalls sogar daoistische Kondratieff-Welle scheint China aus seinem tausendjährigen innovationsökonomischen Schlaf zu reißen - und eine neue „Super-Welle“ zu initiieren, die nun an die ökonomischen Grenzen Europas brandet. Es handelt sich um eine gravierende Veränderung, die nicht die erste dieser Art in der Geschichte Chinas ist. Bereits vor eintausend Jahren entstand eine solche Welle von Veränderungen. Eine der innovativsten Entwicklungsetappen der Menschheitsgeschichte fand in der Wirtschaftsgeschichte Chinas zur Zeit der Sung-Dynastie (960-1279 n. Chr.) statt. Warum aber gelang China nicht der Sprung in die industrielle Revolution? Warum vollzog sich diese letztendlich in Europa, rund 800 Jahre später? Auch hierfür existiert eine Vielzahl von Erklärungen. Unter Verwendung des vorliegenden Theoriekonzeptes wird das Bild des damaligen chinesischen Wirtschaftssystems vor dem Hintergrund seines eigenen Geschichtsraumes und fernab von eurozentrischen Erklärungsmustern auf endogene Weise erklärt. Der Schwerpunkt wird dabei auf die ökonomische Entfaltung der Nord-Sung-Zeit gelegt, wobei die Kausalkette bis hin zur ur- und frühgeschichtlichen Entwicklung reicht. Dadurch gelingt eine Darstellung der Prozesse in Form von Multi-Kondratieff-Zyklen, die zahlreiche Parallelen zur heutigen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas aufweisen.


