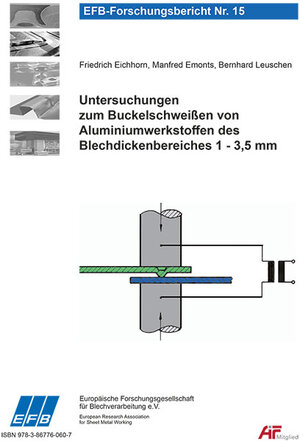
×
![Buchcover ISBN 9783867760607]()
Untersuchungen zum Buckelschweißen von Aluminiumwerkstoffen des Blechdickenbereiches 1 - 3,5 mm
von Friedrich Eichhorn, Manfred Emonts und Bernhard LeuschenIn der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Buckelarten (geprägte, massive und natürliche Buckel) auf ihre Eignung zum Buckel schweißen von unterschiedlichen Aluminiumlegierungen im Blechdickenbereich von 1,25 bis 6,8 mm untersucht. Dabei konnte ermittelt werden, daß der vom Stahlbuckelschweißen her bekannte Ringbuckel bei den geprägten Buckeln den übrigen Formen (Rund - und Langbuckel) überlegen war.
Verformungsversuche an für die Blechdickes = 1,25 mm ausgelegten Buckelformen zeigten, daß die mechanische Steifigkeit der untersuchten Ringbuckel wesentlich größer ist als die von Rund - und Langbuckeln.
Während diese Buckeltypen ab einer Elektroden FEl = 2 kN nahezu vollständig zurückverformt wurden, konnten die zwei untersuchten Ringbuckel bis zu einer Elektrodenkraft von etwa FEl = 6 kN einen definierten Abstand zwischen den beiden Fügeteilen sicherstellen. Aufgrund der hohen Buckelrückverformung vor Einsetzen des Schweißstromes treten bei Schweißungen mit Rund- oder Langbuckeln häufig Fehlschweißungen durch Nebenschluss auf, so daß diese für dünne Bleche auch mit Stromkraft -Programm nur bedingt geeignet sind. Dagegen wurden mit Ringbuckeln, bei denen vor allem das Nachsetzverhalten der Maschine große Bedeutung hat, gute Ergebnisse erzielt.
Zur Durchführung von Schweißungen mit Massivbuckeln an Blechen wurde ein Verfahren zur Herstellung solcher Buckel an Blechteilen entwickelt. Schweißungen an derartigen Teilen zeigen, daß damit Verbindungen höherer Festigkeit möglich sind. Außerdem können damit die Elektrodenstandmengen im Vergleich zu Schweißungen mit geprägten Buckeln deutlich erhöht werden.
Dem Wunsch der Industrie nach Buckelschweißmuttern aus Aluminium wurde durch die Entwicklung einer geeigneten Muttern- und Buckelgeometrie Rechnung getragen. Bei entsprechender Wahl der Schweißparameter sind sogar einige Geometrien von Schweißmuttern aus Stahl auf solche aus Aluminium übertragbar. Dabei sind die Schweißparameter aber innerhalb sehr enger Grenzen zu wählen, so daß dadurch in der industriellen Fertigung bei Verwendung solcher Muttern Probleme auftreten können.
Schweißversuche mit natürlichen Buckeln in Form von sich kreuzenden Drähten erbrachten sowohl im Torsions- als auch im Kopfzugversuch ausreichende Festigkeitswerte. Auch hierbei sind die Schweißparameter nur innerhalb sehr enger Grenzen wählbar.
Bei Buckelschweißungen werden aufgrund des vergleichsweise schnellen Zusammenbruches der Buckel sehr hohe Anforderungen an das Folgevermögen der beweglichen Elektrode gestellt. Daher wurde das mechanisch-dynamische Verhalten der Schweißmaschinen durch Veränderung der bewegten Massen und durch Einbau von federnden Nachsetzeinheiten variiert und in Bezug auf das Schweißergebnis und die erreichbaren Elektrodenstandmengen miteinander verglichen.
Da das Elektrodenstandmengenende überwiegend durch das Auftreten von Nebenschluß bestimmt wurde, sind auch bei Einbuckelschweißungen sehr hohe Anforderungen an die Planparallelität der Elektrodenarbeitsflächen zu stellen.
Durch Schweißversuche mit Wechsel- und Gleichstrom wurde festgestellt, daß bei gleicher effektiver Schweißstromstärke die Scherzugkräfte der mit Gleichstrom erstellten Verbindungen höher liegen. Um gleiche Seherzugkräfte zu erzielen, konnte bei der Anwendung von Gleichstrom wie beim Punktschweißen mit niedrigeren Stromstärken gearbeitet werden. Durch den sogenannten Peltier-Effekt verlagerte sich die Schweißlinse bei den Gleichstromschweißungen leicht zur Anode hin. Standmengenversuche mit Gleich- und Wechselstrom ergaben keinen signifikanten Einfluß der Stromform auf die erreichbare Standmenge, da hierfür andere Faktoren, wie das Nachfolgevermögen, die Planparallelität der Elektroden und die Anordnung der zu verbindenden Bleche eine größere Bedeutung haben.
Verformungsversuche an für die Blechdickes = 1,25 mm ausgelegten Buckelformen zeigten, daß die mechanische Steifigkeit der untersuchten Ringbuckel wesentlich größer ist als die von Rund - und Langbuckeln.
Während diese Buckeltypen ab einer Elektroden FEl = 2 kN nahezu vollständig zurückverformt wurden, konnten die zwei untersuchten Ringbuckel bis zu einer Elektrodenkraft von etwa FEl = 6 kN einen definierten Abstand zwischen den beiden Fügeteilen sicherstellen. Aufgrund der hohen Buckelrückverformung vor Einsetzen des Schweißstromes treten bei Schweißungen mit Rund- oder Langbuckeln häufig Fehlschweißungen durch Nebenschluss auf, so daß diese für dünne Bleche auch mit Stromkraft -Programm nur bedingt geeignet sind. Dagegen wurden mit Ringbuckeln, bei denen vor allem das Nachsetzverhalten der Maschine große Bedeutung hat, gute Ergebnisse erzielt.
Zur Durchführung von Schweißungen mit Massivbuckeln an Blechen wurde ein Verfahren zur Herstellung solcher Buckel an Blechteilen entwickelt. Schweißungen an derartigen Teilen zeigen, daß damit Verbindungen höherer Festigkeit möglich sind. Außerdem können damit die Elektrodenstandmengen im Vergleich zu Schweißungen mit geprägten Buckeln deutlich erhöht werden.
Dem Wunsch der Industrie nach Buckelschweißmuttern aus Aluminium wurde durch die Entwicklung einer geeigneten Muttern- und Buckelgeometrie Rechnung getragen. Bei entsprechender Wahl der Schweißparameter sind sogar einige Geometrien von Schweißmuttern aus Stahl auf solche aus Aluminium übertragbar. Dabei sind die Schweißparameter aber innerhalb sehr enger Grenzen zu wählen, so daß dadurch in der industriellen Fertigung bei Verwendung solcher Muttern Probleme auftreten können.
Schweißversuche mit natürlichen Buckeln in Form von sich kreuzenden Drähten erbrachten sowohl im Torsions- als auch im Kopfzugversuch ausreichende Festigkeitswerte. Auch hierbei sind die Schweißparameter nur innerhalb sehr enger Grenzen wählbar.
Bei Buckelschweißungen werden aufgrund des vergleichsweise schnellen Zusammenbruches der Buckel sehr hohe Anforderungen an das Folgevermögen der beweglichen Elektrode gestellt. Daher wurde das mechanisch-dynamische Verhalten der Schweißmaschinen durch Veränderung der bewegten Massen und durch Einbau von federnden Nachsetzeinheiten variiert und in Bezug auf das Schweißergebnis und die erreichbaren Elektrodenstandmengen miteinander verglichen.
Da das Elektrodenstandmengenende überwiegend durch das Auftreten von Nebenschluß bestimmt wurde, sind auch bei Einbuckelschweißungen sehr hohe Anforderungen an die Planparallelität der Elektrodenarbeitsflächen zu stellen.
Durch Schweißversuche mit Wechsel- und Gleichstrom wurde festgestellt, daß bei gleicher effektiver Schweißstromstärke die Scherzugkräfte der mit Gleichstrom erstellten Verbindungen höher liegen. Um gleiche Seherzugkräfte zu erzielen, konnte bei der Anwendung von Gleichstrom wie beim Punktschweißen mit niedrigeren Stromstärken gearbeitet werden. Durch den sogenannten Peltier-Effekt verlagerte sich die Schweißlinse bei den Gleichstromschweißungen leicht zur Anode hin. Standmengenversuche mit Gleich- und Wechselstrom ergaben keinen signifikanten Einfluß der Stromform auf die erreichbare Standmenge, da hierfür andere Faktoren, wie das Nachfolgevermögen, die Planparallelität der Elektroden und die Anordnung der zu verbindenden Bleche eine größere Bedeutung haben.


