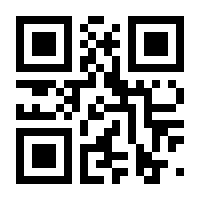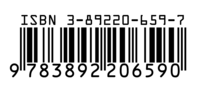×
![Buchcover ISBN 9783892206590]()
Entwicklung eines Entwurfsverfahrens für Schiffsruder auf der Basis statistischer Betriebsprofile
von Lars GreitschModerne Schiffsentwürfe sind beständig steigenden Anforderungen ausgesetzt. Zwangsläufig erhöht sich der Bedarf an zeitsparenden Werkzeugen für die frühe Entwurfsphase. Parallel zu den Anforderungen steigen auch die Ansprüche an die Prognosegenauigkeit des Entwurfsprozesses. Aber gerade eine solche höhere Prognosesicherheit ist nur durch eine gewissenhafte Einbeziehung der späteren Einsatzbedingungen des Schiffes möglich. Der traditionelle Entwurfsansatz mit einer Fokussierung auf einen definierten Entwurfszustand wird den aktuellen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Beispielsweise werden im Bereich des Fährverkehrs mit relativ kurzen Routen in stark frequentierten Verkehrsräumen die tatsächlich auftretenden Fahrprofile durch diesen traditionellen Entwurfsansatz nur unzulänglich erfasst.
Speziell für die Entwurfsaufgabe „Ruder“ bedeutet dies eine immer größer werdende Herausforderung. Auf der einen Seite gibt es die berechtigten, ohnehin schon breiten, und funktionsbedingt sich widersprechenden Anforderungen, die durch die IMO-Empfehlungen gegeben sind (Kursstabilität versus Drehfreudigkeit). Auf der anderen Seite stehen, aufgrund der Forderung nach höheren Geschwindigkeiten und Propulsionswirkungsgraden, die Aufgaben der Minimierung von Kavitationsrisiken und der Entwurf von propellerstrahlangepassten komplexeren Ruderformen. Zu diesem Zweck müssen die Ruderhöhenschnitte gemäß der zu erwartenden Geschwindigkeitsvektoren im Propellerstrahl der Strömung entgegen geneigt werden. Doch gerade die Umströmung des Ruders im Propellerstrahl ist den sich ändernden Betriebszuständen direkt ausgeliefert. Es ist daher davon auszugehen, dass die durch den Entwurfsfall vorgegebenen und dem Ruderentwurf zugrunde liegenden Randbedingungen somit das Kollektiv an realen Umströmungszuständen nicht mehr in Gänze hinreichend repräsentieren. Die so abgeleiteten Anströmwinkel der Ruderhöhenschnitte führen unter Umständen zu einer Ruderform, die während des
Schiffsbetriebs nicht ohne Kavitationsprobleme funktioniert. Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Schiff, eine RoRo-Fähre mit Einsatzgebiet in der Nordsee und nördliche Ostsee zeigt, dass Fahrten in Seegebieten mit häufigen schweren Wetterlagen oder Verkehrsreglementierungen häufig zu Abweichungen von der
angenommenen Entwurfsgeschwindigkeit führen. Abbildung 1.1 zeigt die gemessene Häufigkeitsverteilungder Schiffsgeschwindigkeiten, wobei die dem Schiffsentwurf zu Grunde liegende Entwurfsgeschwindigkeit bei 23 kn lag [Greitsch (2008)]. Mit der Komplexität der Entwurfsvorgabe steigt aber unmittelbar die Anforderung an
die Möglichkeiten der Erfassung von Entwurfsrandbedingungen. Ein Beispiel hierfür sind die an die Strömungszustände im Propellerstrahl angepassten Skelettlinien der Ruderprofile: Liegt die definierte Entwurfsgeschwindigkeit nicht auf gleichem Niveau wie der Erwartungswert der im Betrieb des Schiffes auftretenden Geschwindigkeiten, so verfehlt der zusätzliche Entwurfsaufwand seinen Zweck. Im ungünstigen Fall führt er weiter weg von einer optimalen Entwurfsvariante. Das Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit der Technischen Universität Hamburg-Harburg besitzt innerhalb der Zusammenarbeit mit der Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH Zugriff auf Schiffsdaten, um an Hand eines konkreten Beispiels die Diskrepanz zwischen definiertem Entwurfspunkt und den sich im tatsächlichen Schiffsbetriebeinstellenden Zuständen zu untersuchen. Im Rahmen des durch die Europäische Union geförderten Forschungsvorhabens ADOPT wurden umfangreiche Langzeitmessungen an Bord einer RoRo-Fähre durchgeführt, um den tatsächlichen Betrieb des Schiffes aus- und bewerten zu können. Im Falle des untersuchten Schiffes wichen die tatsächlich auftretenden Betriebszustände deutlich vom definierten Entwurfszustand ab. Die Notwendigkeit einer näheren Untersuchung hinsichtlich Ruderkavitation wurde im Rahmen von Dockungen deutlich. Eine wichtige Voraussetzung zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Abweichen des Betriebsprofils vom Entwurfszustand und den Kavitationserscheinungen ist die Simulation der Betriebsprofile und die direkte Übertragung auf die hydrodynamische Ruderberechnung. Die Integration dieser Werkzeuge in einen geschlossenen Ruderentwurfsprozess schließt sich logisch an. Abbildung 1.2 zeigt das Ruder des untersuchten Schiffes bei Dockung. Erkennbar ist der signifikante Farbabtrag sowohl oberhalb als auch unterhalb der Propellerwelle auf der Backbord-Seite. Bei dem ausgeführten links drehenden Propeller zeugen die Kavitationserscheinungen unterhalb der Propellerwelle von Eintrittskantenneigungen, die nicht zum Erwartungswert der Betriebszustände passen. Bei den Untersuchungen im Kavitationstunnel für den Entwurfszustand hatte sich das Ruder jedoch als kavitationsfrei erwiesen. Gegenstand dieser Dissertation ist daher die Entwicklung eines neuen Ruderentwurfsprozesses. Ausgangspunkt ist die Simulation der Betriebsparameter und die Validierung mit Großausführungsbeobachtungen. Die so berechneten Betriebsprofile dienen als Eingangswerte für den modifizierten Ruderentwurf. Für die Entwicklung des Entwurfsprozesses ist die korrekte Übertragung von Betriebsprofilen auf die Ruderberechnung der erste Schritt. In Folge wird eine Evaluierung gegebener Entwurfsvarianten auf Basis zu erwartender Belastungen möglich. Die daraus ableitbaren gemittelten Belastungszustände in dem avisierten Betrieb des Schiffes dienen als neue Entwurfsrandbedingungen für den betriebsprofilangepassten, fertigungsgerechten Detailentwurf. Detailaspekte des Entwurfes können somit besser an zu erwartende auftretende Betriebszustände
angepasst werden. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit verschiedener Entwurfsänderungen quantifizierbar. Um zu einem geschlossenen Ruderentwurfsprozess zu gelangen, bedarf es schließlich einer Rückführung der Änderungen in die Rudernachrechnung mit damit verbundener erneuter Evaluierung. Die Treffsicherheit des Entwurfsziels steigt so deutlich.
Speziell für die Entwurfsaufgabe „Ruder“ bedeutet dies eine immer größer werdende Herausforderung. Auf der einen Seite gibt es die berechtigten, ohnehin schon breiten, und funktionsbedingt sich widersprechenden Anforderungen, die durch die IMO-Empfehlungen gegeben sind (Kursstabilität versus Drehfreudigkeit). Auf der anderen Seite stehen, aufgrund der Forderung nach höheren Geschwindigkeiten und Propulsionswirkungsgraden, die Aufgaben der Minimierung von Kavitationsrisiken und der Entwurf von propellerstrahlangepassten komplexeren Ruderformen. Zu diesem Zweck müssen die Ruderhöhenschnitte gemäß der zu erwartenden Geschwindigkeitsvektoren im Propellerstrahl der Strömung entgegen geneigt werden. Doch gerade die Umströmung des Ruders im Propellerstrahl ist den sich ändernden Betriebszuständen direkt ausgeliefert. Es ist daher davon auszugehen, dass die durch den Entwurfsfall vorgegebenen und dem Ruderentwurf zugrunde liegenden Randbedingungen somit das Kollektiv an realen Umströmungszuständen nicht mehr in Gänze hinreichend repräsentieren. Die so abgeleiteten Anströmwinkel der Ruderhöhenschnitte führen unter Umständen zu einer Ruderform, die während des
Schiffsbetriebs nicht ohne Kavitationsprobleme funktioniert. Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Schiff, eine RoRo-Fähre mit Einsatzgebiet in der Nordsee und nördliche Ostsee zeigt, dass Fahrten in Seegebieten mit häufigen schweren Wetterlagen oder Verkehrsreglementierungen häufig zu Abweichungen von der
angenommenen Entwurfsgeschwindigkeit führen. Abbildung 1.1 zeigt die gemessene Häufigkeitsverteilungder Schiffsgeschwindigkeiten, wobei die dem Schiffsentwurf zu Grunde liegende Entwurfsgeschwindigkeit bei 23 kn lag [Greitsch (2008)]. Mit der Komplexität der Entwurfsvorgabe steigt aber unmittelbar die Anforderung an
die Möglichkeiten der Erfassung von Entwurfsrandbedingungen. Ein Beispiel hierfür sind die an die Strömungszustände im Propellerstrahl angepassten Skelettlinien der Ruderprofile: Liegt die definierte Entwurfsgeschwindigkeit nicht auf gleichem Niveau wie der Erwartungswert der im Betrieb des Schiffes auftretenden Geschwindigkeiten, so verfehlt der zusätzliche Entwurfsaufwand seinen Zweck. Im ungünstigen Fall führt er weiter weg von einer optimalen Entwurfsvariante. Das Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit der Technischen Universität Hamburg-Harburg besitzt innerhalb der Zusammenarbeit mit der Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH Zugriff auf Schiffsdaten, um an Hand eines konkreten Beispiels die Diskrepanz zwischen definiertem Entwurfspunkt und den sich im tatsächlichen Schiffsbetriebeinstellenden Zuständen zu untersuchen. Im Rahmen des durch die Europäische Union geförderten Forschungsvorhabens ADOPT wurden umfangreiche Langzeitmessungen an Bord einer RoRo-Fähre durchgeführt, um den tatsächlichen Betrieb des Schiffes aus- und bewerten zu können. Im Falle des untersuchten Schiffes wichen die tatsächlich auftretenden Betriebszustände deutlich vom definierten Entwurfszustand ab. Die Notwendigkeit einer näheren Untersuchung hinsichtlich Ruderkavitation wurde im Rahmen von Dockungen deutlich. Eine wichtige Voraussetzung zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Abweichen des Betriebsprofils vom Entwurfszustand und den Kavitationserscheinungen ist die Simulation der Betriebsprofile und die direkte Übertragung auf die hydrodynamische Ruderberechnung. Die Integration dieser Werkzeuge in einen geschlossenen Ruderentwurfsprozess schließt sich logisch an. Abbildung 1.2 zeigt das Ruder des untersuchten Schiffes bei Dockung. Erkennbar ist der signifikante Farbabtrag sowohl oberhalb als auch unterhalb der Propellerwelle auf der Backbord-Seite. Bei dem ausgeführten links drehenden Propeller zeugen die Kavitationserscheinungen unterhalb der Propellerwelle von Eintrittskantenneigungen, die nicht zum Erwartungswert der Betriebszustände passen. Bei den Untersuchungen im Kavitationstunnel für den Entwurfszustand hatte sich das Ruder jedoch als kavitationsfrei erwiesen. Gegenstand dieser Dissertation ist daher die Entwicklung eines neuen Ruderentwurfsprozesses. Ausgangspunkt ist die Simulation der Betriebsparameter und die Validierung mit Großausführungsbeobachtungen. Die so berechneten Betriebsprofile dienen als Eingangswerte für den modifizierten Ruderentwurf. Für die Entwicklung des Entwurfsprozesses ist die korrekte Übertragung von Betriebsprofilen auf die Ruderberechnung der erste Schritt. In Folge wird eine Evaluierung gegebener Entwurfsvarianten auf Basis zu erwartender Belastungen möglich. Die daraus ableitbaren gemittelten Belastungszustände in dem avisierten Betrieb des Schiffes dienen als neue Entwurfsrandbedingungen für den betriebsprofilangepassten, fertigungsgerechten Detailentwurf. Detailaspekte des Entwurfes können somit besser an zu erwartende auftretende Betriebszustände
angepasst werden. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit verschiedener Entwurfsänderungen quantifizierbar. Um zu einem geschlossenen Ruderentwurfsprozess zu gelangen, bedarf es schließlich einer Rückführung der Änderungen in die Rudernachrechnung mit damit verbundener erneuter Evaluierung. Die Treffsicherheit des Entwurfsziels steigt so deutlich.