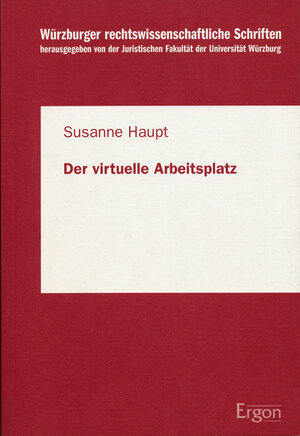Der virtuelle Arbeitsplatz
von Susanne HauptDurch den Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft
werden zunehmend Arbeitsplätze mit Hilfe von Kommunikations- und
Informationstechnologie standortunabhängig eingerichtet. Im Gegensatz zu Telearbeit, die
allgemein als eine computergestützte Tätigkeit ausschließlich zu Hause verstanden wird,
zeichnet sich der virtuelle Arbeitsplatz durch seine Standortunabhängigkeit mittels der
Informationstechnologie aus.
Die Standortunabhängigkeit des virtuellen Arbeitsplatzes bewirkt vielfach ein Leerlaufen der
traditionellen Kriterien zur Abgrenzung der Arbeitnehmer von den Selbständigen.
Insbesondere die örtliche, zeitliche und fachliche Weisungsgebundenheit verliert an
Trennschärfe, da der virtuelle Arbeitsplatz ein orts- und zeitunabhängiges Arbeiten
ermöglicht. Die betriebliche Eingliederung ist auf die Fälle des Zugriffs auf betriebliche
Ressourcen sowie die Einbindung in ein Team beschränkt. Darüber hinaus wird die
statusrechtliche Beurteilung des Inhabers eines virtuellen Arbeitsplatzes maßgeblich durch die
technische, inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses sowie
durch die jeweilige Erscheinungsform des virtuellen Arbeitsplatzes beeinflußt.
Wegen der vielfach nicht eindeutigen Statusbestimmung des Inhabers eines virtuellen
Arbeitsplatzes werden scheinselbständige Tätigkeiten begünstigt. Die mit der Zielsetzung der
Bekämpfung der Scheinselbständigkeit eingeführten Kriterien, die trotz der Änderung des § 7
Abs. 4 SGB IV auch weiterhin Bedeutung haben, sind bei einem virtuellen Arbeitsplatz
regelmäßig nicht aussagekräftig. § 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI führt sogar zu einer Erweiterung des
sozialversicherungspflichtigen Personenkreises.
Vor diesem Hintergrund galt es, alternative Lösungsvorschläge zu entwickeln. Die
Einbeziehung der wirtschaftlichen Abhängigkeit neben der persönlichen Abhängigkeit im
Rahmen eines modernen Arbeitnehmerbegriffs de lege ferenda ist nicht zielführend. Zum
einen würde dies der gesetzlichen Dreiteilung in Arbeitnehmer, arbeitnehmerähnliche
Personen und Selbständige zuwiderlaufen. Zum anderen fehlt eine praxisrelevante
Operationalisierung der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Zur besseren Klassifizierung sollte
statt dessen innerhalb der persönlichen Abhängigkeit zusätzlich das Kriterium der ergebnis-
und verrichtungsbezogenen Kontrollbefugnisse des Arbeit- bzw. Auftraggebers herangezogen
werden.
Da die Inhaber virtueller Arbeitsplätze in vielen Fällen die Voraussetzungen der
arbeitnehmerähnlichen Personen erfüllen, diese jedoch von arbeitsrechtlichen Kernbereichen
ausgenommen sind, sollte arbeitnehmerähnlichen Personen ein Mindestmaß an materiellem
Schutz gewährt werden. De lege ferenda bietet sich eine Regelung entsprechend dem HAG
mit Bestimmungen zum Gefahren- oder Kündigungsfristenschutz an. Alternativ kann die
Fachgerichtsbarkeit durch Rechtsfortbildung aufgrund des grundrechtlichen Untermaßvebots
die Rechtsprechung an neue gesellschaftliche und soziale Strukturen im Einzelfall anpassen.
Die Schwierigkeiten bei der statusrechtlichen Bestimmung des Inhabers eines virtuellen
Arbeitsplatzes können bei einer Erwerbstätigkeit Drittstaatsangehöriger in der BRD zur
Vortäuschung einer selbständigen Tätigkeit führen, da für die Ausübung einer solchen neben
einer Aufenthaltsgenehmigung keine Arbeitsgenehmigung erforderlich ist. Diese Problematik
vermögen insbesondere weder die „Green Card“, die Richtlinienvorschläge der Kommission
der EG zur Regelung der Rechtsposition Drittstaatsangehöriger im Zusammenhang mit der
Ausübung der Dienstleistungsfreiheit noch das geplante Zuwanderungsgesetz zu lösen. Da
das Ausländerrecht eine eindeutige statusrechtliche Klassifizierung voraussetzt, sind die
Abgrenzungsschwierigkeiten vielmehr im Arbeits- und Sozialrecht zu klären.
Im Hinblick auf grenzüberschreitende virtuelle Arbeitsplätze besteht darüber hinaus in
Zweifelsfällen, in denen keine eindeutige statusrechtliche Zuordnung möglich ist, die Frage
nach der anzuwendenden Rechtsordnung.
Zusammenfassend ergibt sich in Bezug auf virtuelle Arbeitsplätze ein vielfältiger
Handlungsbedarf sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.
werden zunehmend Arbeitsplätze mit Hilfe von Kommunikations- und
Informationstechnologie standortunabhängig eingerichtet. Im Gegensatz zu Telearbeit, die
allgemein als eine computergestützte Tätigkeit ausschließlich zu Hause verstanden wird,
zeichnet sich der virtuelle Arbeitsplatz durch seine Standortunabhängigkeit mittels der
Informationstechnologie aus.
Die Standortunabhängigkeit des virtuellen Arbeitsplatzes bewirkt vielfach ein Leerlaufen der
traditionellen Kriterien zur Abgrenzung der Arbeitnehmer von den Selbständigen.
Insbesondere die örtliche, zeitliche und fachliche Weisungsgebundenheit verliert an
Trennschärfe, da der virtuelle Arbeitsplatz ein orts- und zeitunabhängiges Arbeiten
ermöglicht. Die betriebliche Eingliederung ist auf die Fälle des Zugriffs auf betriebliche
Ressourcen sowie die Einbindung in ein Team beschränkt. Darüber hinaus wird die
statusrechtliche Beurteilung des Inhabers eines virtuellen Arbeitsplatzes maßgeblich durch die
technische, inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses sowie
durch die jeweilige Erscheinungsform des virtuellen Arbeitsplatzes beeinflußt.
Wegen der vielfach nicht eindeutigen Statusbestimmung des Inhabers eines virtuellen
Arbeitsplatzes werden scheinselbständige Tätigkeiten begünstigt. Die mit der Zielsetzung der
Bekämpfung der Scheinselbständigkeit eingeführten Kriterien, die trotz der Änderung des § 7
Abs. 4 SGB IV auch weiterhin Bedeutung haben, sind bei einem virtuellen Arbeitsplatz
regelmäßig nicht aussagekräftig. § 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI führt sogar zu einer Erweiterung des
sozialversicherungspflichtigen Personenkreises.
Vor diesem Hintergrund galt es, alternative Lösungsvorschläge zu entwickeln. Die
Einbeziehung der wirtschaftlichen Abhängigkeit neben der persönlichen Abhängigkeit im
Rahmen eines modernen Arbeitnehmerbegriffs de lege ferenda ist nicht zielführend. Zum
einen würde dies der gesetzlichen Dreiteilung in Arbeitnehmer, arbeitnehmerähnliche
Personen und Selbständige zuwiderlaufen. Zum anderen fehlt eine praxisrelevante
Operationalisierung der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Zur besseren Klassifizierung sollte
statt dessen innerhalb der persönlichen Abhängigkeit zusätzlich das Kriterium der ergebnis-
und verrichtungsbezogenen Kontrollbefugnisse des Arbeit- bzw. Auftraggebers herangezogen
werden.
Da die Inhaber virtueller Arbeitsplätze in vielen Fällen die Voraussetzungen der
arbeitnehmerähnlichen Personen erfüllen, diese jedoch von arbeitsrechtlichen Kernbereichen
ausgenommen sind, sollte arbeitnehmerähnlichen Personen ein Mindestmaß an materiellem
Schutz gewährt werden. De lege ferenda bietet sich eine Regelung entsprechend dem HAG
mit Bestimmungen zum Gefahren- oder Kündigungsfristenschutz an. Alternativ kann die
Fachgerichtsbarkeit durch Rechtsfortbildung aufgrund des grundrechtlichen Untermaßvebots
die Rechtsprechung an neue gesellschaftliche und soziale Strukturen im Einzelfall anpassen.
Die Schwierigkeiten bei der statusrechtlichen Bestimmung des Inhabers eines virtuellen
Arbeitsplatzes können bei einer Erwerbstätigkeit Drittstaatsangehöriger in der BRD zur
Vortäuschung einer selbständigen Tätigkeit führen, da für die Ausübung einer solchen neben
einer Aufenthaltsgenehmigung keine Arbeitsgenehmigung erforderlich ist. Diese Problematik
vermögen insbesondere weder die „Green Card“, die Richtlinienvorschläge der Kommission
der EG zur Regelung der Rechtsposition Drittstaatsangehöriger im Zusammenhang mit der
Ausübung der Dienstleistungsfreiheit noch das geplante Zuwanderungsgesetz zu lösen. Da
das Ausländerrecht eine eindeutige statusrechtliche Klassifizierung voraussetzt, sind die
Abgrenzungsschwierigkeiten vielmehr im Arbeits- und Sozialrecht zu klären.
Im Hinblick auf grenzüberschreitende virtuelle Arbeitsplätze besteht darüber hinaus in
Zweifelsfällen, in denen keine eindeutige statusrechtliche Zuordnung möglich ist, die Frage
nach der anzuwendenden Rechtsordnung.
Zusammenfassend ergibt sich in Bezug auf virtuelle Arbeitsplätze ein vielfältiger
Handlungsbedarf sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.