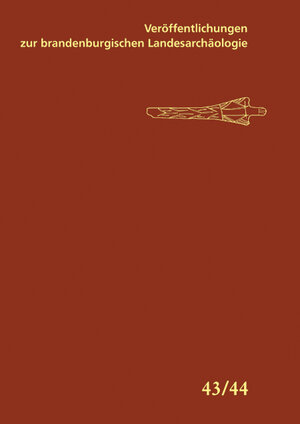
×
![Buchcover ISBN 9783910011687]()
Veröffentlichungen zur brandenburgischen Landesarchäologie. Veröffentlichungen... / Veröffentlichungen zur brandenburgischen Landesarchäologie
von Bernhard Gramsch und weiteren, herausgegeben von Franz SchopperInhalt
S. 7–84 B. Gramsch, Die mesolithischen Knochenspitzen von Friesack, Fundplatz 4, Lkr. Havelland. Teil 2: Die Knochenspitzen des späten Prä-, des Früh- und Spätboreals sowie des älteren Atlantikums
Bei der Ausgrabung der mesolithischen Moorstation Friesack 4 im Rhin-Luch wurden unter einer Vielzahl von Knochen- und Geweihgeräten auch 391 Knochenspitzen bzw. Fragmente ausgegraben. Von diesen werden hier die 299 Knochenspitzen des jüngeren Prä-, des Früh- sowie Spätboreals und des älteren Atlantikums behandelt und im Katalog vorgelegt. Alle drei Komplexe haben einfache Knochenspitzen, Spitzen mit Kerben und Spitzen mit kleinen Widerhaken erbracht, allerdings in unterschiedlichen Mengen. Die Spitzen mit kleinen Widerhaken treten schon im späten Präboreal auf; sie sind damit die ältesten ihrer Art für den gesamten norddeutsch-südskandinavischen Raum. Die für das Spätboreal/Altatlantikum typischen kurzen einfachen Knochenspitzen besitzen in der spätmesolithischen Ertebölle-Kultur an der deutschen Ostseeküste gute Parallelen. Die Knochenspitzen sind als Speer- und Pfeilbewehrungen wohl überwiegend bei der Jagd eingesetzt worden, doch kommt für die längeren Spitzen mit kleinen Widerhaken auch der Gebrauch beim Fischfang infrage.
The excavation of Friesack 4, a Mesolithic camp in Rhin-Luch, uncovered a multitude of bone and antler artefacts which included 391 bone points and fragments thereof. Two hundred and ninety nine of these bone points are dated to the later Pre-Boreal, Early and Late Boreal, together with Early Atlantic and are presented in the catalogue. All three periods yielded simple bone points, points with notches and points with small barbs, nevertheless, in varying amounts. The small-barbed points are already present in the later Pre-Boreal and are, thus, the oldest of their type in the region of northern Germany and southern Scandinavia. The short, simple bone points typical of the Late Boreal/Early Atlantic have good comparisons with those of the Late Mesolithic Ertebölle Culture on Germany’s Baltic coastline. The bone points represent spear and arrowheads most probably employed in hunting; the longer small-barbed points may be indicative of spear-fishing.
S. 85–112 H. Peter-Röcher, Die spätbronze-/früheisenzeitliche Siedlung in Dolgelin, Lkr. Märkisch-Oderland. Ergebnisse der Grabungen in den Jahren 2000–2004
In den Jahren 2000–2004 wurden bei einer Lehrgrabung der Freien Universität Berlin in fünf je rund dreiwöchigen Kampagnen ca. 700 m2 der spätbronze-/früh-eisenzeitlichen Siedlung in Dolgelin, Fundplatz 5, untersucht. Das an einem Hang gelegene, ehemals terrassierte Gelände ist geprägt durch Erosionsvorgänge und Kolluvien. Stratigrafisch ließen sich vier Siedlungsschichten bzw. -phasen differenzieren, von denen die unterste nur im nördlichen Teil auftrat. Sie dürften einen Zeitraum von ein bis zwei Generationen pro Schicht repräsentieren, sodass hier von einer Belegungsdauer von ca. 200 Jahren am Ende der Bronzezeit und dem Beginn der Eisenzeit auszugehen ist. Ackerbau, Viehzucht, vereinzelt Jagd und die Nutzung fluviatiler Ressourcen bildeten die Lebensgrundlage. Darüber hinaus sind Geweih- und Knochenverarbeitung sowie Keramikproduktion belegt. Neben dem für eine Siedlung recht hohen Anteil an Feinkeramik sind eine bronzene Vasenkopfnadel und ein Gürtelhaken aus Geweih hervorzuheben. Wohn- und Speichergebäude wurden in Block- und Pfostenbautechnik errichtet. Ein wahrscheinlich als Opfer zu interpretierendes Tierknochendepot erschließt zudem einen kleinen Bereich der religiösen Sphäre der Siedlung am Rand des Oderbruchs.
In five three-week training-excavation campaigns spanning the years 2000 to 2004 the Freie Universität of Berlin investigated an area of ca. 700 m2 belonging to the Late Bronze Age/Early Iron Age settlement Dolgelin 5. The site is situated on a formerly terraced slope and is characterised by processes of erosion and colluviation. Four settlement phases were stratigraphically identified, the oldest being present only on the north of the site. Each phase may well represent a period spanning one to two generations indicating 200 years of settlement duration at the transition from the Bronze Age to the Iron Age. Agriculture, animal husbandry, sporadic hunting and the exploitation of freshwater resources formed the basic subsistence strategies. Furthermore, antler and bone working, along with pottery production are also represented. Special emphasis is placed on the unusually high percentage of fine wares for a settlement and the presence of a bronze vase-headed pin and antler belt hook. Domestic and storage structures were constructed using sill-beam and post-built techniques. A ritual, probably sacrificial, deposit of animal bone is an example of religious activity in this settlement on the border of the Oder Valley.
S. 113–197 A. Volkmann, Spuren der vorgeschichtlichen Kulturlandschaft am Umsiedlungsstandort Haidemühl bei Sellessen, Lkr. Spree-Neiße
Die intensive archäologische Baubegleitung am neuen Standort der vom Braunkohlentagebau betroffenen Gemeinde Haidemühl in der Nähe von Sellessen erbrachte eine Vielzahl neuer Fundplätze, die zur Verdichtung des Gesamtbildes der vorgeschichtlichen Kulturlandschaft beitragen. Die Untersuchungen öffneten ein Fenster in eine prähistorische Landschaft, die der Mensch mit wechselnder Intensität und zeitlichen Unterbrechungen seit fast 10 000 Jahren immer wieder nutzte und dabei deren Erscheinungsbild prägte. Die 17 neu erfassten Fundplätze verdeutlichen auf eindrucksvolle Weise das relativ hohe Fundstellenpotenzial auch der eher unfruchtbaren, saalekaltzeitlichen Sandböden im Süden Brandenburgs. Bemerkenswert ist die starke Zerstörung der Bodendenkmale durch den intensiven Ackerbau, besonders in den letzten dreißig Jahren. Häufig verblieben nur Spuren in sekundärer Lage, meist in den Kolluvien. Dies unterstreicht den hohen Informationsgehalt auch der oberen Bodenlagen, die leider allzu oft immer noch undokumentiert abgeräumt werden. Von der regen Siedlungstätigkeit zeugen trotz teilweise ungünstiger Erhaltungsbedingungen jungpaläo- bis mesolithische Silexartefakte, bronzezeitliche, eisenzeitliche und germanische Siedlungsspuren, Reste von neolithischen, bronzezeitlichen und germanischen Gräbern sowie von germanischen Eisenverhüttungsplätzen und neuzeitlichen Wölbäckern.
The archaeological watching brief on the prospective relocation site of the village Haide-mühl, near Sellessen (threatened by opencast lignite mining) revealed a number of new -sites that contribute to a fuller understanding of regional prehistoric settlement patterns. The investigations have given us an insight into a prehistoric landscape that man has periodically shaped and, in varying degrees, exploited for nearly 10 000 years. The discovery of seventeen new sites has drawn attention to the settlement potential of the ordinarily barren sandy soils associated with Saalian glacial geology in the south of Brandenburg. There has been significant destruction of sites through plough damage, especially during the last thirty years. Redeposition of finds is common, especially in colluvial deposits. This highlights the high information content of topsoil that is regrettably all too often removed without record. In spite of a somewhat adverse preservation environment, intensive settlement activity is attested to by finds such as Upper Palaeolithic and Mesolithic flint artefacts; vestiges of Bronze Age, Iron Age and Roman Iron Age settlements; Neolithic, Bronze Age and Roman Iron Age burials; Roman Iron Age smelting sites and Post Medieval ridge and furrow field systems.
S. 199–352 G. Wetzel/A. Gillich, Die slawische Burg von Mühlberg, Lkr. Elbe-Elster Zur Ausgrabung im Schlosskeller des östlichen Nordflügels 1982–1985
Unter dem mittelalterlichen Schloss von Mühlberg verbergen sich die Spuren einer slawischen Siedlung und Burg. Die in den Kellern des als Kemenate oder Palas anzusehenden romanischen Kernbaues gesicherten Spuren bleiben in manchen Punkten mit Fragen behaftet. Unter den Befunden sind die vielen Herdstellen, einige Vorratsgruben und ein palisadenartiger Zaun sowie der Wassergraben hervorzuheben. Sichere Wallreste wurden nicht erfasst. Die archäologischen Funde geben Einblick vor allem in die keramische Vielfalt der mittelslawischen Tonware und bilden damit eine gute Ergänzung zu den Funden beispielsweise der mittelslawischen Burgen dieses Raumes an der Elbe und der Burg Meißen. Trotz mancher Einschränkungen konnten viele Hinweise zur Vorbesiedlung und Baugeschichte der Burg gewonnen werden. Schließlich gab die Lage im Elbetal Anlass zu Betrachtungen topografischer Prämissen für die Anlage von Burg und Stadt in slawischer und frühdeutscher Zeit.
Concealed under the Medieval castle of Mühlberg are the remnants of a Slavic fortified settlement. Contexts recorded within the cellar walls of the aisleless Romanesque building remain, in some aspects, open to discussion. Important features include numerous hearths, a number of storage pits, a palisade-like structure and a moat. Clear-cut evidence of ramparts was not found. The archaeological finds provide insight into the diversity of Middle Slavic pottery and compliment finds from, for example, Middle Slavic fortified settlements on the River Elbe and in Meißen. In spite of some restrictions, evidence of earlier settlement and the fortification’s building history were secured. Finally, the location within the Elbe Valley gave occasion to review assumptions related to the topographic location of town and castle in the Slavic and early German periods.
S. 353–358 S. Hanik, Die Tierknochen aus dem Schlosskeller der slawisch-frühdeutschen Burg von Mühlberg, Lkr. Elbe-Elster
Bei archäologischen Ausgrabungen slawischer und frühdeutscher Spuren unter dem mittelalterlichen Schloss von Mühlberg wurden rund 30 kg Tierknochen geborgen. Die aus unterschiedlichen Schichten stammenden Skelettreste verweisen auf umfangreiche Haustierhaltung und -zucht vor Ort. Fundplatzvergleiche bezeugen sehr geringe Jagdtätigkeiten in Mühlberg, was wiederum eine gute Fleischversorgung seiner Bewohner durch Eigenproduktion belegt.
The archaeological excavations of Slavic and early German settlements under the Medieval castle of Mühlberg recovered around 30 kg of animal bone. Originating from diverse layers, the skeletal remains suggest a local tradition of wide-ranging animal husbandry and livestock breeding. Comparative studies of sites suggest relatively limited hunting activity in Mühlberg, which would appear to confirm the inhabitants’ self sufficiency in procuring meat.
S. 359–421 G. H. Jeute, Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Keramik aus der Neustadt Brandenburg an der Havel
Vorgelegt werden vier Keramikkomplexe des 15.–19. Jhs., aus einem Zeitabschnitt also, der archäologisch bislang noch wenig erforscht ist. Die Entwicklung der Keramik wird verglichen mit derjenigen der Ess- und Trinkkultur (Verfeinerung der Tischsitten) und der der Doppelstadt Brandenburg (wirtschaftlicher und sozialer Niedergang). Festzustellen ist ein sprunghafter Anstieg der Formenvielfalt und eine Verfeinerung der Esskultur gegen Ende des Untersuchungszeitraumes, jedoch fehlen qualitativ hochwertige Gefäße, wie sie aus anderen Städten Deutschlands bekannt sind.
Presented here are four ceramic assemblages of the 15th to 19th century, a period associated, so far, with little archaeological research. The development of the ceramic types is compared to that of eating habits (refinement of table manners) and that of the town of Brandenburg (economic and social decline). A notable increase in the types of ceramic form and a refinement of eating habits appear significant toward the end of the period under investigation, nevertheless, prestige vessels—known from other German towns—are absent.
S. 7–84 B. Gramsch, Die mesolithischen Knochenspitzen von Friesack, Fundplatz 4, Lkr. Havelland. Teil 2: Die Knochenspitzen des späten Prä-, des Früh- und Spätboreals sowie des älteren Atlantikums
Bei der Ausgrabung der mesolithischen Moorstation Friesack 4 im Rhin-Luch wurden unter einer Vielzahl von Knochen- und Geweihgeräten auch 391 Knochenspitzen bzw. Fragmente ausgegraben. Von diesen werden hier die 299 Knochenspitzen des jüngeren Prä-, des Früh- sowie Spätboreals und des älteren Atlantikums behandelt und im Katalog vorgelegt. Alle drei Komplexe haben einfache Knochenspitzen, Spitzen mit Kerben und Spitzen mit kleinen Widerhaken erbracht, allerdings in unterschiedlichen Mengen. Die Spitzen mit kleinen Widerhaken treten schon im späten Präboreal auf; sie sind damit die ältesten ihrer Art für den gesamten norddeutsch-südskandinavischen Raum. Die für das Spätboreal/Altatlantikum typischen kurzen einfachen Knochenspitzen besitzen in der spätmesolithischen Ertebölle-Kultur an der deutschen Ostseeküste gute Parallelen. Die Knochenspitzen sind als Speer- und Pfeilbewehrungen wohl überwiegend bei der Jagd eingesetzt worden, doch kommt für die längeren Spitzen mit kleinen Widerhaken auch der Gebrauch beim Fischfang infrage.
The excavation of Friesack 4, a Mesolithic camp in Rhin-Luch, uncovered a multitude of bone and antler artefacts which included 391 bone points and fragments thereof. Two hundred and ninety nine of these bone points are dated to the later Pre-Boreal, Early and Late Boreal, together with Early Atlantic and are presented in the catalogue. All three periods yielded simple bone points, points with notches and points with small barbs, nevertheless, in varying amounts. The small-barbed points are already present in the later Pre-Boreal and are, thus, the oldest of their type in the region of northern Germany and southern Scandinavia. The short, simple bone points typical of the Late Boreal/Early Atlantic have good comparisons with those of the Late Mesolithic Ertebölle Culture on Germany’s Baltic coastline. The bone points represent spear and arrowheads most probably employed in hunting; the longer small-barbed points may be indicative of spear-fishing.
S. 85–112 H. Peter-Röcher, Die spätbronze-/früheisenzeitliche Siedlung in Dolgelin, Lkr. Märkisch-Oderland. Ergebnisse der Grabungen in den Jahren 2000–2004
In den Jahren 2000–2004 wurden bei einer Lehrgrabung der Freien Universität Berlin in fünf je rund dreiwöchigen Kampagnen ca. 700 m2 der spätbronze-/früh-eisenzeitlichen Siedlung in Dolgelin, Fundplatz 5, untersucht. Das an einem Hang gelegene, ehemals terrassierte Gelände ist geprägt durch Erosionsvorgänge und Kolluvien. Stratigrafisch ließen sich vier Siedlungsschichten bzw. -phasen differenzieren, von denen die unterste nur im nördlichen Teil auftrat. Sie dürften einen Zeitraum von ein bis zwei Generationen pro Schicht repräsentieren, sodass hier von einer Belegungsdauer von ca. 200 Jahren am Ende der Bronzezeit und dem Beginn der Eisenzeit auszugehen ist. Ackerbau, Viehzucht, vereinzelt Jagd und die Nutzung fluviatiler Ressourcen bildeten die Lebensgrundlage. Darüber hinaus sind Geweih- und Knochenverarbeitung sowie Keramikproduktion belegt. Neben dem für eine Siedlung recht hohen Anteil an Feinkeramik sind eine bronzene Vasenkopfnadel und ein Gürtelhaken aus Geweih hervorzuheben. Wohn- und Speichergebäude wurden in Block- und Pfostenbautechnik errichtet. Ein wahrscheinlich als Opfer zu interpretierendes Tierknochendepot erschließt zudem einen kleinen Bereich der religiösen Sphäre der Siedlung am Rand des Oderbruchs.
In five three-week training-excavation campaigns spanning the years 2000 to 2004 the Freie Universität of Berlin investigated an area of ca. 700 m2 belonging to the Late Bronze Age/Early Iron Age settlement Dolgelin 5. The site is situated on a formerly terraced slope and is characterised by processes of erosion and colluviation. Four settlement phases were stratigraphically identified, the oldest being present only on the north of the site. Each phase may well represent a period spanning one to two generations indicating 200 years of settlement duration at the transition from the Bronze Age to the Iron Age. Agriculture, animal husbandry, sporadic hunting and the exploitation of freshwater resources formed the basic subsistence strategies. Furthermore, antler and bone working, along with pottery production are also represented. Special emphasis is placed on the unusually high percentage of fine wares for a settlement and the presence of a bronze vase-headed pin and antler belt hook. Domestic and storage structures were constructed using sill-beam and post-built techniques. A ritual, probably sacrificial, deposit of animal bone is an example of religious activity in this settlement on the border of the Oder Valley.
S. 113–197 A. Volkmann, Spuren der vorgeschichtlichen Kulturlandschaft am Umsiedlungsstandort Haidemühl bei Sellessen, Lkr. Spree-Neiße
Die intensive archäologische Baubegleitung am neuen Standort der vom Braunkohlentagebau betroffenen Gemeinde Haidemühl in der Nähe von Sellessen erbrachte eine Vielzahl neuer Fundplätze, die zur Verdichtung des Gesamtbildes der vorgeschichtlichen Kulturlandschaft beitragen. Die Untersuchungen öffneten ein Fenster in eine prähistorische Landschaft, die der Mensch mit wechselnder Intensität und zeitlichen Unterbrechungen seit fast 10 000 Jahren immer wieder nutzte und dabei deren Erscheinungsbild prägte. Die 17 neu erfassten Fundplätze verdeutlichen auf eindrucksvolle Weise das relativ hohe Fundstellenpotenzial auch der eher unfruchtbaren, saalekaltzeitlichen Sandböden im Süden Brandenburgs. Bemerkenswert ist die starke Zerstörung der Bodendenkmale durch den intensiven Ackerbau, besonders in den letzten dreißig Jahren. Häufig verblieben nur Spuren in sekundärer Lage, meist in den Kolluvien. Dies unterstreicht den hohen Informationsgehalt auch der oberen Bodenlagen, die leider allzu oft immer noch undokumentiert abgeräumt werden. Von der regen Siedlungstätigkeit zeugen trotz teilweise ungünstiger Erhaltungsbedingungen jungpaläo- bis mesolithische Silexartefakte, bronzezeitliche, eisenzeitliche und germanische Siedlungsspuren, Reste von neolithischen, bronzezeitlichen und germanischen Gräbern sowie von germanischen Eisenverhüttungsplätzen und neuzeitlichen Wölbäckern.
The archaeological watching brief on the prospective relocation site of the village Haide-mühl, near Sellessen (threatened by opencast lignite mining) revealed a number of new -sites that contribute to a fuller understanding of regional prehistoric settlement patterns. The investigations have given us an insight into a prehistoric landscape that man has periodically shaped and, in varying degrees, exploited for nearly 10 000 years. The discovery of seventeen new sites has drawn attention to the settlement potential of the ordinarily barren sandy soils associated with Saalian glacial geology in the south of Brandenburg. There has been significant destruction of sites through plough damage, especially during the last thirty years. Redeposition of finds is common, especially in colluvial deposits. This highlights the high information content of topsoil that is regrettably all too often removed without record. In spite of a somewhat adverse preservation environment, intensive settlement activity is attested to by finds such as Upper Palaeolithic and Mesolithic flint artefacts; vestiges of Bronze Age, Iron Age and Roman Iron Age settlements; Neolithic, Bronze Age and Roman Iron Age burials; Roman Iron Age smelting sites and Post Medieval ridge and furrow field systems.
S. 199–352 G. Wetzel/A. Gillich, Die slawische Burg von Mühlberg, Lkr. Elbe-Elster Zur Ausgrabung im Schlosskeller des östlichen Nordflügels 1982–1985
Unter dem mittelalterlichen Schloss von Mühlberg verbergen sich die Spuren einer slawischen Siedlung und Burg. Die in den Kellern des als Kemenate oder Palas anzusehenden romanischen Kernbaues gesicherten Spuren bleiben in manchen Punkten mit Fragen behaftet. Unter den Befunden sind die vielen Herdstellen, einige Vorratsgruben und ein palisadenartiger Zaun sowie der Wassergraben hervorzuheben. Sichere Wallreste wurden nicht erfasst. Die archäologischen Funde geben Einblick vor allem in die keramische Vielfalt der mittelslawischen Tonware und bilden damit eine gute Ergänzung zu den Funden beispielsweise der mittelslawischen Burgen dieses Raumes an der Elbe und der Burg Meißen. Trotz mancher Einschränkungen konnten viele Hinweise zur Vorbesiedlung und Baugeschichte der Burg gewonnen werden. Schließlich gab die Lage im Elbetal Anlass zu Betrachtungen topografischer Prämissen für die Anlage von Burg und Stadt in slawischer und frühdeutscher Zeit.
Concealed under the Medieval castle of Mühlberg are the remnants of a Slavic fortified settlement. Contexts recorded within the cellar walls of the aisleless Romanesque building remain, in some aspects, open to discussion. Important features include numerous hearths, a number of storage pits, a palisade-like structure and a moat. Clear-cut evidence of ramparts was not found. The archaeological finds provide insight into the diversity of Middle Slavic pottery and compliment finds from, for example, Middle Slavic fortified settlements on the River Elbe and in Meißen. In spite of some restrictions, evidence of earlier settlement and the fortification’s building history were secured. Finally, the location within the Elbe Valley gave occasion to review assumptions related to the topographic location of town and castle in the Slavic and early German periods.
S. 353–358 S. Hanik, Die Tierknochen aus dem Schlosskeller der slawisch-frühdeutschen Burg von Mühlberg, Lkr. Elbe-Elster
Bei archäologischen Ausgrabungen slawischer und frühdeutscher Spuren unter dem mittelalterlichen Schloss von Mühlberg wurden rund 30 kg Tierknochen geborgen. Die aus unterschiedlichen Schichten stammenden Skelettreste verweisen auf umfangreiche Haustierhaltung und -zucht vor Ort. Fundplatzvergleiche bezeugen sehr geringe Jagdtätigkeiten in Mühlberg, was wiederum eine gute Fleischversorgung seiner Bewohner durch Eigenproduktion belegt.
The archaeological excavations of Slavic and early German settlements under the Medieval castle of Mühlberg recovered around 30 kg of animal bone. Originating from diverse layers, the skeletal remains suggest a local tradition of wide-ranging animal husbandry and livestock breeding. Comparative studies of sites suggest relatively limited hunting activity in Mühlberg, which would appear to confirm the inhabitants’ self sufficiency in procuring meat.
S. 359–421 G. H. Jeute, Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Keramik aus der Neustadt Brandenburg an der Havel
Vorgelegt werden vier Keramikkomplexe des 15.–19. Jhs., aus einem Zeitabschnitt also, der archäologisch bislang noch wenig erforscht ist. Die Entwicklung der Keramik wird verglichen mit derjenigen der Ess- und Trinkkultur (Verfeinerung der Tischsitten) und der der Doppelstadt Brandenburg (wirtschaftlicher und sozialer Niedergang). Festzustellen ist ein sprunghafter Anstieg der Formenvielfalt und eine Verfeinerung der Esskultur gegen Ende des Untersuchungszeitraumes, jedoch fehlen qualitativ hochwertige Gefäße, wie sie aus anderen Städten Deutschlands bekannt sind.
Presented here are four ceramic assemblages of the 15th to 19th century, a period associated, so far, with little archaeological research. The development of the ceramic types is compared to that of eating habits (refinement of table manners) and that of the town of Brandenburg (economic and social decline). A notable increase in the types of ceramic form and a refinement of eating habits appear significant toward the end of the period under investigation, nevertheless, prestige vessels—known from other German towns—are absent.


