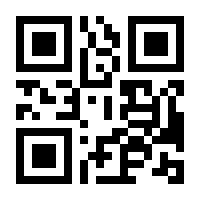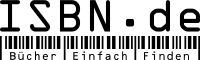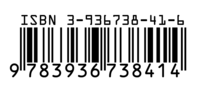×
![Buchcover ISBN 9783936738414]()
Ein junger Mann namens Akbhar kehrt nach Jahren des Exils in sein Heimatland zurück. Ängstlich, aber auch von Hoffnung getrieben, begibt er sich auf die Suche nach den Menschen, die er einst geliebt und in seinem Herzen aufbewahrt hat:
Ein neues Regime ist an der Macht, das Land ist sichtbar vom Krieg zerstört, er erkennt es kaum wieder.
Die Orte der Kindheit und Jugend scheinen unauffindbar zu sein.
So irrt Akbhar von Tür zu Tür, von Stadt zu Stadt.
Was ihn am meisten beunruhigt, ist der Anblick der Frauen, deren Gesichter hinter einem Tschador versteckt sind - so als wäre damit die „Hälfte des Lebens“ ausgelöscht, wie er sagt.
„Ich kann zwar nicht lesen“,
sagt Akbhars Fahrer zu Beginn der Reise,
„aber Menschengesichter sind für mich Geschriebenes.“
LESEPROBE
Obwohl sich in der Ferne die kahlen Berge zum Verzweifeln ähnlich sehen, die niedrigen Hügel denkbar fahl wirken, der Sand zu fast gleich hohen Dünen zusammengeweht ist und die staubige Sonne alles, was er bisher gesehen hat, mit der gleichen Ungerührtheit versengt, fühlt Akhbar doch, dass er seinem Land näher kommt, dass es nicht mehr weit bis zur Grenze ist, doch nicht an vertrauten Wegzeichen erkennt er das, sondern an Untiefen seines Herzens, an die er nicht einmal eine Erinnerung hat.
Die Hitze hat die beiden eingelullt. Schon lange reden sie nicht mehr und lauschen nur noch auf den Weg, auf die Sonnenglut, auf die Wüste, der sie mal näher, mal ferner sind. Was sie einander zu sagen hatten, war schnell verbraucht, bald hatten sie gar kein Bedürfnis mehr zu sprechen. Um sich vor dem scharfen, heißen Wüstenwind zu schützen, halten sie die Autofenster dicht geschlossen, und der Blick durch die sandige Verschleierung verrät Akhbar nichts darüber, woran sie gerade vorbeiziehen, wohin sie gerade fahren. Es ist ein altes, hochbeiniges Auto mit gewaltigen Reifenprofilen und offener Ladefläche; wo Lack abgesprungen war, hatte man in diversesten Farben ausgebessert. Unterwegs mussten sie unzählige Male anhalten. An kühlen Orten schöpften sie Kraft.
Als Akhbar den Schweiß bemerkt, der dem Fahrer von der Stirn bis zum Hals rinnt, fällt ihm selbst wieder ein, die Hand zum Gesicht zu führen. Er weiß, dass man es irgendwann aufgibt, sich den Schweiß abzuwischen. Mit dem dünnen Seidenstoff seines gelben, mit weißen Fäden durchwirkten Turbans wischt er sich Gesicht und Kopf ab, wickelt sich dann den Turban wieder um und zieht ihn fest. Er reibt sich das Gesicht, um sich zu erfrischen. Der Fahrer nimmt diese Vorbereitungen wahr und sagt lächelnd, als wolle er sie gutheißen: „Wir sind bald an der Grenze.“ Trotz der dicken, violetten Lippen und der vielen Zahnlücken ist es ein gutes Lächeln. Es weckt keine dunklen Gefühle in einem. Akhbar lächelt zurück.
Als am Horizont die ersten Anzeichen für die Grenze sichtbar werden, spürt Akhbar, wie vertrocknet seine Lippen sind, und führt die Feldflasche zum Mund. Da fällt ihm ein, dass er höflichkeitshalber zuerst den Fahrer hätte fragen müssen. „Willst du auch etwas?“ Der Fahrer schüttelt den Kopf.
Hatte die Grenze aus der Ferne lediglich als Ansammlung einzelner Gebäude gewirkt, so bemerkt Akhbar nun, dass sie viel befestigter ist, als er gedacht hätte. Er sieht elektrischen Stacheldraht, kleine Erdhaufen, unter denen sich Minen vermuten lassen, Wachtürme, Gräben, Schutzwälle und in breiten Löchern je eine zimmergroße Hütte, deren Zweck sich nicht erschließt.
Zwar hofft er, mit seinem neuen Pass und den sonstigen Papieren, die er zigmal überprüft hat, wird es an der Grenze keine Schwierigkeiten geben, doch wacht in ihm dennoch eine Furcht. Sie wird von dem genährt, was ihm in der Ferne zu Ohren kam, von Zeitungsberichten und Flüchtlingserzählungen, und nicht zuletzt von der Wahrscheinlichkeit, dass sein Pech, dem er schon so oft in die Falle ging, ihm wieder einen Streich spielen würde. Würde es nicht Argwohn erregen, dass er nach so vielen Jahren in die Heimat zurückwollte? Würden die Behörden ihm das nicht negativ auslegen und versuchen, ihn mit absurden Fragen, auf die er keine Antwort wüsste, in die Enge zu treiben? Ihn tröstet allein, dass er das Land lange vor dem Regierungssturz verlassen hat und seiner Rückkehr nichts Politisches anhaftet. Das würden sie vermutlich wissen. So gründlich und leidenschaftlich, wie sie die Grenze bewachten, wussten sie es sogar bestimmt. Akhbar ist jemand geworden, der sich in nichts mehr einmischt, nie.
Der Fahrer sieht ihm seine Befürchtungen an. „Du sorgst dich ganz umsonst. Es passiert nichts, du wirst sehen. Ich fahre mindestens fünf Mal pro Woche hier durch. Es ist alles nicht mehr so streng wie früher. Lügen entstehen, wenn jeder der Wahrheit etwas hinzufügt.“
Akhbar wäre gern sicher, dass diese Worte nicht nur seiner Beruhigung dienen sollen.
An der Grenze werden sie angehalten.
Der Fahrer steigt aus und wird von den Soldaten wie ein alter Bekannter gegrüßt. Akhbar gewinnt ein Stück Sicherheit zurück. Es waren also nicht leere Worte gewesen, als der Fahrer gesagt hatte: „Ich bringe dich sicher über die Grenze.“ Im Schatten des Wachgebäudes unterhalten sich die Soldaten und der Fahrer; es ist ihnen nicht anzusehen, worüber. Von ihren Gesichtern, ihrer ganzen Haltung geht eine nichtssagende Normalität aus, die schon fast einstudiert wirkt. Dann holen sie Akhbar zu sich und treten ins Innere des Gebäudes. Außer dem entnervenden Quietschen des Deckenventilators mit seinen riesigen Flügeln ist nichts zu hören.
Hinter einem Tisch sitzt ein hochrangiger Militär, dem versteinerte Abscheu ins Gesicht geschrieben steht, und sieht lange schweigend und ungläubig Akhbars Papiere durch. Als wolle er sein Gegenüber in eine Falle locken, sieht er manchmal ruckartig auf und richtet bohrende Blicke auf Akhbars Gesicht, wie um darin Antworten zu suchen, die in den Papieren nicht zu finden sind. Offensichtlich wägt er ab, was die Wahl dieses wenig benutzten Grenzübergangs zu bedeuten hat.
Wie unschuldige Menschen es in solchen Fällen oft tun, wendet Akhbar mit schuldigem Blick das Gesicht ab. Aus diesem Blick spricht die Furcht, man werde zu Unrecht als Opfer auserkoren.
Als sie wieder ins Auto steigen, fühlt Akhbar sich unendlich leicht. Die Furcht so vieler Jahre ist plötzlich verflogen. Den fern der Heimat verbrachten Nächten ist ein Morgen geworden. Ein Aufwachen in vertrauten Armen nach einem Alptraum. Er denkt, der restliche Teil der Reise wird nun viel schneller vergehen. Plötzlich merkt er, dass er sogar die Hitze vergessen hat. Die nicht unbeträchtliche Summe, die er dem Fahrer gezahlt hat, war also verdient.
„Warum haben sie deine Papiere nicht verlangt?“ fragt er ihn.
„Wie gesagt, ich komme hier mindestens fünf Mal pro Woche durch. Die kennen mich inzwischen besser, als meine Mutter mich kennt. Was sollen sie mich da nach Papieren fragen? Sie wissen, daß ich nichts Unrechtes tue. Menschenschmuggel ist viel lukrativer, aber das habe ich kein einziges Mal gemacht. Man weiß nie, wann man dabei verliert. Ich mache nichts, was mir Scherereien bringt.“
„Warum hast du mir dann geglaubt? Ich hätte dich doch anlügen können.“
„Ich kann zwar nicht lesen, aber ich kenne Buchstaben, und da ich meine Buchstaben kenne, verstehe ich Geschriebenes. Menschengesichter sind für mich Geschriebenes.“
Über Akhbars Gesicht fährt ein Zucken.
Sie schweigen wieder lange.
Nach einer Weile sehen sie ein massives, wie eine alte Festung von hohen Mauern umgebenes Bauwerk auftauchen, das anscheinend aus mehreren miteinander verbundenen Gebäuden besteht. Es sieht unheimlich aus, furchteinflößend, wie eine Märchenburg, in der gute Menschen von Bösewichten festgehalten werden.
„Was ist das?“ fragte Akhbar erstaunt.
„Sie nennen es Sammelpunkt. Es ist sowohl Gericht als auch Gefängnis und Lager. Ein Ort für verschiedenerlei Zwecke. Hierher werden Illegale, Verbrecher und Schmuggler verbracht. Und dann geschieht, was eben geschieht.“
Soldaten, die auf der Höhe der Anlage Posten stehen, bedeuten ihnen schon von weitem, langsamer zu fahren. Als sie sich im Schritttempo nähern, äugen die Soldaten misstrauisch ins Wageninnere und winken sie schließlich durch.
Das Auto beschleunigt wieder. Wie eine Halluzination taucht kurz danach am Straßenrand ein Mann auf. Er hat trotz der Hitze nur ein leichtes Tuch auf dem Kopf, geht geschäftigen Schrittes dahin und redet dabei mit sich selbst.
Der Fahrer sieht Akhbar in das neugierig-besorgte Gesicht. „Er hat den Verstand verloren“, sagt er dann. „Er geht diesen Weg jeden Tag. Ob Sommer oder Winter geht er Tag für Tag von der Stadt bis zu dem Sammelpunkt vorhin und dann wieder zurück.“
Mit einem Blick erheischt Akhbar vom Fahrer eine Erklärung.
„Soll ich dir seine Geschichte erzählen?“ fragt der Fahrer.
„Natürlich.“
"Bis vor kurzem war der Mann noch glücklich. Er hatte eine schöne junge Frau, eine gute Arbeit und ein geordnetes Leben. Eines Tages fuhr er mit seiner Frau in die Nachbarstadt, um seine Schwiegereltern zu besuchen. Ein paar Tage später, auf dem Rückweg, gerieten sie in eine Straßenkontrolle des Militärs, und es stellte sich heraus, dass sie ihre Heiratsurkunde nicht dabei hatten. Da sie nicht beweisen konnten, verheiratet zu sein, glaubten ihnen die Soldaten nicht und behaupteten, die Frau könne eine der polizeilich gesuchten Prostituierten sein. So wurden die beiden festgenommen und zu jenem Sammelpunkt gebracht, denn der Mann konnte die Soldaten nicht überzeugen. Am Sammelpunkt wurden sie einem Schnellrichter vorgeführt. Im Hof des Gerichts wimmelte es von Menschen, die man aus den verschiedensten Gründen von überallher versammelt hatte. Es waren steckbrieflich Gesuchte dabei, Schmuggler, Prostituierte, Diebe, Grenzverletzer. Schließlich wurde der Mann mit der Auflage freigelassen, er solle seine Heiratsurkunde holen; seine Frau wurde inzwischen dabehalten. Der Mann fuhr so schnell wie möglich nach Hause, schnappte sich die Urkunde und raste wieder zum Sammelpunkt zurück, doch als er dort ankam, fand er seine Frau nicht mehr vor, und nicht nur sie war weg, auch alle anderen Verhafteten.
Er fragte die Soldaten, die ihn festgenommen hatten. 'Du bist zu spät dran', sagten die. 'Aus der Hauptstadt ist ein Befehl gekommen. Heute morgen beim Gebetsruf sind die Verdächtigen zusammen mit allen anderen aufgehängt worden. Es war kein Platz mehr für sie da.'
Seit damals legt der Mann jeden Tag diesen Weg zurück. Er ist der einzige Verrückte, den die Soldaten ungeschoren lassen.„
Durch das verstaubte Rückfenster sieht Akhbar traurig dem Mann hinterher, der an der Straße schnell enteilt. Während der Mann seinem endgültigen Verschwinden entgegenhastet, führt seine Geschichte nirgendwohin.
Akhbar wendet sich zum Fahrer. “Wenn man der Wahrheit viel hinzufügt, wird sie zur Lüge, hast du vorhin gesagt.„
Der Fahrer lacht mit geschlossenem Mund.
Plötzlich spürt Akhbar, wie sehr ihn seine Rückkehr ermüdet. Das Gefühl, heimzukehren, legt sich allmählich, und wenn er die Augen schließt, sieht er sich als ausgehöhlten Baum mit verdorrten Ästen. Überdrüssig hört er den rauhen Wind, der über die Wüste fegt und vor lauter Wiederholung keinem mehr etwas sagt. Er spürt, dass seine Kindheit und seine Jugend in ihm nicht weitergekommen sind, und da erfasst seinen Körper eine große Mattigkeit. Er merkt noch, wie er einschläft, und dann schläft er auch schon.
Er träumt, dass sie noch nicht an der Grenze sind und dass ihn dort Gefahren erwarten. Augenblicklich stellt sich die Angst wieder ein. Als er klopfenden Herzens erwacht, sagt der Fahrer: “Bald sind wir da. Es ist gar nicht mehr weit.„
Als Kind war er einmal einer Schlange hinterher und hatte sich dabei verlaufen. Da die Schlange nicht besonders groß war, hielt er sie für ein harmloses Jungtier und fühlte sich ihr nahe. Unter verzaubernden Krümmungen schlängelte das Tier schließlich vom Weg herunter auf die Ebene zu, wo die Wüste begann. Unter der aufsteigenden Sonne erstreckte sich die Wüste flach wie ein Blatt Papier; nirgends eine Wölbung, eine Wellung, nicht die kleinste Unebenheit. In dieser glatten Wüste, die Akhbar unwirklich vorkam wie ein Traum, wand sich die Schlange dem Horizont entgegen und hinterließ eine Spur, die ihrem Körper glich, und damit einen Weg. Genau das verzauberte Akhbar. Es war ihm ein Weg gezeichnet, diesem folgte er nun, nicht der Schlange. Als die Schlange einmal nach rechts kroch, ging Akhbar ihr hinterdrein. Der Weg der Schlange, die er längst aus den Augen verloren hatte, endete irgendwann am Fuße eines Hügels, hinter Gestrüpp; dort hatte die Schlange ihre Haut abgestreift und zurückgelassen, und hinter dem Gestrüpp war sie verschwunden, um wieder eine neue Haut zu bilden.
Akhbar spürte damals bitter die Gefühlsverwirrung, die in ihm herrschte, doch hatte er keine Worte für sie.
In späteren Jahren besuchte diese Kindheitserinnerung Akhbar noch mehrfach als Traum.
Jetzt, bei seiner Rückkehr in die Heimat, gewann diese machtvolle Erinnerung, die sich in seinem Gedächtnis stets ihren Platz bewahrt hatte, eine andere Bedeutung, als sei die Schlangenhaut wieder neu gefüllt.
In den Füßen spürte er die gleichen Schritte.
Stets trug er eine kleine Sandrose in der Tasche. Sie war ihm mit der Zeit zum Talisman geworden. Wenn er sie einmal vergaß, fehlte sie ihm. Er liebte ihre raue Beschaffenheit, ihr rosiges Braun mit dem staubig-silbernen Einschlag. Sandrosen waren Handarbeiten der Natur, die dem Menschen ergebene Bewunderung abnötigten.
Wenn er spürte, daß er in seiner eigenen Wüste verlorenging, steckte er die Hand in die Tasche, als wollte er sie vor fremden Augen verbergen, und berührte seine Sandrose. Diese Berührung brachte ihn aus der Wüste in die Welt zurück. In der geheimnisvollen Existenz einer Sandrose lag die Unerklärlichkeit der Weltzustände verborgen, dachte er. Die Existenz an sich war schon ein Geheimnis.
Er ließ wieder die Hand in die Tasche gleiten, fuhr mit den Fingerspitzen über die raue Oberfläche und erhoffte sich von der Zeit ein wenig Belebung.
Er bog in die Straße ein, in der er seine Kindheit verbracht hatte. Als wäre er nie von hier fortgegangen.
Der Rahmen der mit schmiedeeisernen Verzierungen geschmückten Tür war smaragdgrün gestrichen, und darauf waren feine Zeichnungen von Blumen und Pflanzen aller Art. Das bedeutete, dass der Hausherr nach Mekka gepilgert war. Den Passanten, dem Viertel, der Stadt, der Welt sagte das: In diesem Haus wohnt ein Hadschi. Jemand, der einer der fünf Vorschriften des Islams Genüge getan hat. Schon als Kind wusste Akhbar, dass eine grün umrahmte Tür dem Viertel Ehre machte.
Als seine Hand nach dem Türklopfer in Form einer geballten Faust griff, fühlte er, dass die auf smaragdenem Grund gezeichneten Blumen und Blätter seine ganze Kindheit ergrünen ließen. Ihn durchströmte ein an Glück grenzendes Gefühl. Natürlich gab es auch in den benachbarten islamischen Ländern die Tradition, den Türrahmen einzufärben; wo er in den letzten Jahren herumgekommen war, hatte er viele solcher Türen gesehen, doch diesmal erzitterte sein Herz, weil die Tür, vor der er stand, seine eigene war. Es war die herbe Freude darüber, dass die Originale der hier abgebildeten Blumen und Blätter im steinernen Innenhof des Hauses in kleinen und großen Töpfen auf ihn warteten.
Die Mekkafahrt war eine Reise. Akhbar kam gleichsam von seiner eigenen Mekkafahrt zurück. Als er in der drückenden Stille den Türklopfer betätigte, hallte es wieder, als habe er an sämtliche Türen der Straße geklopft.
Der Rhythmus der drinnen herannahenden Schritte sagte ihm, die Tür würde von einer trübsinnig gewordenen Frau geöffnet werden. Den Schritten war anzuhören, dass dem Menschen, der sie tat, bis zum Überdruss bewusst war, dass ein Klopfen an der Tür kaum noch Freude bringen würde, vielleicht gar keine mehr, und die Stimme, die zu diesen Schritten gehörte, rief nun: “Wer ist da?„ Er hatte sich nicht getäuscht: Es war eine Frauenstimme.
Akhbar räusperte sich. Er wollte Vertrauen erwecken. “Ich bin es, Akhbar„, sagte er. “Ich suche meine Mutter.„
Die Tür ging einen Spalt weit auf, und hinter einer Burka, deren Sichtfenster aus dichtem Seidenstoff bestand, erahnte er die Gegenwart eines um Licht ringenden Augenpaars. Er fühlte sich bemüßigt zu wiederholen: “Ich suche meine Mutter.„
Die Frau, in ihre Burka zurückgezogen wie in eine Höhle, schwieg und versuchte den Ankömmling zu verstehen und zu erkennen.
“Ich komme von weit her und war schon lange nicht mehr da,„ sagte Akhbar.
“Wie heißt deine Mutter?„ fragte die Frau. Es lag eine erschreckende Mattheit in ihrer Stimme.“Fatima„, antwortete Akhbar.
“Hier heißen die meisten Frauen Fatima„, sagte die Frau. “Ich heiße auch Fatima. Aber ich bin nicht deine Mutter.„
Die Wörter fielen aus ihrem Mund wie erkaltete Asche.
“Als ich wegging, wohnte meine Familie hier„, sagte Akhbar. “Sie müssen weggezogen sein.„
“Vielleicht„, sagte die Frau. “Seit wann wohnen Sie da?„
“Ich weiß nicht mehr„, erwiderte die Frau. “Ich habe das Gefühl, wir wohnen schon immer hier. Vielleicht hast du recht und es sind nur ein paar Jahre. Die Mauern aller Innenhöfe sehen gleich aus.„
Obwohl Akhbar von dem Gespräch mit der Frau entmutigt war, konnte er nicht umhin, noch zu fragen: “Sie wissen also nicht, wohin sie gezogen sind?„ Und als die Frau schwieg, fügte er hinzu: “Oder gezogen sein könnten?"„Nein, ich weiß es nicht“, sagte die Frau mit der gleichen aschigen Mattheit. „Ich weiß überhaupt nicht viel. Frag die Nachbarn; wenn das, was du sagst, stimmt, wird irgend jemand sie noch kennen. Oder geh zu Verwandten. Es können ja nicht alle tot sein. Aber jetzt geh endlich. Ich habe das Essen auf dem Feuer. Außerdem ist der Mann des Hauses nicht da, und es gehört sich nicht, daß ich so lange an der Tür mit dir rede.“
Dann schloss sie die Tür. Genauso matt schlurfte sie davon.
Seine Mutter musste umgezogen sein. Damit hatte er überhaupt nicht gerechnet. Hinter der Tür, die man ihm vor der Nase zugemacht hatte, war seine ganze Kindheit geblieben. In der Ferne hatte er manchmal nachts davon geträumt, wie er nach Hause kam und im Hof herumlief wie damals als Kind. Nach solchen Nächten stand er morgens glücklich auf, dabei konnte man nicht gerade behaupten, seine Kindheit sei glücklich verlaufen; was ihn in den Träumen dennoch glücklich machte, konnte er nicht sagen. Vielleicht war früher einmal Kind sein an sich schon eine Quelle des Glücks.
Verdutzt blieb er vor der verschlossenen Tür stehen. In der Ferne kam es ihm immer so vor, als ob sich zu Hause nichts getan habe und alles unverändert auf ihn warte. Dieses Gefühl, das jeden täuscht, der von zu Hause weggeht, musste wohl auch Akhbar getäuscht haben.
Es war auch genau dieses Gefühl, das den Fortziehenden eines Tages wieder zurückkehren ließ, ihn dazu überredete; und nun hatte dieses täuschende Gefühl ihn gleich an der ersten Tür, an die er klopfte, mutterseelenallein zurückgelassen.
Es mochte sich ja in seinem Land einiges verändert haben, die Umstände mochten viel härter geworden sein, das Leben grausamer, die Beziehungen ruppiger, aber seine Mutter, seine große Schwester und all die anderen Geschwister mussten doch sehnsuchtsvoll auf ihn warten, in einer Sphäre, in der alle Gefühle frisch und unverfälscht erhalten waren, und einem Seelenzustand, der an Reinheit und Wärme nichts eingebüßt hatte.
Beim ersten Nachbarn, an dessen Tür er klopfte, machte niemand auf. Beim zweiten öffneten zwei verdreckte kleine Kinder und sagten, sie seien gerade erst eingezogen und würden niemanden kennen, dann machten sie schnell wieder zu. Bei den nächsten Häusern wurde ihm nicht geöffnet, es sprachen nur Frauen hinter der Tür und schickten ihn fort. Manche verwechselten seine Mutter mit anderen Fatimas. Und ein paar Türen weiter war die Straße zu Ende und die Welt plötzlich leer. So viele Jahre, so viele Wege waren wie bei einem Sandsturm von einem riesigen Himmelsschlauch aufgesaugt und verschlungen worden. Selbst in einsamsten Zeiten hatte Akhbar nicht solch eine Einsamkeit verspürt. Als müsse er sich ganz neu versichern, daß er wirklich lebte, griff er zu dem Amulett, das er um den Hals trug. Wenn ihm ein Zauberspruch aus einem alten Märchen wieder einfiele, dann würde er von dem Bann erlöst und in die Welt zurückgelangen. Die rechte Hand um das Amulett gekrallt, ließ er sich seine Gebete durchs Herz gehen. Krampfhaft versuchte er sich ins Gedächtnis zu rufen, wer ihm helfen könnte. Irgendwo musste doch jemand sein, der ihn kannte oder den er selbst kannte.
Als er an dem Hamam vorbeikommt, an dessen Kuppel er sich früher von Dach zu Dach herangeschlichen hatte, um durch die kleinen Fenster oben hineinzuspähen, schlägt ihm - der Zeit entrissen - der Geruch von im Heizofen verbrannten Scheiten aus Maulbeerholz in die Nase. Es brennt ihn in der Kehle.
Der Krämer des Viertels war an Altersschwäche gestorben. Sein Sohn dagegen, mit dem er als Kind auf der Straße Reifentreiben gespielt hatte, war im Krieg vermisst. Man wusste nicht, ob er fahnenflüchtig oder gefallen war. Demnach wusste auch seine Familie nicht, ob ihr ein Märtyrer oder ein Verräter entstammte, und so verharrte sie leidend in einem Schwebezustand zwischen Stolz und Scham.
Das erzählte ihm, hinter seinem Tresen, der neue Ladeninhaber, ein finsterer junger Mann, den er früher nie gesehen hatte. Er erweckte den Eindruck, als ob er sich hauptsächlich dafür zuständig fühlte, im Viertel für Ordnung zu sorgen und die Leute zu überwachen, und seine Informationen gab er im Ton einer Amtsperson. Seine eng zusammenstehenden Augen schienen aus ihren Höhlen heraus geradewegs ein Ziel anzuvisieren, so dass bei seinem Gegenüber sofort ein Schuldbewusstsein aufkam. Er fragte denn auch Akhbar protokollartig danach aus, warum er ins Ausland gegangen und weshalb er nicht sofort zurückgekehrt sei, wo er während des Krieges gewesen sei, was er dort gemacht habe, in was für Kreisen er verkehre, und er behandelte ihn damit wie einen an der Grenze festgenommenen Verdächtigen. Er konnte die Grausamkeit nicht verbergen, die in seiner stahlkalten Stimme lag. Selbst die Grenzwachen hatten Akhbar nicht so eingeschüchtert.
Um keinen Verdacht zu erregen, beantwortete Akhbar die Fragen in möglichst ruhigem Ton und sanfter Manier, ohne aber je ins Detail zu gehen. Das Viertel, in dem er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte, war ihm plötzlich zu einem fremden, unsicheren Ort geworden. Am liebsten hätte er vor sich hin gepfiffen. Das hatte er als Kind gemacht, um seine Furcht zu überwinden, wenn er sich verspätet hatte und nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause musste. Seine Lippen schürzten sich schon, als würde ihm wirklich leichter, wenn er nur pfeifen könnte.
Er musste ein paar Viertel weiter gehen und seine Schwester finden; nur sie wusste wohl, wohin die Mutter verzogen war. Während er durch die Straßen hastete, rief er seine Erinnerungen zu Hilfe; je mehr er sich erinnerte, desto schneller würde er seine Verwandten finden. Es waren eigentlich keine schlechten Erinnerungen, und doch tat die Vergangenheit ihm weh. Er musste in das Alter gekommen sein, in dem Erinnerungen schmerzen. Ab einem bestimmten Alter schmerzen sie immer, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind. War er so früh schon in dieses Alter gekommen? Unter den Geräuschen, die aus manchen Häusern auf die Straße dringen, ist das Knacken und Knistern, das entsteht, wenn geschickte Hände in einem ganz bestimmten Rhythmus den Stößel in einem Bronzemörser bewegen, um Reis zu entspelzen. Akhbar hört dieses Geräusch aus allen anderen heraus. Und dann die Gerüche, die nach draußen strömen. In manchen Haushalten ist es noch üblich, wilde Raute und Schafgarbe zu verbrennen, um die Hausbewohner mit dem Rauch vor dem bösen Blick zu schützen. Hinter einigen Mauern macht Akhbar den Geruch von geklopften Teppichen und frisch gewaschenen Kelims aus. Solche wohlvertrauten Details lassen ihn hoffen, auf der richtigen Spur zu sein.
Ein Haus war für Akhbar gleichbedeutend mit dem kühlen, feuchten Geruch eines Kellers, in den steile, schmale Stufen hinunterführen. Gegen jedes Fitzelchen Hitze, das sich dennoch diese Stufen hinunterstehlen sollte, wurden manche Esswaren ganz besonders geschützt, etwa die hausgemachten Würste, die man ganz nah an den feuchten Steinen der hintersten Wand aufhängte. Akhbar wunderte sich selbst, dass er solche Einzelheiten nach all der Zeit noch so frisch in sich trug, und da die Geräusche und Gerüche aus den Innenhöfen so vieles in ihm auslösten, fragte er sich, was wohl noch alles in ihm verborgen lag. Vielleicht war Heimkehren eben so etwas.
In der Nähe vom Haus seiner Schwester sah Akhbar eine Frau dahineilen, deren breiter Schatten an der Mauer entlangglitt wie ein grauer Fleck, während der ein, zwei Schritte vor ihr gehende Mann in seiner Hast den langen Umhang, den er trug, über den Boden schleifen ließ. Irgendwie stellte Akhbar sich vor, die Frau könnte seine Schwester sein. Auf diesen Gedanken konnte ihn der Gang der Frau bringen. Seine Schwester stürzte nämlich auch immer so dahin, die Füße ganz nah beieinander. Der Mann vor ihr musste ihr Gatte sein. Er sah das Gesicht des Mannes nicht, doch von der Erscheinung her konnte es sein Schwager sein. Ihm kam in den Sinn, den beiden den Namen seiner Schwester hinterherzurufen. Ja, denn auch seine Schwester hatte den linken Fuß immer leicht einwärts gedreht. Er kannte diesen Gang. Diese Ähnlichkeit machte ihn fast sicher, aber dennoch hielt er sich zurück, denn wenn er sich täuschte, konnte dieses Missverständnis ihm ziemlichen Ärger einbringen. Es war vernünftiger, wenn er seine Schritte beschleunigte und versuchte, einen Blick auf das Gesicht des Mannes zu erhaschen. Erst dachte er, die beiden seien auf dem Nachhauseweg, aber dann kam er zu dem Schluss, sie hätten vielmehr eine Nachricht bekommen und müssten ganz schnell irgendwohin. Verheiratete Paare gingen auf der ganzen Welt langsam und mit hängenden Schultern nach Hause. Sie wussten ja, was sie dort erwartete.
Als er sie fast eingeholt hatte, bogen die beiden in eine andere Straße ein, aber in der falschen Richtung. Gleich danach drehte der Mann sich um, als wollte er sich vergewissern, ob da jemand hinter ihm herging. Akhbar und er sahen sich an. Mochte das Gesicht des Mannes auch noch so sehr von dem dichten grauen Bart verborgen sein und dem ausgefransten tabakfarbenen Turban, der ihm zu weit in die Stirn hing, so war doch klar, dass es nicht sein Schwager war. Außerdem ging es zur Straße, in der seine Schwester wohnte, nach links. Er hatte also umsonst gefiebert und sich Hoffnungen gemacht. Das Leben hatte ihm nie geholfen, warum sollte es das jetzt tun? Er ging nach links. Seine Schritte und die der beiden Fremden hallten voneinander weg.
Als er schließlich beim Haus seiner Schwester anlangte, setzte schon die Dämmerung ein.
Die Tür öffnete ihm ein junger Bursche, der älteste Sohn des Hauses. Die Arme hingen ihm am Körper entlang, fast bis zu den Knien, als stünde er in Habachtstellung da. Obwohl er gerade erst einen Anflug von Bartwuchs hatte, sahen seine Augen wie die eines alten, lebenserfahrenen Mannes drein. Es lag nicht die geringste Frische in seinem Blick. Kurz flackerte in Akhbar der Gedanke auf, dieser Junge könne sein Neffe sein, doch selbst im Halbdunkel war noch zu erkennen, dass er sich getäuscht hatte.
„Das müssen unsere Vormieter gewesen sein. Sie sind weggezogen, in den Süden. Sie sind nicht mehr in der Stadt“, sagte der Junge.
„Warum?“ fragte Akhbar, als ob der Junge alles wisse.
„Wahrscheinlich, weil ihr Sohn gestorben ist. Hier im Haus. Da wollten sie hier nicht mehr wohnen. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Ein toter Junge in meinem Alter.“
Akhbar rechnete aus, dass sein Neffe, wenn er noch lebte, ein Heranwachsender im Alter jenes Jungen wäre. Das versetzte ihm einen Stich. Er konnte sich an seinen Neffen als kleines Kind erinnern. Wie er ihn zum ersten Mal auf den Arm genommen hatte. Wie der Junge „Onkel“ zu ihm gesagt hatte und sie miteinander Fußball spielten. Dem Jungen, der ihm nun gegenüberstand, musste sein Neffe seine Seele vermacht haben. Ein so junger Mensch konnte nur deshalb so alt wirken, wenn sich die Seele eines Toten in ihm einnistete, so wie man in ein Haus einzieht.
Akhbar ging von dem Haus fort, das nicht mehr das seiner Schwester war, und ließ von dem, was in ihm drinnen entzwei ging, wieder etwas zurück, während der Junge an der Tür einfach stehenblieb.
Ein neues Regime ist an der Macht, das Land ist sichtbar vom Krieg zerstört, er erkennt es kaum wieder.
Die Orte der Kindheit und Jugend scheinen unauffindbar zu sein.
So irrt Akbhar von Tür zu Tür, von Stadt zu Stadt.
Was ihn am meisten beunruhigt, ist der Anblick der Frauen, deren Gesichter hinter einem Tschador versteckt sind - so als wäre damit die „Hälfte des Lebens“ ausgelöscht, wie er sagt.
„Ich kann zwar nicht lesen“,
sagt Akbhars Fahrer zu Beginn der Reise,
„aber Menschengesichter sind für mich Geschriebenes.“
LESEPROBE
Obwohl sich in der Ferne die kahlen Berge zum Verzweifeln ähnlich sehen, die niedrigen Hügel denkbar fahl wirken, der Sand zu fast gleich hohen Dünen zusammengeweht ist und die staubige Sonne alles, was er bisher gesehen hat, mit der gleichen Ungerührtheit versengt, fühlt Akhbar doch, dass er seinem Land näher kommt, dass es nicht mehr weit bis zur Grenze ist, doch nicht an vertrauten Wegzeichen erkennt er das, sondern an Untiefen seines Herzens, an die er nicht einmal eine Erinnerung hat.
Die Hitze hat die beiden eingelullt. Schon lange reden sie nicht mehr und lauschen nur noch auf den Weg, auf die Sonnenglut, auf die Wüste, der sie mal näher, mal ferner sind. Was sie einander zu sagen hatten, war schnell verbraucht, bald hatten sie gar kein Bedürfnis mehr zu sprechen. Um sich vor dem scharfen, heißen Wüstenwind zu schützen, halten sie die Autofenster dicht geschlossen, und der Blick durch die sandige Verschleierung verrät Akhbar nichts darüber, woran sie gerade vorbeiziehen, wohin sie gerade fahren. Es ist ein altes, hochbeiniges Auto mit gewaltigen Reifenprofilen und offener Ladefläche; wo Lack abgesprungen war, hatte man in diversesten Farben ausgebessert. Unterwegs mussten sie unzählige Male anhalten. An kühlen Orten schöpften sie Kraft.
Als Akhbar den Schweiß bemerkt, der dem Fahrer von der Stirn bis zum Hals rinnt, fällt ihm selbst wieder ein, die Hand zum Gesicht zu führen. Er weiß, dass man es irgendwann aufgibt, sich den Schweiß abzuwischen. Mit dem dünnen Seidenstoff seines gelben, mit weißen Fäden durchwirkten Turbans wischt er sich Gesicht und Kopf ab, wickelt sich dann den Turban wieder um und zieht ihn fest. Er reibt sich das Gesicht, um sich zu erfrischen. Der Fahrer nimmt diese Vorbereitungen wahr und sagt lächelnd, als wolle er sie gutheißen: „Wir sind bald an der Grenze.“ Trotz der dicken, violetten Lippen und der vielen Zahnlücken ist es ein gutes Lächeln. Es weckt keine dunklen Gefühle in einem. Akhbar lächelt zurück.
Als am Horizont die ersten Anzeichen für die Grenze sichtbar werden, spürt Akhbar, wie vertrocknet seine Lippen sind, und führt die Feldflasche zum Mund. Da fällt ihm ein, dass er höflichkeitshalber zuerst den Fahrer hätte fragen müssen. „Willst du auch etwas?“ Der Fahrer schüttelt den Kopf.
Hatte die Grenze aus der Ferne lediglich als Ansammlung einzelner Gebäude gewirkt, so bemerkt Akhbar nun, dass sie viel befestigter ist, als er gedacht hätte. Er sieht elektrischen Stacheldraht, kleine Erdhaufen, unter denen sich Minen vermuten lassen, Wachtürme, Gräben, Schutzwälle und in breiten Löchern je eine zimmergroße Hütte, deren Zweck sich nicht erschließt.
Zwar hofft er, mit seinem neuen Pass und den sonstigen Papieren, die er zigmal überprüft hat, wird es an der Grenze keine Schwierigkeiten geben, doch wacht in ihm dennoch eine Furcht. Sie wird von dem genährt, was ihm in der Ferne zu Ohren kam, von Zeitungsberichten und Flüchtlingserzählungen, und nicht zuletzt von der Wahrscheinlichkeit, dass sein Pech, dem er schon so oft in die Falle ging, ihm wieder einen Streich spielen würde. Würde es nicht Argwohn erregen, dass er nach so vielen Jahren in die Heimat zurückwollte? Würden die Behörden ihm das nicht negativ auslegen und versuchen, ihn mit absurden Fragen, auf die er keine Antwort wüsste, in die Enge zu treiben? Ihn tröstet allein, dass er das Land lange vor dem Regierungssturz verlassen hat und seiner Rückkehr nichts Politisches anhaftet. Das würden sie vermutlich wissen. So gründlich und leidenschaftlich, wie sie die Grenze bewachten, wussten sie es sogar bestimmt. Akhbar ist jemand geworden, der sich in nichts mehr einmischt, nie.
Der Fahrer sieht ihm seine Befürchtungen an. „Du sorgst dich ganz umsonst. Es passiert nichts, du wirst sehen. Ich fahre mindestens fünf Mal pro Woche hier durch. Es ist alles nicht mehr so streng wie früher. Lügen entstehen, wenn jeder der Wahrheit etwas hinzufügt.“
Akhbar wäre gern sicher, dass diese Worte nicht nur seiner Beruhigung dienen sollen.
An der Grenze werden sie angehalten.
Der Fahrer steigt aus und wird von den Soldaten wie ein alter Bekannter gegrüßt. Akhbar gewinnt ein Stück Sicherheit zurück. Es waren also nicht leere Worte gewesen, als der Fahrer gesagt hatte: „Ich bringe dich sicher über die Grenze.“ Im Schatten des Wachgebäudes unterhalten sich die Soldaten und der Fahrer; es ist ihnen nicht anzusehen, worüber. Von ihren Gesichtern, ihrer ganzen Haltung geht eine nichtssagende Normalität aus, die schon fast einstudiert wirkt. Dann holen sie Akhbar zu sich und treten ins Innere des Gebäudes. Außer dem entnervenden Quietschen des Deckenventilators mit seinen riesigen Flügeln ist nichts zu hören.
Hinter einem Tisch sitzt ein hochrangiger Militär, dem versteinerte Abscheu ins Gesicht geschrieben steht, und sieht lange schweigend und ungläubig Akhbars Papiere durch. Als wolle er sein Gegenüber in eine Falle locken, sieht er manchmal ruckartig auf und richtet bohrende Blicke auf Akhbars Gesicht, wie um darin Antworten zu suchen, die in den Papieren nicht zu finden sind. Offensichtlich wägt er ab, was die Wahl dieses wenig benutzten Grenzübergangs zu bedeuten hat.
Wie unschuldige Menschen es in solchen Fällen oft tun, wendet Akhbar mit schuldigem Blick das Gesicht ab. Aus diesem Blick spricht die Furcht, man werde zu Unrecht als Opfer auserkoren.
Als sie wieder ins Auto steigen, fühlt Akhbar sich unendlich leicht. Die Furcht so vieler Jahre ist plötzlich verflogen. Den fern der Heimat verbrachten Nächten ist ein Morgen geworden. Ein Aufwachen in vertrauten Armen nach einem Alptraum. Er denkt, der restliche Teil der Reise wird nun viel schneller vergehen. Plötzlich merkt er, dass er sogar die Hitze vergessen hat. Die nicht unbeträchtliche Summe, die er dem Fahrer gezahlt hat, war also verdient.
„Warum haben sie deine Papiere nicht verlangt?“ fragt er ihn.
„Wie gesagt, ich komme hier mindestens fünf Mal pro Woche durch. Die kennen mich inzwischen besser, als meine Mutter mich kennt. Was sollen sie mich da nach Papieren fragen? Sie wissen, daß ich nichts Unrechtes tue. Menschenschmuggel ist viel lukrativer, aber das habe ich kein einziges Mal gemacht. Man weiß nie, wann man dabei verliert. Ich mache nichts, was mir Scherereien bringt.“
„Warum hast du mir dann geglaubt? Ich hätte dich doch anlügen können.“
„Ich kann zwar nicht lesen, aber ich kenne Buchstaben, und da ich meine Buchstaben kenne, verstehe ich Geschriebenes. Menschengesichter sind für mich Geschriebenes.“
Über Akhbars Gesicht fährt ein Zucken.
Sie schweigen wieder lange.
Nach einer Weile sehen sie ein massives, wie eine alte Festung von hohen Mauern umgebenes Bauwerk auftauchen, das anscheinend aus mehreren miteinander verbundenen Gebäuden besteht. Es sieht unheimlich aus, furchteinflößend, wie eine Märchenburg, in der gute Menschen von Bösewichten festgehalten werden.
„Was ist das?“ fragte Akhbar erstaunt.
„Sie nennen es Sammelpunkt. Es ist sowohl Gericht als auch Gefängnis und Lager. Ein Ort für verschiedenerlei Zwecke. Hierher werden Illegale, Verbrecher und Schmuggler verbracht. Und dann geschieht, was eben geschieht.“
Soldaten, die auf der Höhe der Anlage Posten stehen, bedeuten ihnen schon von weitem, langsamer zu fahren. Als sie sich im Schritttempo nähern, äugen die Soldaten misstrauisch ins Wageninnere und winken sie schließlich durch.
Das Auto beschleunigt wieder. Wie eine Halluzination taucht kurz danach am Straßenrand ein Mann auf. Er hat trotz der Hitze nur ein leichtes Tuch auf dem Kopf, geht geschäftigen Schrittes dahin und redet dabei mit sich selbst.
Der Fahrer sieht Akhbar in das neugierig-besorgte Gesicht. „Er hat den Verstand verloren“, sagt er dann. „Er geht diesen Weg jeden Tag. Ob Sommer oder Winter geht er Tag für Tag von der Stadt bis zu dem Sammelpunkt vorhin und dann wieder zurück.“
Mit einem Blick erheischt Akhbar vom Fahrer eine Erklärung.
„Soll ich dir seine Geschichte erzählen?“ fragt der Fahrer.
„Natürlich.“
"Bis vor kurzem war der Mann noch glücklich. Er hatte eine schöne junge Frau, eine gute Arbeit und ein geordnetes Leben. Eines Tages fuhr er mit seiner Frau in die Nachbarstadt, um seine Schwiegereltern zu besuchen. Ein paar Tage später, auf dem Rückweg, gerieten sie in eine Straßenkontrolle des Militärs, und es stellte sich heraus, dass sie ihre Heiratsurkunde nicht dabei hatten. Da sie nicht beweisen konnten, verheiratet zu sein, glaubten ihnen die Soldaten nicht und behaupteten, die Frau könne eine der polizeilich gesuchten Prostituierten sein. So wurden die beiden festgenommen und zu jenem Sammelpunkt gebracht, denn der Mann konnte die Soldaten nicht überzeugen. Am Sammelpunkt wurden sie einem Schnellrichter vorgeführt. Im Hof des Gerichts wimmelte es von Menschen, die man aus den verschiedensten Gründen von überallher versammelt hatte. Es waren steckbrieflich Gesuchte dabei, Schmuggler, Prostituierte, Diebe, Grenzverletzer. Schließlich wurde der Mann mit der Auflage freigelassen, er solle seine Heiratsurkunde holen; seine Frau wurde inzwischen dabehalten. Der Mann fuhr so schnell wie möglich nach Hause, schnappte sich die Urkunde und raste wieder zum Sammelpunkt zurück, doch als er dort ankam, fand er seine Frau nicht mehr vor, und nicht nur sie war weg, auch alle anderen Verhafteten.
Er fragte die Soldaten, die ihn festgenommen hatten. 'Du bist zu spät dran', sagten die. 'Aus der Hauptstadt ist ein Befehl gekommen. Heute morgen beim Gebetsruf sind die Verdächtigen zusammen mit allen anderen aufgehängt worden. Es war kein Platz mehr für sie da.'
Seit damals legt der Mann jeden Tag diesen Weg zurück. Er ist der einzige Verrückte, den die Soldaten ungeschoren lassen.„
Durch das verstaubte Rückfenster sieht Akhbar traurig dem Mann hinterher, der an der Straße schnell enteilt. Während der Mann seinem endgültigen Verschwinden entgegenhastet, führt seine Geschichte nirgendwohin.
Akhbar wendet sich zum Fahrer. “Wenn man der Wahrheit viel hinzufügt, wird sie zur Lüge, hast du vorhin gesagt.„
Der Fahrer lacht mit geschlossenem Mund.
Plötzlich spürt Akhbar, wie sehr ihn seine Rückkehr ermüdet. Das Gefühl, heimzukehren, legt sich allmählich, und wenn er die Augen schließt, sieht er sich als ausgehöhlten Baum mit verdorrten Ästen. Überdrüssig hört er den rauhen Wind, der über die Wüste fegt und vor lauter Wiederholung keinem mehr etwas sagt. Er spürt, dass seine Kindheit und seine Jugend in ihm nicht weitergekommen sind, und da erfasst seinen Körper eine große Mattigkeit. Er merkt noch, wie er einschläft, und dann schläft er auch schon.
Er träumt, dass sie noch nicht an der Grenze sind und dass ihn dort Gefahren erwarten. Augenblicklich stellt sich die Angst wieder ein. Als er klopfenden Herzens erwacht, sagt der Fahrer: “Bald sind wir da. Es ist gar nicht mehr weit.„
Als Kind war er einmal einer Schlange hinterher und hatte sich dabei verlaufen. Da die Schlange nicht besonders groß war, hielt er sie für ein harmloses Jungtier und fühlte sich ihr nahe. Unter verzaubernden Krümmungen schlängelte das Tier schließlich vom Weg herunter auf die Ebene zu, wo die Wüste begann. Unter der aufsteigenden Sonne erstreckte sich die Wüste flach wie ein Blatt Papier; nirgends eine Wölbung, eine Wellung, nicht die kleinste Unebenheit. In dieser glatten Wüste, die Akhbar unwirklich vorkam wie ein Traum, wand sich die Schlange dem Horizont entgegen und hinterließ eine Spur, die ihrem Körper glich, und damit einen Weg. Genau das verzauberte Akhbar. Es war ihm ein Weg gezeichnet, diesem folgte er nun, nicht der Schlange. Als die Schlange einmal nach rechts kroch, ging Akhbar ihr hinterdrein. Der Weg der Schlange, die er längst aus den Augen verloren hatte, endete irgendwann am Fuße eines Hügels, hinter Gestrüpp; dort hatte die Schlange ihre Haut abgestreift und zurückgelassen, und hinter dem Gestrüpp war sie verschwunden, um wieder eine neue Haut zu bilden.
Akhbar spürte damals bitter die Gefühlsverwirrung, die in ihm herrschte, doch hatte er keine Worte für sie.
In späteren Jahren besuchte diese Kindheitserinnerung Akhbar noch mehrfach als Traum.
Jetzt, bei seiner Rückkehr in die Heimat, gewann diese machtvolle Erinnerung, die sich in seinem Gedächtnis stets ihren Platz bewahrt hatte, eine andere Bedeutung, als sei die Schlangenhaut wieder neu gefüllt.
In den Füßen spürte er die gleichen Schritte.
Stets trug er eine kleine Sandrose in der Tasche. Sie war ihm mit der Zeit zum Talisman geworden. Wenn er sie einmal vergaß, fehlte sie ihm. Er liebte ihre raue Beschaffenheit, ihr rosiges Braun mit dem staubig-silbernen Einschlag. Sandrosen waren Handarbeiten der Natur, die dem Menschen ergebene Bewunderung abnötigten.
Wenn er spürte, daß er in seiner eigenen Wüste verlorenging, steckte er die Hand in die Tasche, als wollte er sie vor fremden Augen verbergen, und berührte seine Sandrose. Diese Berührung brachte ihn aus der Wüste in die Welt zurück. In der geheimnisvollen Existenz einer Sandrose lag die Unerklärlichkeit der Weltzustände verborgen, dachte er. Die Existenz an sich war schon ein Geheimnis.
Er ließ wieder die Hand in die Tasche gleiten, fuhr mit den Fingerspitzen über die raue Oberfläche und erhoffte sich von der Zeit ein wenig Belebung.
Er bog in die Straße ein, in der er seine Kindheit verbracht hatte. Als wäre er nie von hier fortgegangen.
Der Rahmen der mit schmiedeeisernen Verzierungen geschmückten Tür war smaragdgrün gestrichen, und darauf waren feine Zeichnungen von Blumen und Pflanzen aller Art. Das bedeutete, dass der Hausherr nach Mekka gepilgert war. Den Passanten, dem Viertel, der Stadt, der Welt sagte das: In diesem Haus wohnt ein Hadschi. Jemand, der einer der fünf Vorschriften des Islams Genüge getan hat. Schon als Kind wusste Akhbar, dass eine grün umrahmte Tür dem Viertel Ehre machte.
Als seine Hand nach dem Türklopfer in Form einer geballten Faust griff, fühlte er, dass die auf smaragdenem Grund gezeichneten Blumen und Blätter seine ganze Kindheit ergrünen ließen. Ihn durchströmte ein an Glück grenzendes Gefühl. Natürlich gab es auch in den benachbarten islamischen Ländern die Tradition, den Türrahmen einzufärben; wo er in den letzten Jahren herumgekommen war, hatte er viele solcher Türen gesehen, doch diesmal erzitterte sein Herz, weil die Tür, vor der er stand, seine eigene war. Es war die herbe Freude darüber, dass die Originale der hier abgebildeten Blumen und Blätter im steinernen Innenhof des Hauses in kleinen und großen Töpfen auf ihn warteten.
Die Mekkafahrt war eine Reise. Akhbar kam gleichsam von seiner eigenen Mekkafahrt zurück. Als er in der drückenden Stille den Türklopfer betätigte, hallte es wieder, als habe er an sämtliche Türen der Straße geklopft.
Der Rhythmus der drinnen herannahenden Schritte sagte ihm, die Tür würde von einer trübsinnig gewordenen Frau geöffnet werden. Den Schritten war anzuhören, dass dem Menschen, der sie tat, bis zum Überdruss bewusst war, dass ein Klopfen an der Tür kaum noch Freude bringen würde, vielleicht gar keine mehr, und die Stimme, die zu diesen Schritten gehörte, rief nun: “Wer ist da?„ Er hatte sich nicht getäuscht: Es war eine Frauenstimme.
Akhbar räusperte sich. Er wollte Vertrauen erwecken. “Ich bin es, Akhbar„, sagte er. “Ich suche meine Mutter.„
Die Tür ging einen Spalt weit auf, und hinter einer Burka, deren Sichtfenster aus dichtem Seidenstoff bestand, erahnte er die Gegenwart eines um Licht ringenden Augenpaars. Er fühlte sich bemüßigt zu wiederholen: “Ich suche meine Mutter.„
Die Frau, in ihre Burka zurückgezogen wie in eine Höhle, schwieg und versuchte den Ankömmling zu verstehen und zu erkennen.
“Ich komme von weit her und war schon lange nicht mehr da,„ sagte Akhbar.
“Wie heißt deine Mutter?„ fragte die Frau. Es lag eine erschreckende Mattheit in ihrer Stimme.“Fatima„, antwortete Akhbar.
“Hier heißen die meisten Frauen Fatima„, sagte die Frau. “Ich heiße auch Fatima. Aber ich bin nicht deine Mutter.„
Die Wörter fielen aus ihrem Mund wie erkaltete Asche.
“Als ich wegging, wohnte meine Familie hier„, sagte Akhbar. “Sie müssen weggezogen sein.„
“Vielleicht„, sagte die Frau. “Seit wann wohnen Sie da?„
“Ich weiß nicht mehr„, erwiderte die Frau. “Ich habe das Gefühl, wir wohnen schon immer hier. Vielleicht hast du recht und es sind nur ein paar Jahre. Die Mauern aller Innenhöfe sehen gleich aus.„
Obwohl Akhbar von dem Gespräch mit der Frau entmutigt war, konnte er nicht umhin, noch zu fragen: “Sie wissen also nicht, wohin sie gezogen sind?„ Und als die Frau schwieg, fügte er hinzu: “Oder gezogen sein könnten?"„Nein, ich weiß es nicht“, sagte die Frau mit der gleichen aschigen Mattheit. „Ich weiß überhaupt nicht viel. Frag die Nachbarn; wenn das, was du sagst, stimmt, wird irgend jemand sie noch kennen. Oder geh zu Verwandten. Es können ja nicht alle tot sein. Aber jetzt geh endlich. Ich habe das Essen auf dem Feuer. Außerdem ist der Mann des Hauses nicht da, und es gehört sich nicht, daß ich so lange an der Tür mit dir rede.“
Dann schloss sie die Tür. Genauso matt schlurfte sie davon.
Seine Mutter musste umgezogen sein. Damit hatte er überhaupt nicht gerechnet. Hinter der Tür, die man ihm vor der Nase zugemacht hatte, war seine ganze Kindheit geblieben. In der Ferne hatte er manchmal nachts davon geträumt, wie er nach Hause kam und im Hof herumlief wie damals als Kind. Nach solchen Nächten stand er morgens glücklich auf, dabei konnte man nicht gerade behaupten, seine Kindheit sei glücklich verlaufen; was ihn in den Träumen dennoch glücklich machte, konnte er nicht sagen. Vielleicht war früher einmal Kind sein an sich schon eine Quelle des Glücks.
Verdutzt blieb er vor der verschlossenen Tür stehen. In der Ferne kam es ihm immer so vor, als ob sich zu Hause nichts getan habe und alles unverändert auf ihn warte. Dieses Gefühl, das jeden täuscht, der von zu Hause weggeht, musste wohl auch Akhbar getäuscht haben.
Es war auch genau dieses Gefühl, das den Fortziehenden eines Tages wieder zurückkehren ließ, ihn dazu überredete; und nun hatte dieses täuschende Gefühl ihn gleich an der ersten Tür, an die er klopfte, mutterseelenallein zurückgelassen.
Es mochte sich ja in seinem Land einiges verändert haben, die Umstände mochten viel härter geworden sein, das Leben grausamer, die Beziehungen ruppiger, aber seine Mutter, seine große Schwester und all die anderen Geschwister mussten doch sehnsuchtsvoll auf ihn warten, in einer Sphäre, in der alle Gefühle frisch und unverfälscht erhalten waren, und einem Seelenzustand, der an Reinheit und Wärme nichts eingebüßt hatte.
Beim ersten Nachbarn, an dessen Tür er klopfte, machte niemand auf. Beim zweiten öffneten zwei verdreckte kleine Kinder und sagten, sie seien gerade erst eingezogen und würden niemanden kennen, dann machten sie schnell wieder zu. Bei den nächsten Häusern wurde ihm nicht geöffnet, es sprachen nur Frauen hinter der Tür und schickten ihn fort. Manche verwechselten seine Mutter mit anderen Fatimas. Und ein paar Türen weiter war die Straße zu Ende und die Welt plötzlich leer. So viele Jahre, so viele Wege waren wie bei einem Sandsturm von einem riesigen Himmelsschlauch aufgesaugt und verschlungen worden. Selbst in einsamsten Zeiten hatte Akhbar nicht solch eine Einsamkeit verspürt. Als müsse er sich ganz neu versichern, daß er wirklich lebte, griff er zu dem Amulett, das er um den Hals trug. Wenn ihm ein Zauberspruch aus einem alten Märchen wieder einfiele, dann würde er von dem Bann erlöst und in die Welt zurückgelangen. Die rechte Hand um das Amulett gekrallt, ließ er sich seine Gebete durchs Herz gehen. Krampfhaft versuchte er sich ins Gedächtnis zu rufen, wer ihm helfen könnte. Irgendwo musste doch jemand sein, der ihn kannte oder den er selbst kannte.
Als er an dem Hamam vorbeikommt, an dessen Kuppel er sich früher von Dach zu Dach herangeschlichen hatte, um durch die kleinen Fenster oben hineinzuspähen, schlägt ihm - der Zeit entrissen - der Geruch von im Heizofen verbrannten Scheiten aus Maulbeerholz in die Nase. Es brennt ihn in der Kehle.
Der Krämer des Viertels war an Altersschwäche gestorben. Sein Sohn dagegen, mit dem er als Kind auf der Straße Reifentreiben gespielt hatte, war im Krieg vermisst. Man wusste nicht, ob er fahnenflüchtig oder gefallen war. Demnach wusste auch seine Familie nicht, ob ihr ein Märtyrer oder ein Verräter entstammte, und so verharrte sie leidend in einem Schwebezustand zwischen Stolz und Scham.
Das erzählte ihm, hinter seinem Tresen, der neue Ladeninhaber, ein finsterer junger Mann, den er früher nie gesehen hatte. Er erweckte den Eindruck, als ob er sich hauptsächlich dafür zuständig fühlte, im Viertel für Ordnung zu sorgen und die Leute zu überwachen, und seine Informationen gab er im Ton einer Amtsperson. Seine eng zusammenstehenden Augen schienen aus ihren Höhlen heraus geradewegs ein Ziel anzuvisieren, so dass bei seinem Gegenüber sofort ein Schuldbewusstsein aufkam. Er fragte denn auch Akhbar protokollartig danach aus, warum er ins Ausland gegangen und weshalb er nicht sofort zurückgekehrt sei, wo er während des Krieges gewesen sei, was er dort gemacht habe, in was für Kreisen er verkehre, und er behandelte ihn damit wie einen an der Grenze festgenommenen Verdächtigen. Er konnte die Grausamkeit nicht verbergen, die in seiner stahlkalten Stimme lag. Selbst die Grenzwachen hatten Akhbar nicht so eingeschüchtert.
Um keinen Verdacht zu erregen, beantwortete Akhbar die Fragen in möglichst ruhigem Ton und sanfter Manier, ohne aber je ins Detail zu gehen. Das Viertel, in dem er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte, war ihm plötzlich zu einem fremden, unsicheren Ort geworden. Am liebsten hätte er vor sich hin gepfiffen. Das hatte er als Kind gemacht, um seine Furcht zu überwinden, wenn er sich verspätet hatte und nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause musste. Seine Lippen schürzten sich schon, als würde ihm wirklich leichter, wenn er nur pfeifen könnte.
Er musste ein paar Viertel weiter gehen und seine Schwester finden; nur sie wusste wohl, wohin die Mutter verzogen war. Während er durch die Straßen hastete, rief er seine Erinnerungen zu Hilfe; je mehr er sich erinnerte, desto schneller würde er seine Verwandten finden. Es waren eigentlich keine schlechten Erinnerungen, und doch tat die Vergangenheit ihm weh. Er musste in das Alter gekommen sein, in dem Erinnerungen schmerzen. Ab einem bestimmten Alter schmerzen sie immer, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind. War er so früh schon in dieses Alter gekommen? Unter den Geräuschen, die aus manchen Häusern auf die Straße dringen, ist das Knacken und Knistern, das entsteht, wenn geschickte Hände in einem ganz bestimmten Rhythmus den Stößel in einem Bronzemörser bewegen, um Reis zu entspelzen. Akhbar hört dieses Geräusch aus allen anderen heraus. Und dann die Gerüche, die nach draußen strömen. In manchen Haushalten ist es noch üblich, wilde Raute und Schafgarbe zu verbrennen, um die Hausbewohner mit dem Rauch vor dem bösen Blick zu schützen. Hinter einigen Mauern macht Akhbar den Geruch von geklopften Teppichen und frisch gewaschenen Kelims aus. Solche wohlvertrauten Details lassen ihn hoffen, auf der richtigen Spur zu sein.
Ein Haus war für Akhbar gleichbedeutend mit dem kühlen, feuchten Geruch eines Kellers, in den steile, schmale Stufen hinunterführen. Gegen jedes Fitzelchen Hitze, das sich dennoch diese Stufen hinunterstehlen sollte, wurden manche Esswaren ganz besonders geschützt, etwa die hausgemachten Würste, die man ganz nah an den feuchten Steinen der hintersten Wand aufhängte. Akhbar wunderte sich selbst, dass er solche Einzelheiten nach all der Zeit noch so frisch in sich trug, und da die Geräusche und Gerüche aus den Innenhöfen so vieles in ihm auslösten, fragte er sich, was wohl noch alles in ihm verborgen lag. Vielleicht war Heimkehren eben so etwas.
In der Nähe vom Haus seiner Schwester sah Akhbar eine Frau dahineilen, deren breiter Schatten an der Mauer entlangglitt wie ein grauer Fleck, während der ein, zwei Schritte vor ihr gehende Mann in seiner Hast den langen Umhang, den er trug, über den Boden schleifen ließ. Irgendwie stellte Akhbar sich vor, die Frau könnte seine Schwester sein. Auf diesen Gedanken konnte ihn der Gang der Frau bringen. Seine Schwester stürzte nämlich auch immer so dahin, die Füße ganz nah beieinander. Der Mann vor ihr musste ihr Gatte sein. Er sah das Gesicht des Mannes nicht, doch von der Erscheinung her konnte es sein Schwager sein. Ihm kam in den Sinn, den beiden den Namen seiner Schwester hinterherzurufen. Ja, denn auch seine Schwester hatte den linken Fuß immer leicht einwärts gedreht. Er kannte diesen Gang. Diese Ähnlichkeit machte ihn fast sicher, aber dennoch hielt er sich zurück, denn wenn er sich täuschte, konnte dieses Missverständnis ihm ziemlichen Ärger einbringen. Es war vernünftiger, wenn er seine Schritte beschleunigte und versuchte, einen Blick auf das Gesicht des Mannes zu erhaschen. Erst dachte er, die beiden seien auf dem Nachhauseweg, aber dann kam er zu dem Schluss, sie hätten vielmehr eine Nachricht bekommen und müssten ganz schnell irgendwohin. Verheiratete Paare gingen auf der ganzen Welt langsam und mit hängenden Schultern nach Hause. Sie wussten ja, was sie dort erwartete.
Als er sie fast eingeholt hatte, bogen die beiden in eine andere Straße ein, aber in der falschen Richtung. Gleich danach drehte der Mann sich um, als wollte er sich vergewissern, ob da jemand hinter ihm herging. Akhbar und er sahen sich an. Mochte das Gesicht des Mannes auch noch so sehr von dem dichten grauen Bart verborgen sein und dem ausgefransten tabakfarbenen Turban, der ihm zu weit in die Stirn hing, so war doch klar, dass es nicht sein Schwager war. Außerdem ging es zur Straße, in der seine Schwester wohnte, nach links. Er hatte also umsonst gefiebert und sich Hoffnungen gemacht. Das Leben hatte ihm nie geholfen, warum sollte es das jetzt tun? Er ging nach links. Seine Schritte und die der beiden Fremden hallten voneinander weg.
Als er schließlich beim Haus seiner Schwester anlangte, setzte schon die Dämmerung ein.
Die Tür öffnete ihm ein junger Bursche, der älteste Sohn des Hauses. Die Arme hingen ihm am Körper entlang, fast bis zu den Knien, als stünde er in Habachtstellung da. Obwohl er gerade erst einen Anflug von Bartwuchs hatte, sahen seine Augen wie die eines alten, lebenserfahrenen Mannes drein. Es lag nicht die geringste Frische in seinem Blick. Kurz flackerte in Akhbar der Gedanke auf, dieser Junge könne sein Neffe sein, doch selbst im Halbdunkel war noch zu erkennen, dass er sich getäuscht hatte.
„Das müssen unsere Vormieter gewesen sein. Sie sind weggezogen, in den Süden. Sie sind nicht mehr in der Stadt“, sagte der Junge.
„Warum?“ fragte Akhbar, als ob der Junge alles wisse.
„Wahrscheinlich, weil ihr Sohn gestorben ist. Hier im Haus. Da wollten sie hier nicht mehr wohnen. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Ein toter Junge in meinem Alter.“
Akhbar rechnete aus, dass sein Neffe, wenn er noch lebte, ein Heranwachsender im Alter jenes Jungen wäre. Das versetzte ihm einen Stich. Er konnte sich an seinen Neffen als kleines Kind erinnern. Wie er ihn zum ersten Mal auf den Arm genommen hatte. Wie der Junge „Onkel“ zu ihm gesagt hatte und sie miteinander Fußball spielten. Dem Jungen, der ihm nun gegenüberstand, musste sein Neffe seine Seele vermacht haben. Ein so junger Mensch konnte nur deshalb so alt wirken, wenn sich die Seele eines Toten in ihm einnistete, so wie man in ein Haus einzieht.
Akhbar ging von dem Haus fort, das nicht mehr das seiner Schwester war, und ließ von dem, was in ihm drinnen entzwei ging, wieder etwas zurück, während der Junge an der Tür einfach stehenblieb.