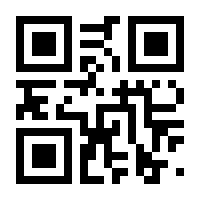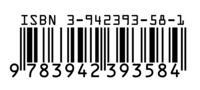×
![Buchcover ISBN 9783942393584]()
Geregelte Außeralltäglichkeit
Deutungs- und Handlungsprobleme von Patienten mit Morbus Parkinson und ihren Partnern bei der Therapie durch Tiefe Hirnstimulation
von Johannes HätscherMorbus Parkinson ist eine human-spezifische Erkrankung. Auf pathophysiologischer Ebene handelt es sich um einen selektiven Prozess der Zellzerstörung, der unaufhaltsam fortschreitend in das zentrale Nervensystem aufsteigt. Mit Erreichen der klinisch-symptomatischen Ebene bricht eine komplexe neurologische Krankheit aus. Ihr dominantes Merkmal ist die Bewegungsstörung, die sich je nach Ausprägung in vier typischen Kardinalsymptomen manifestieren kann: Einem unintendierten Schütteln der Hände in Ruhe oder Bewegung (Tremor), einer Muskelstarre (Rigor), einer Schwerfälligkeit bei der Initiation von Bewegungen (Bradykinese) und schließlich einer erhöhten Fallneigung. Zusätzlich können eine ganze Reihe nicht-motorischer Symptome auftreten. Auf der psychosozialen Ebene, die sich als dritte analytisch differenzieren lässt, hinterlässt die Krankheit ihre Spuren in der Handlungspraxis und Mitwelt der erkrankten Personen. Es beginnt zunächst als ein Problem des Körpers. Mit dem Soziologen Marcel Mauss lässt sich sagen: Sukzessive verlieren die Erkrankten die Kontrolle über ihr erstes und natürlichstes Objekt wie technisches Mittel. Ihre Körper verselbstständigen sich; oder in der Sprache der philosophischen Anthropologie formuliert: Die Parkinsonkranken haben ihn nicht länger (Plessner). Je nach Stärke der einzelnen Kardinalsymptome können Betroffene nicht mehr gut laufen und Artefakte sicher greifen. Über die Bewegungsstörung hinaus geht die Fähigkeit verloren, flüssig zu sprechen sowie über Gestik und Mimik für kommunikatives Handeln zu verfügen. Motorische Fähigkeiten in Arbeit und Privatleben, die sich über Jahre und Jahrzehnte habitualisiert haben, lassen sich nur noch erschwert ausführen. Doch wird es für Erkrankte nicht nur zu einem Problem, gesellschaftliche Rollenerwartungen im Beruf zu erfüllen. Vielmehr lässt sich beobachten, wie sie ein basales humanspezifisches Vermögen verlieren, sich in flexibler und gewünschter Weise Anderen gegenüber darzustellen und damit am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Sie können ihren Körper nicht mehr einsetzen, um sich hinter ganz unterschiedlichen Masken auf der Bühne des gesellschaftlichen Lebens zu verbergen. Für Fremde erscheinen Parkinsonkranke in der Öffentlichkeit nur mehr in Rollen, die diese gar nicht intendiert haben, Rollen nämlich, die für den common sense des Alltagsmenschen a priori Zeichen allgemeinen Handlungs- und Kontrollverlustes sind: Man hält die Betroffenen oft für alkoholabhängig oder geisteskrank.
Auf diese Stigmatisierung reagieren viele Parkinsonkranke mit Gefühlen der Scham. Die Integrität der Person ist in diesem Stadium der Krankheit bedroht. Gegenüber der Allianz psychosozialer und körperlicher Probleme kapitulieren die Patienten schließlich und ziehen sich aus der gesellschaftlichen Sphäre in die häusliche Vergemeinschaftung zurück. Hier trifft das ganze Gewicht der Krankheit nun die Partnerschaft und Familie mit hohen psychosozialen Kosten.
Diese kontinuierliche Abwärtsentwicklung kann durch eine medikamentöse Therapie gebremst werden, die eine erfolgreiche Reduktion der motorischen Kardinalsymptome bewirkt. Doch in einem Drittel aller behandelten Fälle bleibt die medikamentöse Therapie langfristig wirkungslos: Es entstehen in den meisten Fällen eine Reihe nicht mehr kontrollierbarer Nebenwirkungen begleitet von Gefühlen der Ohnmacht und Angst bei den Patienten und ihren sie pflegenden Partnern, die der Krankheit nun schutzlos ausgeliefert sind. Immer mehr dieser Patienten im Spätstadium entscheiden sich für eine neurochirurgische Parkinsontherapie, die Tiefe Hirnstimulation. Hierbei wird eine Elektrode in das Gehirn implantiert. Ein Impulsgeber versorgt sie dauerhaft mit Strom. Aus Sicht der evidenzbasierten Medizin handelt es sich bei der Tiefen Hirnstimulation um eine sehr wirksame Therapieform
der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit. Die Renaissance operativer Verfahren in der Behandlung von Bewegungsstörungen geht allerdings mit klinischen Berichten über psychiatrische und psychosoziale Anpassungsprobleme einher, die bisher noch wenig verstanden sind. So können die Behandlungserfolge sowohl zu neurobiologischen Stimulationseffekten auf affektives und emotionales Erleben als auch zu unterschiedlichen reaktiven Auswirkungen auf das subjektive Erleben und insbesondere die sozialen Interaktionen führen, die sich primär im familialen Setting abspielen. Psychiatrische Probleme treten auf und Suizide werden wiederholt berichtet. Fortwährende Streitigkeiten in der Partnerschaft oder gar deren Auflösung ereignen sich.
Von so genannter neuroethischer wie klinischer Seite mehren sich die Stimmen, die eine Verbesserung der psychosozialen Betreuung der Patienten und ihrer Angehörigen nach der Tiefen Hirnstimulation fordern. Doch um die Betreuung verbessern zu können, muss es zunächst darum gehen, die therapeutische Ausgangssituation in ihren psychosozialen Implikationen methodisch kontrolliert herauszuarbeiten. Dies ist bisher nur in Ansätzen geleistet worden. Hier möchte diese Arbeit einen Beitrag leisten.
Auf diese Stigmatisierung reagieren viele Parkinsonkranke mit Gefühlen der Scham. Die Integrität der Person ist in diesem Stadium der Krankheit bedroht. Gegenüber der Allianz psychosozialer und körperlicher Probleme kapitulieren die Patienten schließlich und ziehen sich aus der gesellschaftlichen Sphäre in die häusliche Vergemeinschaftung zurück. Hier trifft das ganze Gewicht der Krankheit nun die Partnerschaft und Familie mit hohen psychosozialen Kosten.
Diese kontinuierliche Abwärtsentwicklung kann durch eine medikamentöse Therapie gebremst werden, die eine erfolgreiche Reduktion der motorischen Kardinalsymptome bewirkt. Doch in einem Drittel aller behandelten Fälle bleibt die medikamentöse Therapie langfristig wirkungslos: Es entstehen in den meisten Fällen eine Reihe nicht mehr kontrollierbarer Nebenwirkungen begleitet von Gefühlen der Ohnmacht und Angst bei den Patienten und ihren sie pflegenden Partnern, die der Krankheit nun schutzlos ausgeliefert sind. Immer mehr dieser Patienten im Spätstadium entscheiden sich für eine neurochirurgische Parkinsontherapie, die Tiefe Hirnstimulation. Hierbei wird eine Elektrode in das Gehirn implantiert. Ein Impulsgeber versorgt sie dauerhaft mit Strom. Aus Sicht der evidenzbasierten Medizin handelt es sich bei der Tiefen Hirnstimulation um eine sehr wirksame Therapieform
der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit. Die Renaissance operativer Verfahren in der Behandlung von Bewegungsstörungen geht allerdings mit klinischen Berichten über psychiatrische und psychosoziale Anpassungsprobleme einher, die bisher noch wenig verstanden sind. So können die Behandlungserfolge sowohl zu neurobiologischen Stimulationseffekten auf affektives und emotionales Erleben als auch zu unterschiedlichen reaktiven Auswirkungen auf das subjektive Erleben und insbesondere die sozialen Interaktionen führen, die sich primär im familialen Setting abspielen. Psychiatrische Probleme treten auf und Suizide werden wiederholt berichtet. Fortwährende Streitigkeiten in der Partnerschaft oder gar deren Auflösung ereignen sich.
Von so genannter neuroethischer wie klinischer Seite mehren sich die Stimmen, die eine Verbesserung der psychosozialen Betreuung der Patienten und ihrer Angehörigen nach der Tiefen Hirnstimulation fordern. Doch um die Betreuung verbessern zu können, muss es zunächst darum gehen, die therapeutische Ausgangssituation in ihren psychosozialen Implikationen methodisch kontrolliert herauszuarbeiten. Dies ist bisher nur in Ansätzen geleistet worden. Hier möchte diese Arbeit einen Beitrag leisten.