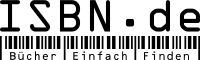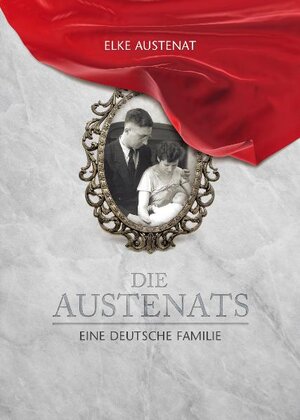
×
![Buchcover ISBN 9783927535565]()
„Skeptisch beim Kauf, aber warum nicht einmal etwas Ungewöhnliches erwerben! Einen Außenseiter in der Medienlandschaft. Erstaunt nach den ersten 50 Seiten über die Offenheit ohne Polemik, fasziniert, in zwei Nächten gelesen, bis zum Ende. Dieses Buch muss in die Bestseller eingereiht werden. Schade, wenn mich keiner erhört“Bernd„Sehr detailliert schildert die Autorin ihre und die ihrer Familie schier unmenschlichen Erlebnisse mit Gefängnispersonal und Stasioffizieren, mit sich in der Isolation, im Zustand der Lähmung, wenn das Dunkel zunimmt und die Verzweiflung steigt. Wie übersteht ein Gefangener wochenlange Isolation, das mörderische Alleinsein, die totale Rechtlosigkeit? Wie geht er mit Verrat durch „Kameraden und oder Familie“ um? Wie übersteht man die perfide Art der Verhöre, die keinem der Insassen eine faire Chance zum Erklären geben? Es ist ein Meisterwerk und liest sich wie ein Thriller. Gleichzeitig ist es ein zeitgeschichtliches Dokument von großer Wichtigkeit, das uns Heutigen eindrucksvoll vor Augen führt, wie hart und schwer Leben sein kann, wie die grundlegende Würde des Menschen mit Füßen getreten werden kann – aber auch, wie daraus enorme Kräfte entwickelt werden können, um zu überleben.“Karin Jessen
„Nie wieder Krieg!“
Die zwei Kinder, Jürgen und Elke, schauten zu ihrer Mutter auf. Sie wussten instinktiv, wenn Mutti mit ernster, eindringlicher Stimme auf sie einredete, dass gleich noch mehr kommen würde. Das mit dem Krieg hatten sie schon oft gehört, dass man wegen des Krieges keinen Vater hat, wegen des Krieges draußen so viel kaputt war, wegen des Krieges alle bei der Arbeit mithelfen müssen, damit es immer sauber und ordentlich ist und es dann auch immer zu Essen gibt. Damit nie wieder ein Krieg kommt, darf man auch nicht lügen, muss immer die Wahrheit sagen und immer hilfsbereit sein, denn weil viel zu viel gelogen und verschwiegen wurde, konnte es erst zum Krieg kommen. Nein, Krieg, was immer dieses schreckliche Wort bedeutete, wollten die zwei Knirpse auf keinen Fall haben. Aber heute lag etwas anderes in der Luft als die gewohnte Ansprache über den Krieg, irgendetwas Tolles.
„Wir ziehen morgen in unsere Wohnung zurück. Fangt an, eure Sachen einzupacken. Oma und Opa kommen morgen helfen. Ihr zwei könnt auf dem Lastkraftwagen in die Cäsarstraße fahren.“
„Cäsarstraße, nie gehört, wo ist das?“ fragte Elke ganz aufgeregt.
„Die Wohnung, in der wir vor dem Krieg gewohnt haben. Auch hier in Karlshorst. Dort haben schon Oma und Opa Austenat, dein Vati und ich, aber auch Jürgen und dein Bruder Lutz bis zum 3. Lebensjahr gewohnt. Unsere sowjetischen Freunde ziehen dort jetzt aus und wir können wieder rein“, war die ruhige Antwort.
In der Stühlinger Straße war es ja auch nicht so schön. Selbst Elke mit ihren fünf Jahren erinnerte sich, dass eines Morgens Mutti ganz schrill geschrien hatte, weil eine dicke fette Ratte auf dem Klodeckel saß und Opa dann mittels vieler kleiner Glasscherben die Rattenlöcher verstopft und Holzstücke darüber genagelt hatte.
Endlich, an einem sonnigen Tag im August 1950 war es dann soweit. Ein großer Lastkraftwagen stand vor der Stühlinger Straße. Die wenigen Habseligkeiten waren schnell aufgeladen. Die Kinder durften hinten auf der Ladefläche, auf den grünen Daunendecken sitzen.
Die Wohnung, im dritten Stock der Cäsarstraße 17 war riesig. Ein über sieben Meter langer Flur, dreieinhalb Zimmer, ein Badezimmer mit Badewanne und großem Ofen, eine große Küche, ein Balkon! Elke tobte durch die leeren Räume. Die helfenden Genossen der Mutter schleppten das wenige Mobiliar nach oben und dann trat plötzlich Stille ein. Elke schlich hinter ihrer Mutter her, die jedes Zimmer inspizierte. Als die Mutter zwischen den beiden Wohnzimmern die Flügeltür öffnete, verfolgte Elke aufmerksam den mit monotoner Stimme vorgebrachten Worten.
„Vor dem Krieg standen hier in den beiden Zimmern Klaviere. Dein Vater und dein Onkel Horst waren wahre Künstler auf dem Klavier. In allen Zimmern lagen Perserteppiche. Aber das alles haben unsere sowjetischen Freunde mitgenommen. Nur die grünen Daunendecken, unser Tafelsilber und die Geige von deinem Vater konnte deine Oma noch rechtzeitig aus der Wohnung holen. Möchtest du die Geige von deinem Vater haben, Elke?“
Elke nickte nur und dachte ‚Vater, was für ein Vater. Den habe ich ja noch nie gesehen. Aber wenn ich erst die Geige habe, vielleicht kommt er dann zurück zu mir, weil er sie wieder haben will.‘
Die Mutter suchte unter dem Haufen der wenigen Habseligkeiten einen braunen Kasten hervor, überreichte ihn mit einem wehmütigen Lächeln ihrer kleinen Tochter und schaute gespannt zu, wie die 5 Jährige sich abmühte, dieser völlig verstimmten Geige irgendwelche Töne zu entlocken.
„Kommt mit ihr zwei, wir gehen uns jetzt bei allen Bewohnern des Hauses vorstellen. Das gehört sich so. Wir fangen am besten unten an“, schallte die Stimme der Mutter durch die Wohnung.
Elke sprintete die drei Etagen runter, freute sich, noch vor Jürgen unten angekommen zu sein und hörte überall den gleichen Spruch ‚herzlich willkommen. Na dann, auf eine gute Nachbarschaft, Frau Austenat. Wir sind auch erst vor wenigen Tagen hier eingezogen. Auf dass wir uns alle hier gut einleben’.
Das war alles spannend und aufregend. Ganz besonders bei Onkel und Tante Rauschi mit ihren vielen Kindern, die in der unmittelbaren Nachbarwohnung wohnten. Hier verbrachten Jürgen und Elke bald jeden Nachmittag. Sie wurden in die Geheimnisse von Skat, Schach und Canaster eingeweiht, lernten unter Anleitung von Onkel Rauschi Mayonnaise selbst herzustellen und wie man eine Zwiebel richtig schneidet, ohne dass einem die Augen tränten oder die Zwiebel auseinanderrutschte. Elke konnte stundenlang bei Onkel Rauschi sitzen und zusehen, wie er feine Spitzen klöppelte, während Jürgen mit den Jungen von „Rauschis“ im Nachbarzimmer mit der riesigen Modelleisenbahn spielte.
Stolz waren die Kinder auf ihre Mutter, die Leiterin des Kinos „Vorwärts“ am Bahnhof Karlshorst war. Was machte es da schon aus, wenn Jürgen und auch die kleine Elke am Wochenende mithelfen mussten, die Wäsche auf dem Dachboden in dem riesigen Bottich zu waschen, beim Essen kochen und Kuchenbacken zu helfen oder die Wohnung sauber zu halten, die Kachelöfen im Winter zu heizen, Kohlen im Keller zu stapeln und die Kohleneimer drei Treppen nach oben zu tragen, Äpfel und Birnen für den Winter aus den Kleingärten zu beschaffen und einzuwecken. Was war das schon? Ein Nichts! Unbeschwert erschien für Elke das Leben. Sie verstand zwar nicht genau, warum mindestens einmal in der Woche der sogenannte „Familienrat“ tagte, saß aber artig mit am Tisch und verstand kaum ein Wort. Da beredeten der 9 Jährige Bruder und die Mutter dann das wöchentliche Haushaltsbudget. Nicht selten wurde ihr nur kurz mitgeteilt, dass es in der nächsten Woche nur Brot und Schmalz zum Tee geben würde. Prima, dachte sie nur, das schmeckt doch lecker. Was wollte man mehr, zumal die Wohnung mit jedem Tag immer schöner wurde. Die ersten Hellerau-Möbel wurden geliefert und die beiden Wohnzimmer bekamen tolle Namen, das ‚gelbe Zimmer‘ und das ‚rote Zimmer‘.
Und dann war wieder eine Familiensitzung.
„Mein neues Arbeitsgebiet ist sehr zeitaufwendig. Ich bin viel unterwegs. Elkes Einschulung steht bevor. Ihr könnt in der Woche nicht Tag und Nacht allein zu Hause bleiben, denn ich muss ganz viel unterwegs sein. Die Partei hat mit mir abgesprochen, dass ihr in ein wundervolles Kinderheim kommt. Jedes Wochenende kommt ihr nach Hause und dann sind wir wieder alle zusammen. Ich weiß, dass ihr das versteht. Ich muss für uns das Geld verdienen, damit wir zu essen haben. Bald seid ihr groß und dann sorgt ihr für mich. Ich liebe euch, wir sind doch eine Familie.“
Die Stimmung war gedrückt. Jürgen und Elke saßen auf der ‚gelben Couch‘, während ihre Mutter Monogramme in die Wäsche stickte – ‚damit ihr eure Sachen nicht verwechselt‘ – war ihre kurze Erklärung. Die Kinder wussten, dass es kein Entrinnen gab. Morgen würden sie in ein Kinderheim der Partei kommen. Ihre Mutter saß zutiefst traurig da, appellierte an ihr Verständnis.
„Wir haben es doch immer gemeinsam geschafft. Ich bin für euch jederzeit da, aber das wisst ihr ja. Das Parteiheim ist eines der besten, glaubt mir. Ihr habt dort ganz viele Spielmöglichkeiten und wundervolle Erzieher.“
Am nächsten Vormittag wurden sie von ihrer Mutter nach Friedrichshagen gebracht. Der erste Abend im Parteiheim war anheimelnd. Die Kinderschar saß im Gras unter einer riesigen Trauerweide am Ufer des Müggelsees. Die sprühenden Funken des prasselnden Lagerfeuers und Klänge einer Gitarre ließ die Kinder bald vergessen, dass sie nicht zu Hause waren. Ein neues Abenteuer war angebrochen. Das Abenteuer wurde noch größer, als das Kinderheim von Berlin-Friedrichshagen nach Berlin-Kaulsdorf verlegt wurde. Um das große, eingezäunte Gelände des Kinderheimes erstreckten sich nach Norden Rieselfelder, umgeben von Apfelbäumen soweit das Auge reichte. Riesige Fundplätze von Munition taten sich auf. Die größeren Kinder klärten die Kleinen auf, wie man eine Gewehrpatrone von einer Revolverpatrone unterscheiden konnte, woran man erkannte, ob sie noch neu oder schon abgefeuert worden war. Ein reger Tauschhandel setzte ein, eine neue gegen fünf leere Patronenhülsen. Die Lust am Munitionstausch war allerdings nur von begrenzter Dauer, da sie nichts mit der Munition anfangen konnten. Sie bekamen einfach nichts Reelles dafür, nur eine andere Patronenhülse, keine Murmeln, kein Katschi, kein Essen. Denn satt waren die Kinder nie. Da war es schon besser, im Frühjahr seine Zeit damit zu verbringen, Sauerampfer zu sammeln – wenn er ganz klein war, schmeckte er richtig toll – oder im Sommer und Herbst auf die Rieselfelder zu gehen und die Äpfel von den Bäumen zu klauen. Nur erwischen lassen durften sich die Kinder nicht, weder von den Erziehern noch von den Wärtern der Rieselfelder. In kleinen Trupps zogen die Kleinen los. Einer stand Schmiere, die anderen kletterten auf die Obstbäume und schmissen die Äpfel runter, die dann in den weiten Hosenbeinen der ausgebeulten Trainingsanzüge versteckt wurden.
„Katja Niederkirchner“ hieß das neue Heim. Das stand nicht nur in großen Buchstaben am Eingang des Kinderwochenheimes, sondern wurde auch bei dem morgendlichen Pionierappell immer wieder durch die Erzieher in Erinnerung gerufen. Die Kinder wurden aufgeklärt, dass dieser Name für das Kinderheim eine Ehre war. Katja Niederkirchner sei eine Widerstandskämpferin gegen Nazi-Deutschland gewesen. Sie wurde 1944 von der SS im Konzentrationslager Ravensbrück erschossen. Katja Niederkirchner kämpfte für die Arbeiterklasse und gegen die Unterdrückung der werktätigen Bevölkerung.
Die Sprösslinge erfuhren bei den Pioniernachmittagen, aber auch in der Schule im Staatsbürgerkundeunterricht, dass der Kampf noch nicht beendet sei und warum ihre Eltern – ‚auch eure Mutter, Jürgen und Elke‘ – so viel arbeiten und alle mithelfen müssen. Unser neues Deutschland, unsere junge Deutsche Demokratische Republik habe viele Feinde, die nicht wollen, dass die Arbeiter einen eigenen Staat aufbauen, die nicht wollen, dass es allen Menschen gut geht. Diese Feinde und auch die meisten Kriegsverbrecher wohnen jetzt in Westdeutschland und versuchen zu verhindern, dass es uns und euch gut geht, wurden sie aufgeklärt. Damit die Feinde der Arbeiterklasse nicht gewinnen, werden wir durch unser großes Bruderland, die Sowjetunion beschützt. Dabei müssen alle, auch ihr als Kinder, aktiv mithelfen.
Wenn beim morgendlichen Pionierappell, zu dem die Kinder ihre schmucken blauen Halstücher trugen, der Ruf „Seid bereit“ erschallte, antwortete die gesamte Kinderschar „Immer bereit“.
Ja, sie wollten mithelfen, damit es besser wird. Die Kinder verschlangen die ihnen vorgelegten Bücher, um zu lernen wie man hilft. Jeder wollte wie Timur sein, stets hilfsbereit und im Kampf gegen die Bösen, Faulen und Verlogenen garantiert siegen. Die Kinder stürzten sich in die ihnen vorgegebenen Ziele, obwohl sie innerlich einen noch erstrebenswerteren Wunsch hatten. Sie wollten weg vom Kinderheim, weg vom morgendlichen Löffel Lebertran, weg von der Milch mit der dicken klebrigen Pelle obenauf, weg von den Schlafsälen mit den vielen Betten, weg vom Strammstehen beim Morgenappell und den Quarantänezeiten an unzähligen Wochenenden, wenn einer von ihnen angeblich eine Kinderkrankheit hatte. Denn nicht selten kam es vor, dass alle Kinder gesund waren und sie trotzdem am Wochenende nicht nach Hause durften. An derartigen Sonnabenden und Sonntagen stand auch ihre Mutter nie draußen auf der Strasse und winkte ihnen hinter dem Zaun zu. Frustriert entluden dann die Kinder ihre Wut und Traurigkeit, indem sie mit Kreide auf jede Stufe bis zu ihrem Schlafsaal malten ‚Erzieher sind doof’. Sie wollten zu Hause bei ihrer Mutter sein und auch in der Woche Oma und Opa oder Tante Jo und Onkel Herbert oder Tante Maria in Berlin-Frohnau besuchen können.
Aber vorerst gab es keine Möglichkeit, dem Kinderheim zu entkommen. Jeden Sonntagabend schwangen sich Jürgen und Elke auf ihre Fahrräder und radelten von der Karlshorster Cäsarstraße über die Treskowallee rechts in den Gregorovius Weg, quer durch die Laubenpiperkolonien und kleinen Einfamilienhäusern bis nach Biesdorf, ab über den Bahndamm, an der Wuhle entlang und über die Rieselfelder bis zur Brodauer Straße, um pünktlich im schloßartigen Kinderwochenheim zu erscheinen. Am Freitag dann die ganze Tour zurück. Aber manchmal kam es auch vor, dass ihre Mutter sagte, dass sie erst Montag ins Heim zurück müssen und Jürgen 40 Pfennig für zwei S-Bahn Fahrkarten gab.
Die Wochentage verliefen immer gleich. Ausnahmen bildeten das nachmittägliche Toben im weitläufigen Areal des Kinderwochenheim mit Rennen, Sackhüpfen, Stangenklettern und Hopse spielen. Es war ein uniformer Ablauf. Frühes Aufstehen, Fahnenappell, Frühstück mit Lebertran fassen, Fußweg zur Grundschule Kaulsdorf, Schulbank mal weniger, mal mehr interessiert drücken, Fußweg zurück, eine Stunde mit Erziehern in kleinen Gruppen, Freizeit, Abendbrot und Nachtruhe.
Die Wochenenden hingegen waren eine einzige Glückseligkeit. Die Kinder durften, solange sie wollten, ausschlafen. Wenn sie gegen Mittag, noch halb verschlafen in die Küche gingen, war der Frühstückstisch stets gedeckt, selbst wenn ihre Mutter am Sonnabend aushäusig war, da sie arbeiten musste. Dann klingelte es an einem derartigen Mutti-Arbeits-Sonnabend, wie Elke annahm, an der Wohnungstür. Als Elke die Eingangstür öffnete, stand ein völlig unbekannter dicklicher Junge zusammen mit ihrer Mutter vor der Tür und sagte im astreinen Sächsisch: