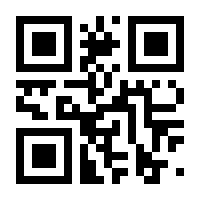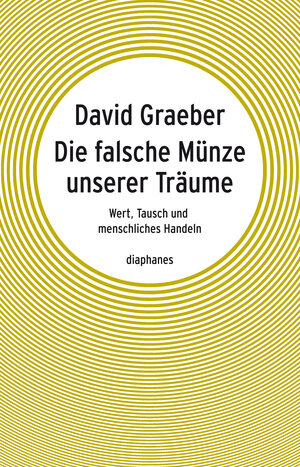
»Endlich kommt einer und entwindet der technologischen Intelligenz der Ökonomie einen existentiellen Begriff menschlichen Daseins.« Frank Schirrmacher, FAZ
»Gegen Soziologie, Ökonomie und Linguistik profiliert Graeber eine ethnologische, handlungstheoretische Perspektive, die als Wert auffasst, was Handlungen für die Akteure bedeutsam macht.« Thomas Macho, NZZ
»Das Buch, zunächst als Untersuchung über den Begriff des ›Werts‹ in der Ethnologie geplant, wuchs sich zu einem Parforceritt durch die eigene Disziplin mit Blick auf die Sozialwissenschaften insgesamt aus - nicht weniger als einen Paradigmenwechsel scheint Graeber mit ihm anzuvisieren.« Michael Adrian, FAZ
»Graebers Studie liefert wichtige Einblicke in die Vorgehensweise der anthropologischen Kulturkritik. Das Buch zeigt vor allem, dass Occupy kein eruptives Sit-In enttäuschter amerikanischer Hausbesitzer und linker Fantasten war, sondern vielleicht die erste politische Bewegung aus dem Geiste der Anthropologie.« Felix Stephan, ZEIT online
»Graeber plädiert für eine über ökonomische Betrachtungen hinausweisende Sozialtheorie, die das politische und gesellschaftliche Engagement von Individuen und Gruppen in Rechnung stellt und befördert.« Südwest Presse
»Ein ethnologisch inspirierter Angriff auf die Dominanz der Wirtschaftswissenschaften« Sebastian Triesch, Der Freitag
»ein ethnologisch-historischer Streifzug durch zahlreiche Gesellschaften und theoretische Reflexionen über die Theorien von Marcel Mausse bis zu Marx und Lenin« Wolfgang Hippe, Kulturpolitische Mitteilungen
Die falsche Münze unserer Träume
Wert, Tausch und menschliches Handeln
von David Graeber, aus dem Englischen übersetzt von Andrea Stumpf, Sven Koch, Michaela Grabinger und Gabriele Werbeck
David Graeber, Vordenker der Occupy-Bewegung und Autor von »Schulden. Die ersten 5000 Jahre«, gilt als »Mann der Stunde« (FAZ). Seine Bücher verbinden politisches Engagement, Gesellschaftstheorie und ethnologische Perspektive auf höchst anregende Weise. Mit »Die falsche Münze unserer Träume« liefert Graeber das Gegenstück zu »Schulden«, indem er den »Wert« ins Zentrum menschlichen Handelns stellt. Ob in der Anhäufung von Reichtum oder in dessen bewusster Zerstörung, ob altruistisch gewendet, ob als Geschenk oder im Gabentausch: um das, was Wert ausmacht, bilden sich Gesellschaften und Machtbeziehungen aus.
Graeber benennt damit das Kernproblem gegenwärtiger Sozialtheorien, die im Angesicht des Neoliberalismus und der alles dominierenden Marktideologie Schiffbruch erlitten haben. Mit zwei so unterschiedlichen Autoren wie Karl Marx und Marcel Mauss zeigt er, dass Projekte des Kulturvergleichs notwendig revolutionäre Vorhaben sind – und dass es ihm um nichts Geringeres geht, als die Grundlagen unserer Denkweise auf den Kopf zu stellen.