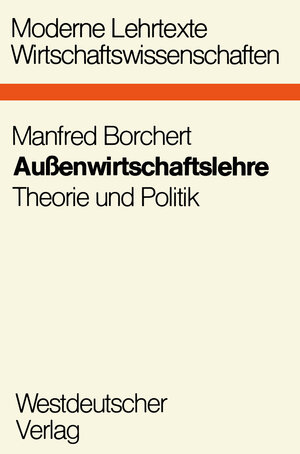
×
![Buchcover ISBN 9783531113609]()
Inhaltsverzeichnis
- I. Teil: Theorie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
- 1. Grundlegung.
- 1.1. Die Außenhandelsverflechtung.
- 1.2. Die Zahlungsbilanz.
- 1.2.1. Die Konzeption der Zahlungsbilanz.
- 1.2.2. Die Struktur der Zahlungsbilanz.
- 1.2.3. Zahlungsbilanzkonzepte.
- 1.2.4. Das Zahlungsbilanz-Gleichgewicht.
- 1.3. Die Fragestellung der Außenwirtschaftstheorie.
- Literatur zum 1. Kapitel.
- 2. Die reine Theorie.
- 2.1. Methodologische Grundlagen.
- 2.2. Das ursprüngliche Theorem der komparativen Kosten.
- 2.2.1. Die Darstellung Ricardos.
- 2.2.2. Das Außenhandelsgleichgewicht.
- 2.2.2.1. Der Bedingungskatalog.
- 2.2.2.2. Ableitung der Transformationskurve.
- 2.2.2.3. Die Einbeziehung der Nachfrage.
- 2.2.2.4. Die Tauschkurven.
- 2.2.2.5. Die Problematik einer Verwendung gesellschaftlicher Indifferenzkurven.
- 2.2.3. Ergebnis.
- Anhang I: Die Bestimmung des Preisverhältnisses im Außenhandel.
- 2.3. Das Heckscher-Ohlin-Theorem.
- 2.3.1. Die Fragestellung.
- 2.3.2. Die Produktionsbedingungen.
- 2.3.3. Die Nachfragebedingungen.
- 2.3.4. Die Gleichgewichtsbedingungen auf den Faktormärkten.
- 2.3.5. Die Gleichgewichtsbedingungen auf den Gütermärkten.
- 2.3.6. Ein Beispiel.
- 2.4.* Konventionelle Darstellung des Heckscher-Ohlin-Theorems.
- 2.4.1. Die Produktionsbedingungen.
- 2.4.2. Die optimale Produktion im Inland.
- 2.4.3. Variationen der Transformationskurve.
- 2.4.4. Die optimale Produktion im Außenhandel.
- 2.4.5. Implikationen des Heckscher-Ohlin-Theorems.
- Anhang II: Definition der Faktorintensität.
- 2.5.* Die Wirkung der Güternachfrage auf Richtung und Ausmaß des Außenhandels.
- 2.6. Der Güterpreis-und Faktorpreisausgleich im internationalen Handel.
- 2.6.1. Der internationale Güterpreisausgleich.
- 2.6.2. Formulierung des internationalen Faktorpreisausgleichs — Das Lerner-Samuelson-Theorem.
- 2.6.3.* Graphische Instrumente des Faktorpreisausgleichs-Theorems.
- 2.6.4. Allgemeine Darstellung des Faktorpreisausgleichs.
- 2.6.4.1. Der Faktorpreisausgleich bei identischen Substitutionselastizitäten — Das Rybczynski-Theorem.
- 2.6.4.2. Die Auswirkung ungleicher Substitutionselastizitäten.
- 2.6.5. Ergebnis.
- Anhang III: Die Substitutionselastizität.
- 2.7. Empirische Untersuchungen zur reinen Außenhandelstheorie — Das Leontief-Paradoxon.
- 2.7.1. Methode und Ergebnis der Untersuchung Leontiefs.
- 2.7.2. Die Vergleichbarkeit des Heckscher-Ohlin-Theorems mit dem Leontief-Paradoxon.
- 2.7.3. Fiktionen gleicher Produktionsfunktionen.
- 2.7.3.1. Die international divergierende Qualität des Faktors Arbeit.
- 2.7.3.2. Auswirkungen der Abstraktion vom Faktor Natur in der Leontief-Analyse.
- 2.7.4. Produktionsfunktionen mit international divergierenden Faktorintensitäten im Außenhandelsgleichgewicht bei identischen Gütern.
- 2.7.4.1. Die Annahme von CES-Produktionsfunktionen.
- 2.7.4.2. Die Vereinbarkeit von CES-Produktionsfunktionen mit dem Theorem der komparativen Kosten.
- 2.7.4.3. Die Vereinbarkeit von CES-Produktionsfunktionen mit der Leontief-Analyse.
- 2.7.5.* Konventionelle Darstellung der CES-Produktionsfunktion im Außenhandel.
- 2.7.5.1. Auswirkungen der CES-Produktionsfunktion.
- 2.7.5.2. CES-Produktionsfunktion und Außenhandel.
- 2.7.5.3. Implikationen der CES-Produktionsfunktion.
- 2.7.6. Bestimmungsgründe des Außenhandels in einer evolutorischen Wirtschaft.
- 2.7.6.1. Die Wirkung des technischen Fortschritts im Inland.
- 2.7.6.2. Die Wirkung des technischen Fortschritts im Ausland.
- 2.7.6.3. Technischer Fortschritt und Faktorausstattung.
- 2.7.6.4. Technischer Fortschritt und die Leontief-Analyse.
- Anhang IV: Die empirische Ermittlung der direkten Kapitalkoeffizienten.
- Anhang V: Die indirekt zur Produktion erforderlichen Einsatzmengen an Kapital und Arbeit.
- Anhang VI: Die Transformationskurve bei limitationalen Produktionsfaktoren.
- 2.8. Theoretische Erweiterung des Theorems der komparativen Kosten.
- 2.8.1. Was leistet die konventionelle Außenhandelstheorie?.
- 2.8.2. Märkte und Außenhandel im Raum.
- 2.8.3. Wettbewerbsintensität bei interregionalem Handel.
- Literatur zum 2. Kapitel.
- 3. Die monetäre Theorie.
- 3.1. Der Markt für Devisen.
- 3.1.1. Bestimmungskomponenten von Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt.
- 3.1.1.1. Devisenangebot und Devisennachfrage bei gegebenen Weltmarktpreisen der Güter.
- 3.1.1.1.1. Die Devisennachfrage.
- 3.1.1.1.2. Das Devisenangebot.
- 3.1.1.1.3. Der gleichgewichtige Wechselkurs.
- 3.1.1.2. Devisenangebot und Devisennachfrage bei beweglichen Weltmarktpreisen der Güter.
- 3.1.1.2.1. Die Devisennachfrage.
- 3.1.1.2.2. Das Devisenangebot.
- 3.1.1.2.3. Der gleichgewichtige Wechselkurs.
- 3.1.2. Der Devisenmarkt bei festen Wechselkursen.
- 3.1.2.1. Wechselkurse bei Goldparität.
- 3.1.2.2. Fester Wechselkurs durch Vereinbarung.
- 3.1.2.2.1. Fester Wechselkurs und Zahlungsbilanz.
- 3.1.2.2.2. Bedingungen für eine,, normale“ Reaktion der Zahlungsbilanz.
- Anhang VII: Die Marshall-Lerner-Bedingung.
- Anhang VIII: Die Robinson-Bedingung.
- 3.2. Der Einkommens- und Preismechanismus.
- 3.2.1. Außenhandel und Volkseinkommen.
- 3.2.1.1. Die Fragestellung.
- 3.2.1.2. Der kreislauftheoretische Aspekt des Außenhandels.
- 3.2.1.2.1. Sparen, Investieren und Außenhandel.
- 3.2.1.2.2. Die Importneigung.
- 3.2.1.2.3. Graphische Darstellung.
- 3.2.1.3. Der Exportmultiplikator.
- 3.2.1.3.1. Der einfache Exportmultiplikator.
- 3.2.1.3.2. Ein allgemeines Gleichgewicht.
- 3.2.1.3.3. Der Exportmultiplikator im Zwei-Länder-Fall.
- 3.2.1.4. Der Kapitaltransfer.
- 3.2.2. Preiswirkungen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
- 3.2.2.1. Der Preismeehanismus.
- 3.2.2.2. Der direkte internationale Preiszusammenhang.
- 3.2.2.3. Die Terms of Trade.
- 3.2.2.4. Der,, monetäre“ Ansatz des Zahlungsbilanzausglcichs.
- 3.2.2.5. Preiswirkungen bei flexiblen Wechselkursen.
- Anhang IX: Der Exportmultiplikator im Zwei-Länder-Fall unter Einbeziehung der Konsumfunktion.
- Anhang X: Elastizitätsbedingungen für eine Verbesserung der Terms of Trade.
- Literatur zum 3. Kapitel.
- II. Teil: Politik der internationale Wirtschaftsbeziehungen.
- Vorbemerkung.
- 4. Außenwirtschaftspolitik.
- 4.1. Außenhandelspolitik.
- 4.1.1. Die Zollpolitik.
- 4.1.1.1. Zollarten.
- 4.1.1.2. Die Wirkung des Zolls auf den Außenhandel.
- 4.1.1.3. Wer trägt den Zoll?.
- 4.1.1.4. Zahlungsbilanzwirkungen.
- 4.1.1.5. Das Terms-of-Trade-Argument.
- 4.1.2. Politik der Mengenbeschränkungen.
- 4.1.2.1. Wirkungen der Kontingentierung.
- 4.1.2.2. Die Verteilung der Kontingentrente.
- 4.1.2.3. Internationale Mengenregulierungen.
- 4.1.3. Sonstige Instrumente der Außenhandelspolitik.
- 4.1.3.1. Handelsvertragspolitik.
- 4.1.3.2. Zahlungspolitik.
- 4.1.4. Die Handelspolitik mit und von zentralgeleiteten Volkswirtschaften.
- 4.1.4.1. Der Außenhandel zwischen zentralgeleiteten Volkswirtschaften.
- 4.1.4.1.1. Methodische Grundlagen des Außenhandels zentralgeleiteter Volkswirtschaften.
- 4.1.4.1.2. Die Außenhandelsverflechtung im Comecon.
- 4.1.4.2. Der Außenhandel zwischen Zentralverwaltungswirt- schaften und Marktwirtschaften.
- 4.1.4.2.1. Der Außenhandelsplan zentralgeleiteter Volkswirtschaften.
- 4.1.4.2.2. Außenhandelspolitik beim Handel zwischen Zentralver waltungswirtschaften und Marktwirtschaften.
- 4.1.4.2.3. Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR.
- Anhang XI: Der optimale Zollsatz.
- 4.2. Monetäre Außenwirtschaftspolitik.
- 4.2.1. Internationale Kapitalströme.
- 4.2.1.1. Begriffliches.
- 4.2.1.2. Der langfristige Kapitalverkehr.
- 4.2.1.2.1. Ursachen des langfristigen Kapitalverkehrs.
- 4.2.1.2.2. Wirkungen und Einflußmöglichkeiten.
- 4.2.1.3. Der kurfristige internationale Kapitalverkehr.
- 4.2.1.3.1. Der traditionelle Geldtransfer.
- 4.2.1.3.2. Der Eurogeldmarkt.
- 4.2.2. Währungspolitik.
- 4.2.2.1. Wechselkurspolitik.
- 4.2.2.1.1. Feste und bewegliche Wechselkurse.
- 4.2.2.1.2. Devisenmarktpolitik.
- 4.2.2.2. Devisenbewirtschaftung.
- Literatur zum 4. Kapitel.
- 5. Die internationale Währungsordnung.
- 5.1. Historischer Überblick.
- 5.1.1. Die Währungsordnung vor dem 1. Weltkrieg.
- 5.1.2. Die Währungsordnung nach dem 1. Weltkrieg.
- 5.2. Die internationale Währungsordnung nach dem 2. Weltkrieg.
- 5.2.1. Das Währungssystem von Bretton Woods.
- 5.2.2. Probleme der Währungsordnung von Bretton Woods.
- 5.2.2.1. Ausgangslage.
- 5.2.2.2. Das Reservewährungssystem.
- 5.2.2.3. Das Leitwährungssystem.
- 5.2.2.4. Die Situation im Leitwährungsland.
- 5.2.2.5. Auswirkungen auf andere Länder.
- 5.3. Die Auflösung des Systems von Bretton Woods.
- 5.3.1. Die Ausgangslage.
- 5.3.1.1. Die binnenwirtschaftliche Lage der USA.
- 5.3.1.2. Die außenwirtschaftliche Lage der USA.
- 5.3.2. Die Suche nach einer neuen Währungsordnung.
- 5.3.2.1. Einführung flexibler Wechselkurse.
- 5.3.2.2. Goldpreiserhöhung.
- 5.3.2.3. Ein System mit zwei Leitwährungen.
- 5.3.2.4. Eine neue Leitwährung EWG-Dollar.
- 5.3.2.5. Weitere Reformpläne.
- 5.3.2.6. Die Alternative.
- 5.3.2.7. Erfahrungen der Bundesrepublik Deutschland mit flexiblen Wechselkursen.
- 5.4. Die neue Währungsordnung.
- 5.4.1 Die Bedeutung der Sonderziehungsrechte.
- 5.4.1.1. Die Beschaffenheit der Sonderziehungsrechte.
- 5.4.1.2. Der Charakter der Sonderziehungsrechte.
- 5.4.1.3. Die internationale Liquidität.
- 5.4.1.4. Der Link.
- 5.4.2. Die Reform der internationalen Währungsordnung.
- 5.4.2.1. Entwürfe zur Reformierung.
- 5.4.2.2. Bisherige Vereinbarungen.
- Literatur zum 5. Kapitel.
- 6. Integrations- und Entwicklungspolitik.
- 6.1. Integrationspolitik.
- 6.1.1. Stufen der Integration.
- 6.1.2. Wirkungen der Zollunion.
- 6.1.2.1. Die Ausgangslage.
- 6.1.2.2. Allgemeiner Zollschutz und Zollunion.
- 6.1.2.3. Der Umfang der handelsschaffenden und handelsablenkenden Effekte.
- 6.1.3. Empirische Anhaltspunkte über Integrationswirkungen.
- 6.1.3.1. Die Wirkung einer Handelsliberalisierung durch Integration auf das Handelsvolumen.
- 6.1.3.2. Folgerungen für eine Handelsliberalisierung durch Integration.
- Anhang XII: Die Ermittlung der Gesamtangebotsfunktion im Außenhandel.
- 6.2. Entwicklungspolitik.
- 6.2.1. Die Probleme unterentwickelter Länder.
- 6.2.1.1. Charakterisierung unterentwickelter Länder.
- 6.2.1.2. Entwicklungsstrategien.
- 6.2.2. Einige Folgerungen aus der Integration für die Entwicklungsländer.
- 6.3. Die wichtigsten wirtschaftlichen Zusammenschlüsse der Welt.
- 6.3.1. Internationale Kooperationen als Vorstadien der Integration.
- 6.3.2. Freihandelszonen.
- 6.3.3. Zollunionen.
- 6.3.4. Gemeinsame Märkte.
- 6.3.5. Wirtschafts-und Währungsunion.
- Literatur zum 6. Kapitel.
- Personenregister.




