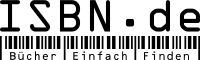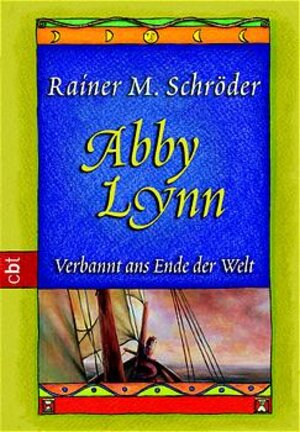
×
![Buchcover ISBN 9783570300985]()
Abby Lynn - Verbannt ans Ende der Welt
von Rainer M. SchröderAuszug
ENGLANDFEBRUAR-JUNI 1804
Ein eisiger Windstoß blies durch die Fensterfugen der Dachkammer. Die Kerze auf dem Küchentisch flackerte, beugte sich unter dem frostigen Hauch des Februarmorgens und erlosch. Ein dünner Rauchfaden kräuselte vom kohleschwarzen Docht, wurde von der Zugluft erfasst und verwirbelt, bevor er noch die niedrige Decke der armseligen Dachgeschosswohnung erreicht hatte. Das dunkelblonde Mädchen mit dem blassen Gesicht saß gedankenverloren am Küchentisch und beobachtete, wie das flüssige Wachs um den Docht schnell erkaltete und sich auf der Oberfläche eine erste dünne Schicht bildete. Wie die Haut, die auf heißer Milch schwimmt. Heiße Milch! Abigail Lynn versuchte sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal heiße Milch getrunken hatte. Vergeblich. Es lag schon zu lange zurück. Viele Jahre. Seit ihr Vater auf der Fahrt von Indien zurück nach England mit dem Schiff untergegangen war. Er hatte sein ganzes Vermögen in die Schiffsladung gesteckt. Bis auf den letzten Penny, wie ihre Mutter immer wieder mit Verbitterung betonte, wenn sie von den Zeiten erzählte, als sie noch zu den angesehenen Kaufmannsfamilien in London gehört, in einem eigenen Haus gewohnt und mehrere Dienstboten gehabt hatten. Nur ganz schwach konnte Abigail sich noch an das Haus mit den silbernen Kerzenleuchtern, den Teppichen und Bildern und dem herrschaftlichen Treppenaufgang erinnern. Gerade sechs war sie damals gewesen. Und acht Jahre in drückender Armut waren eine lange Zeit, in der Erinnerungen an eine längst vergangene, glückliche Kindheit ihre scharfen Konturen verlieren wie Zeichnungen auf Papier, die zu lange der Sonne ausgesetzt sind und immer mehr verblassen. Abigail wünschte, sie könnte die Kerze wieder anzünden. Die kleine Flamme war das einzig Wärmende und Trostspendende an diesem kalten Februarmorgen gewesen. Doch es war schon hell über London, und die Kerze jetzt noch einmal in Brand zu setzen, wäre eine unverzeihliche Verschwendung von Wachs und Zündhölzern gewesen. Ein anhaltender, trockener Husten aus der hinteren Ecke der Dachkammer riss Abigail aus ihren Gedanken. Ihre Mutter war aufgewacht. „Abby?“ Abigail erhob sich vom Küchentisch und ging schnell zur Bettstelle hinüber. „Hast du Durst? Soll ich dir etwas Tee bringen?“, fragte sie besorgt und wünschte, sie hätten wirklich ein wenig frischen Tee. Das Gebräu, das sie seit über einer Woche tranken, war der ungezählte Aufguss einer einzigen Hand voll Teeblätter. Sie waren schon so ausgelaugt, dass sie kaum noch das Wasser färbten. Margaret Lynn nickte und Abby holte eine Blechtasse voll Tee. Ihre Mutter trank gierig und sank dann in die Kissen zurück. Die Krankheit, die sie nun schon gute sechs Wochen ans Bett fesselte, hatte deutliche Spuren hinterlassen. Abby kannte ihre Mutter nur als hagere Frau mit schmalen Lippen und einem verkniffenen Gesichtsausdruck, der ihre unversöhnliche Verbitterung über den tiefen Fall widerspiegelte. Doch nun war sie regelrecht abgemagert. Ihr Gesicht war eingefallen, die fahle Haut schien sich über den spitz hervortretenden Wangenknochen bis zum Zerreißen zu spannen, und in ihren Augen, die in tiefen Höhlen lagen, brannte das Fieber. „In der Schüssel ist noch etwas kalte Grütze“, sagte Abby und hielt die Hand ihrer Mutter. „Eine halbe Tasse voll.“ „Brot!. Du musst Brot kaufen, Abby!“ „Es ist längst kein Geld mehr da.“ Ihre Mutter schüttelte den Kopf. „In der Dose hinter der alten Kanne ist noch Geld. Nimm es und kauf einen Laib Brot!“ Ihre Stimme war schwach. Abby zögerte. „In der Dose müssen ein paar Sixpence und Pennys liegen. Das Geld habe ich für Notzeiten weggelegt“, stieß Margaret Lynn unter schnellem, flachem Atem hervor. „Nimm es und kauf ein. In ein paar Tagen wird es mir schon wieder besser gehen und dann kann ich auch wieder arbeiten. Warum gehst du nicht?“ Abby brachte es nicht über sich, ihr zu sagen, dass nicht ein einziger Penny mehr in der Dose lag und sie schon längst anschreiben ließ. „Ja, ich werde das Geld aus der Dose nehmen und einen Laib Brot kaufen“, sagte sie und wandte sich schnell ab, weil sie Angst hatte, ihr Blick könnte verraten, wie hoffnungslos ihre Lage war. Abby wickelte sich einen Schal um, hängte sich ihren abgewetzten Umhang um die Schultern und nahm den binsengeflochtenen Korb vom Wandhaken. „Ich bin gleich wieder zurück, Mutter!“, rief sie von der Tür über die Schulter zurück. Sie konnte nicht ahnen, dass sie ihre Mutter nie wieder sehen würde.
Es war ein kalter Morgen und der Himmel über London war von seltener Klarheit. Die unzähligen roten und braunen Schornsteine, aus denen blauer Rauch in dicken Wolken quoll, hoben sich scharf von dem wolkenlosen Himmel ab. Die vielen Rauchfahnen erinnerten Abby schmerzlich daran, dass sie keine Kohle und kein Brennholz mehr hatten. Sie fröstelte und zog den Umhang enger. Es fehlte ihnen an so vielem. Es war Markttag in Haymarket und so herrschte an diesem frühen Morgen schon ein geschäftiges Leben und Treiben in den Straßen und Gassen. Kutschen, Wagen und Karren machten sich die Fahrbahn streitig. Das Schnauben nervöser Zugpferde, aus deren Nüstern der Atem wie Dampf kam, vermischte sich mit den Flüchen der Kutscher und dem scharfen Knall ihrer Peitschen. Ohne Eile ging Abby an den Geschäften und Läden entlang, die die Straße zu beiden Seiten säumten. Sie sog die vielfältigen, bunten Eindrücke wie ein trockener Schwamm in sich auf. Wie sie das pulsierende Leben um sie herum genoss! Es gab ihr für eine kurze Zeit die Möglichkeit, die eigenen bedrückenden Sorgen zu vergessen. Die Luft war erfüllt von einem Gewirr aus vielen Stimmen, Geräuschen und Gerüchen. Schon jetzt drang aus den Tavernen das Lachen und Grölen jener Zecher, denen der Tag für ein Glas Branntwein, Port oder Ale nie zu jung oder zu alt war. Wortreich priesen Straßenhändler mit Bauchläden ihre zweifelhaften Gesundheitswässerchen und Tinkturen an, und Dienstboten, von ihrer Herrschaft zum Einkauf geschickt, standen für ein paar Minuten in kleinen Gruppen zusammen und tauschten mit lachenden, geröteten Gesichtern den neusten Klatsch aus. Doch beim Anblick der Straßenmädchen und der zerlumpten Bettler wurde Abby an ihre eigene, trostlose Situation erinnert. Das Hungergefühl stellte sich wieder ein. Und als sie die ersten Marktstände erreichte, krampfte sich ihr der Magen zusammen.