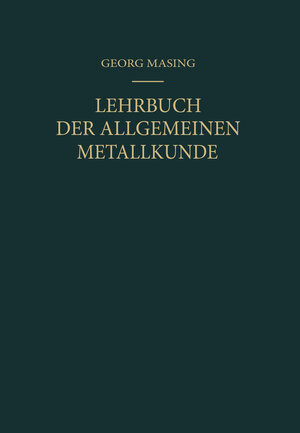
×
![Buchcover ISBN 9783642529948]()
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- 1. Bedeutung und Eigenart der Metallkunde.
- 2. Grundlegende Tatsachen und Definitionen.
- II. Einige allgemeine Grundlagen.
- A. Einige physikalisch-chemische Beziehungen.
- 1. Die isotherme Ausdehnungsarbeit eines idealen Gases.
- 2. Das Massenwirkungsgesetz.
- 3. Die Aktivierungsenergie.
- 4. Die Formel von W. Nernst für das elektrochemische Elektrodenpotential.
- B. Einige krystallographische Grundlagen.
- 1. Raumgitter, Elementarzelle.
- 2. Indizierung von Ebenen und Richtungen.
- 3. Die Krystallsysteme.
- 4. Das kubische System.
- 5. Angabe der Atombesetzung in einer Struktur.
- 6. Das hexagonale System dichtester Kugelpackung.
- 7. Die Beziehung des hexagonalen Gitters dichtester Packung zum kubischen flächenzentrierten Gitter.
- C. Röntgenanalyse in der Metallkunde.
- 1. Allgemeines und die Braggsche Beziehung.
- 2. Die Verfahren von M. v. Laue, von W. H. und W. L. Bragg und von P. Debye und P. Scherrer.
- 3. Netzebenenabstand und Millersche Indizes.
- 4. Interferenzen und Auslöschungen im kubischen Raumgitter.
- 5. Dichte und Zahl der Atome in der Elementarzelle.
- 6. Intensitätsanalyse komplizierterer Strukturen.
- 7. Bestimmungsstücke der Intensität der Röntgeninterferenzen.
- 8. Anwendung der Röntgenstrahlen in der Metallkunde.
- a) Untersuchung von Zustandsdiagrammen.
- b) Sondererscheinungen im Röntgendiagramm. Texturen.
- c) Bemerkung über die Grobstrukturuntersuchung.
- D. Thermodynamische Grundlagen.
- 1. Einige thermodynamische Bezeichnungen und Definitionen.
- 2. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik.
- 3. Kreisprozeß und adiabatischer Prozeß.
- 4. Umkehrbare und nicht umkehrbare Prozesse.
- 5. Der Carnotsche Kreisprozeß und die Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik.
- 6. Übertragung auf beliebige Prozesse und Ableitung des Entropie-Begriffes.
- 7. Das thermodynamische Gleichgewicht.
- 8. Berechnung von Zustandsänderungen bei irreversiblen Prozessen.
- 9. Die Gleichung von Clausius und Clapeyron.
- III. Konstitutionslehre (Heterogene Gleichgewichte).
- A. Einstoffsysteme.
- 1. Zustandsgleichung, Zustandsdiagramm.
- 2. Phasenregel im Einstoffsystem.
- 3. Gestalt des Zustandsdiagrammes.
- 4. Allotrope Modifikationen.
- 5. Diagramm für konstanten Druck.
- 6. Schmelz-, Siede- und Umwandlungstemperaturen der reinen Metalle.
- B. Zweistoffsysteme.
- 1. Phasenregel bei Zweistoffsystemen.
- 2. Das Zustandsdiagramm.
- a) Allgemeine.
- b) Die Hebelbeziehung.
- c) Wahl der Konzentrations-Variablen.
- d) Gewichtsprozente und Atomprozente.
- 3. Formen des Zustandsdiagrammes.
- a) Übersicht.
- b) Mechanisches Gemenge der Bestandteile.
- c) Die Bestandteile bilden eine intermediäre Krystallart (Verbindung) mit einem Schmelzpunkts-Maximum.
- d) Die Bestandteile bilden eine intermediäre Krystallart, die unter Zersetzung schmilzt (inkongruent schmelzende Verbindung).
- e) Die Bestandteile bilden in allen Verhältnissen Mischkrystalle.
- f) Die Bestandteile bilden miteinander begrenzte Reihen von Mischkrystallen mit einem Eutektikum.
- g) Die Bestandteile bilden begrenzte Mischkrystallreihen mit einem Peritektikum.
- h) Die Bestandteile bilden im flüssigen Zustand eine Mischungslücke und im festen Zustand ein mechanisches Gemenge.
- 4. Mengen der Krystalle und der Schmelze im Verlaufe der Erstarrung.
- 5. Ableitung der binären Zustandsdiagramme mit Hilfe des thermodynamischen Potentials.
- a) Das chemische Potential und das ?-X-Diagramm.
- b) Das Potential eines mchanischen Gemenges und einer ununterbrochenen Reihe von Schmelzen oder Mischkrystallen.
- c) Gang der Potentiale im Erstarrungsintervall.
- d) Entstehung einer Mischungslücke im flüssigen Zustand.
- e) Erstarrung eines mechanischen Gemenges der Bestandteile.
- f) Erstarrung einer Verbindung mit einem Temperaturmaximum.
- g) Allgemeine Ableitung der isothermen Tangente im Temperaturmaximum. Schmelzkurve beim eutektischen Punkt.
- h) Erstarrung einer Verbindung ohne Temperaturmaximum.
- i) Erstarrung einer ununterbrochenen Reihe von Mischkrystallen.
- k) Zusammenfassende Bemerkung.
- C. Phasenregel.
- 1. Ableitung der Phasenregel.
- 2. Unabhängige Bestandteile.
- 3. Sonderfälle.
- D. Dreistoff-Systeme.
- 1. Darstellung.
- a) Das Konzentrationsdreieck.
- c) Schwerpunktsbeziehung für drei Phasen.
- d) Vierphasengleichgewichte.
- 2. Erstarrungstypen.
- a) Die Bestandteile bilden im Krystallzustand ein mechanisches Gemenge.
- ?) Erstarrungsgang.
- ?) Zustandsflächen und Zustandsräume.
- ?) Projektionen und Schnitte.
- b) Mischkrystalle in allen Verhältnissen.
- c) Beschränkte Mischkrystallbildung bei allen Bestandteilen. Ternäres Eutektikum.
- d) Eine binäre Verbindung mit offenem Maximum. Keine Mischkrystallbildung.
- e) Lückenlose Mischkrystallbildung in einem Randsystem, Eutektika in den beiden anderen.
- f) Abschließende Bemerkung.
- E. Systeme mit vier und mehr Bestandteilen.
- 1. Vorbemerkung.
- 2. Das Konzenträtionstetraeder.
- 3. Erstarrung eines mechanischen Gemenges der vier Bestandteile. Isotherme Darstellungen.
- 4. Erstarrung eines mechanischen Gemenges der vier Bestandteile. „Polythermisches Modell“.
- F. Bemerkungen über die Methoden der Konstitutionsforschung.
- 1. Die mikroskopische und die Röntgenmethode.
- 2. Die thermische Analyse.
- 3. Schwierigkeiten der Gleichgewichtseinstellung.
- G. Zur Energetik binärer Systeme.
- 2. Eine homogene Phase.
- a) Einige grundlegende Beziehungen.
- b) Das thermodynamische und das chemische Potential.
- c) Aktivität und Aktivitätskoeffizient.
- d) Einige Bestimmungsmethoden der thermodynamischen Größen.
- e) Vereinfachte Annahmen über den atomistischen Aufbau der Phasen.
- ?) Ideale und reguläre Mischungen.
- ?) Mischkrystallphasen mit geringem Fehlordnungsgrad.
- f) Experimentelle Ergebnisse.
- 3. Zweiphasengleichgewichte.
- a) Allgemeine Behandlung von Gleichgewichtskurven.
- b) Grenzfall geringer Konzentrationen.
- c) Entmischungskurve mit kritischem Punkt.
- IV. Der atomistische Aufbau des metallischen Krystalles.
- A. Intermetallische Krystallarten. Reine Metalle.
- 1. Allgemeines.
- a) Definition einer intermetallischen Verbindung.
- b) Einige Beispiele von intermetallischen Verbindungen.
- 2. Systematische Erörterung.
- a) Die Bindungstypen in Krystallen.
- ?) Das Ionengitter.
- ?) Homöopolare Bindung.
- ?) Metallische Bindung.
- ?) Übergangsfälle. Allgemeines über metallische Strukturen.
- b) Eine all em ine thermödynamische Betrachtung.
- 3. Einzelne Strukturtypen.
- a) Alkalimetalle. Raelmetalle.
- b) Die Hume-Rothery-Phasen.
- c) Laves-Phasen.
- ?) Struktur der Verbindung MgCu2.
- ?) Struktur der Verbindung MgZn2.
- ?) Existenzbedingungen der Laves-Phasen.
- d) NiAs-Typ.
- e) Zintlsche Phasen.
- B. Mischkrystalle.
- 1. Allgemeine Einteilung.
- 2. Einlagerungsmischkrystalle (interstitiäre Mischkrystalle).
- 3. Substitutionsmischkrystalle. Beständigkeitsgrenzen von Mischkrystallen.
- 4. Defektmischkrystalle.
- V. Diffusion.
- 1. Grundlegende Beziehungen.
- 2. Experimentelle Methoden der Diffusionsmessung.
- 3. Tatsachenmaterial.
- 4. Theorie der Diffusion.
- 5. Diffusion und Reaktion.
- VI. Entstehung des krystallinischen Metallkörpers.
- A. Vorbemerkung.
- B. Die Keimbildung.
- 1. Definition des Schmelzpunktes und die Unvermeidbarkeit einer Unterkühlung bei der Keimbildung.
- 2. Abhängigkeit des Dampfdruckes eines Flüssigkeitskeimes vom Radius.
- 3. Wahrscheinlichkeit der Bildung eines kritischen Tropfenkeimes und die hierzu erforderliche Arbeitsleistung.
- 4. Tropfenbildung an einer Wand.
- 5. Krystallbildung aus dem Dampf (Reifbildung).
- 6. Allgemeines über Krystallkeimbildung in Schmelzen.
- 7. Keimbildung in Metallschmelzen.
- C. Das Krystallwachstum in der Schmelze.
- 1. Definition der linearen Krystallisationsgeschwindigkeit. Ihre formale Richtungsabhängigkeit.
- 2. Grundvorstellung des Krystallwachstums nach W. Kossel, J. N. Stranski.
- 3. Störungen des Krystallwachstums.
- 4. Einfluß der Krystallisationswärme und der Diffusion bei Lösungen. Dendritenbildung. Einfluß der Unterkühlung auf die Krystallform.
- 5. Messung der Krystallisationsgeschwindigkeit (K. G.) nach G. Tammann in Röhrchen.
- 6. Krystallisationsgeschwindigkeit in Mehrstoffsystemen.
- D. Ergänzungen.
- 1. Krystallisation aus dem Dampfraum.
- 2. Keimbildung in Elektrolyten.
- 3. Elektrolytisches Krystallwachstum.
- E. Eigenschaftsänderungen bei der Krystallisation.
- 1. Krystallisationswärme.
- 2. Volumenänderung bei der Erstarrung.
- 3. Allgemeines über Eigenschaftsänderungen bei der Erstarrung.
- F. Entstehung des technischen Metallkörpers aus der Schmelze.
- 1. Gefüge eines technischen Gußstückes.
- a) Beschreibung des Gefüges. Einfluß der Herstellungsbedingungen.
- b) Erklärung des Gefüges eines technischen Metallstückes.
- 2. Erstarrungshohlräume.
- a) Lunkerbildung bei reinen Metallen.
- b) Lunkerbildung bei Legierungen.
- c) Porosität und Einfallstellen.
- 3. Entmischungserscheinungen bei der Erstarrung von Legierungen.
- a) Zonenbildung in Mischkrystallen (Kornseigerung).
- ?) Zonenbildung und Diffusion.
- ?) Beseitigung der Kornseigerung durch Homogenisieren.
- ?) Berechnung der Kornseigerung im Falle fehlender Diffusion.
- b) Blockseigerung.
- ?) Schwereseigerung.
- ?) Direkte und umgekehrte Blockseigerung.
- ?) Ursachen der umgekehrten Blockseigerung.
- ??) Krvstallisationskraft.
- ??) Volumenabnahme bei der Erstarrung.
- ? ?) Hypothese des Schrumpfdruckes.
- c) Gasentbindung bei der Erstarrung.
- ?) Änderung der Löslichkeit von Gasen in Metallen bei der Erstarrung.
- ?) Entmischungserscheinungen infolge der Gasabgabe bei der Erstarrung.
- VII. Physikalische Eigenschaften der Metalle.
- A. Das Metallatom.
- B. Die spezifische Wärme der Metalle.
- C. Volumen und thermische Ausdehnung.
- 1. Reine Metalle.
- 2. Eine Beziehung zwischen der spezifischen Wärme und der thermischen Ausdehnung.
- 3. Volumen und thermische Ausdehnung von Legierungen.
- 4. Kompressibilität der Metalle.
- D. Elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit.
- 1. Tatsachenmaterial zur elektrischen Leitfähigkeit.
- a) Leitfähigkeit und Widerstand reiner Metalle.
- b) Elektrischer Widerstand von Legierungen.
- c) Supraleitfähigkeit.
- 2. Wärmeleitfähigkeit.
- 3. Theorie der elektrischen Leitfähigkeit.
- a) Grundvorstellungen der Theorie freier Elektronen.
- b) Wechselwirkung zwischen den Elektronen und dem Raumgitter. Reziprokes Gitter und Brillouinsche Zonen.
- c) Das Zustandekommen der elektrischen Leitfähigkeit in einem Raumgitter.
- d) Theoretische Vorstellungen über den Einfluß von Temperatur und Zusätzen auf die elektrische Leitfähigkeit.
- E. Magnetische Eigenschaften.
- 1. Einführung. Grundtatsachen und Definitionen.
- a) Das Coulombsche Gesetz. Feldstärke, Induktion und Magnetisierung.
- b) Bemerkungen zu den magnetischen Einheiten.
- 2. Diamagnetismus, Paramagnetismus und Ferromagnetismus.
- 3. Magnetisches Verhalten der reinen Metalle.
- 4. Magnetisches Verhalten von Legierungen.
- a) Verhalten des mechanischen Gemenges.
- b) Verhalten der Mischkrystalle mit Kupfer, Silber und Gold.
- c) Verhalten der Mischkrystalle mit Nickel.
- 5. Die ferromagnetischen Metalle.
- a) Die Magnetisierungsschleife (Hysteresisschleife).
- b) Spontane Magnetisierung. Weißsche Bezirke und Blochsche Wände.
- c) Die Krystallenergie.
- d) Magnetostriktion und Spannungen.
- e) Wandverschiebungen.
- f) Magnetisierungsschleife eines vielkrystallinen Metalles.
- g) Weiche und harte ferromagnetische Materialien.
- F. Thermoelektrizität.
- G. Elastisches Verhalten der Metalle.
- 1. Spannung.
- 2. Hauptspannung. Isotrope Beanspruchung.
- 3. Spannungen und Deformationen im isotropen Körper.
- 4. Spannungen und Deformationen eines Krystalles.
- VIII. Plastische Verformung.
- A. Makroskopische Beschreibung.
- 1. Der Zugversuch. Härte.
- a) Allgemeine Beschreibung des Zugversuchs.
- b) Die wahre (effektive) Spannung.
- c) Meßwerte für den Beginn der plastischen Verformung.
- d) Härte.
- e) Festigkeitswerte einiger Metalle und Legierungen.
- f) Problematik der plastischen Deformation von Metallen.
- 2. Die Geometrie der Plastischen Deformation von Krystallen.
- a) Deformation von Salzkrystallen.
- b) Gleitung bei Metallen.
- c) Quantitative Untersuchung der Translation bei kubischen Metallkrystallen.
- d) Quantitative Untersuchung der Translation bei hexagonalen Metallen und bei Zinn.
- e) Mechanische Zwillingsbildung.
- f) Gleitelemente der metallischen Krystalle.
- 3. Dynamik der plastischen Verformung.
- a) Kritische Schubspannung und Verfestigung.
- b) Temperaturabhängigkeit der kritischen Schubspannung und der Verfestigung.
- c) Die Richtungsabhängigkeit der Verfestigung.
- d) Einfluß der Legierungsbildung auf die Verfestigung bei der plastischen Verformung.
- B. Atomistische Theorie der Gleitung und der Verfestigung.
- 1. Begriff der Versetzung und der Versetzungslinie.
- 2. Geschwindigkeit der Bildung und Wanderung von Versetzungen.
- 3. Vergleich mit der Erfahrung.
- 4. Verfestigung. Einleitende Bemerkung.
- 5. Abhängigkeit der Verfestigung von der Deformationsgeschwindigkeit.
- 6. Spannungshof einer Versetzung.
- 7. Versuch einer Theorie der Verfestigung.
- 8. Temperaturabhängigkeit der Verfestigung.
- 9. Einfluß der Mischkrystallbildung auf die Verfestigung.
- 10. Plastische Deformation von vielkrystallinen Aggregaten im Vergleich mit derjenigen der Einzelkrystalle.
- 11. Abschließende Bemerkung.
- C. Änderungen der physikalischen und chemischen Eigenschaften durch plastische Verformung.
- 1. Änderungen des Röntgenbildes.
- a) Laue-Asterismus.
- b) Die van-Arkel-Verbreiterung der Debye-Scherrer-Linien.
- c) Intensitätsänderungen der Röntgenlinien.
- 2. Änderung der Dichte und des thermischen Ausdehnungs-Koeffizienten durch plastische Verformung.
- 3. Änderung des elektrischen Widerstandes. Mathiessensches Gesetz.
- 4. Verformungsenergie.
- D. Sondererscheinungen.
- 1. Wechselfestigkeit und Ermüdung von Metallen.
- 2. Elastische Nachwirkung.
- 3. Kriechen der Metalle.
- IX. Eigenspannungen.
- A. Natur, Entstehung und Wirkung von Eigenspannungen.
- 1. Definition und Bedeutung von Eigenspannungen.
- 2. Elastische Biegung eines dünnen Streifens.
- 3. Entstehung von Eigenspannungen bei der plastischen Biegung.
- 4. Entstehung von Eigenspannungen durch homogene Deformation eines nicht homogenen Körpers.
- 5. Beeinflussung der Festigkeitseigenschaften durch Eigenspannungen.
- 6. Aufreißen von Metallkörpern durch Eigenspannungen.
- 7. Volumenänderungen durch Eigenspannungen.
- 8. Wärmespannungen.
- 9. Beseitigung von Eigenspannungen.
- 10. Bauschinger-Effekt.
- 11. Eigenspannungen erster, zweiter und dritter Art.
- B. Messung von Eigenspannungen.
- 1. Optische Messung von Spannungen. Allgemeines über Messung von Eigenspannungen.
- 2. Messung von Eigenspannungen mit Röntgenstrahlen.
- 3. Mechanische Messung von Eigenspannungen. Allgemeines.
- X. Erholung und Rekrystallisation.
- A. Definition der Rekrystallisation und der Erholung.
- B. Überblick über die Erscheinungen der Rekrystallisation.
- 1. Bearbeitungsrekrystallisation.
- a) Normaler Rekrystallisationsverlauf eines stärker kaltgereckten Metalles.
- b) Rekrystallisation nach geringen Verformungen.
- c) Abnormes Krystallwachstum (freie sekundäre Rekrystallisation).
- d) Das Rekrystallisationsdiagramm.
- 2. Rekrystallisation des nicht gereckten Metalles.
- a) Rekrystallisation des unterhalb des Schmelzpunktes reduzierten oder sublimierten Metalles.
- b) Rekrystallisation des unmittelbar aus der Schmelze erstarrten Metalles.
- c) Allgemeine Voraussetzung der Rekrystallisation.
- d) Rekrystallisation unter dem Einfluß von Reaktionen im festen Zustand.
- C. Erholung.
- 1. Tatsachen.
- 2. Theorie.
- D. Systematische Erörterung der Teilvorgänge der Rekrystallisation.
- 1. Energetisches Gesamtschema der Rekrystallisation.
- 2. Die Kernbildung.
- a) Argumente für die Annahme einer Kernbildung bei der Rekrystallisation.
- b) Experimentelle Verfolgung der Kernbildung.
- 3. Das Kernwachstum.
- 4. Kornvergrößerung.
- 5. Freie sekundäre Rekrystallisation.
- 6. Erzwungene sekundäre Rekrystallisation.
- 7. Rekrystallisations-Zwillinge.
- 8. Einfluß der Verformungsbedingungen auf die Rekrystallisation.
- E. Einfluß von Verunreinigungen und Legierungszusätzen auf Rekrystallisation und Erholung.
- F. Rekrystallisationstexturen.
- G. Rekrystallisationsbeobachtungen an nichtmetallischen Stoffen.
- XI. Zustandsänderungen in krystallisierten Metallen.
- A. Allgemeines.
- B. Umwandlungen.
- 1. Übersicht der bekannten Umwandlungen.
- 2. Mechanismus der Umwandlungen.
- a) Allgemeines.
- b) Umwandlung von AuCu.
- c) Die ?-?-Umwandlung des Eisens.
- d) Die Umwandlung ?-? im Messing.
- e) Umwandlung des Kobalts.
- f) Umwandlung des Zirkons.
- g) Umwandlung des Zinns.
- C. Aushärtung.
- 1. Grundlegende Erfahrungen am Duralumin.
- 2. Untersuchung der Cu-Be-Legierungen.
- 3. Eingehendere Untersuchung der Cu-Al-Legierungen.
- 4. Arbeiten von G. D. Preston und A. Guinier.
- 5. Rückbildungserscheinungen. Susceptibilität.
- 6. Ausscheidungsvorgänge.
- XII. Chemische Reaktionen der Metalle mit nichtmetallischen Stoffen.
- B. Angriff der Metalle durch Gase.
- 1. Ansatz der Anlaufgeschwindigkeit auf Grund der Diffusion durch die Anlaufschicht.
- 2. Methodik der Messung der Angriffsgeschwindigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Anlauffarben.
- 4. Zur Begründung des exponentiellen Anlaufgesetzes.
- 5. Voraussetzungen für eine lückenlose Bedeckung eines Metalles durch Anlaufschichten und ihre Orientierung zum Metall.
- 6. Nachweis der Wanderung der Metallionen durch Anlaufschichten. Konsequenzen.
- 7. Störung der Ausbildung von Anlaufschichten.
- 8. Oxydation von Legierungen.
- C. Korrosion in Elektrolyten.
- 1. Elektrochemische Grundvorgänge.
- 2. Potentialbildung in Elektrolyten.
- 3. Messung der Potentiale. Die Gleichgewichtspotentiale.
- 4. Konzentrationspolarisation.
- 5. Chemische Polarisation.
- 6. Kombinierte Polarisation.
- 7. Korrosion.
- 8. Angriff in einem allgemeinen Fall der Polarisation.
- 9. Deckschichten auf Metallen.
- 10. Passivität.
- 11. Korrosion von Legierungen.
- a) Mischkrystalle in beweglichem Gleichgewicht. Korrosion von homogenen Mischkrystallen.
- b) Mischkrystalle ohne Platzwechsel der Atome. Resistenzgrenzen.
- c) Mehrphasenlegierungen und verschiedene Metalle in gegenseitiger Berührung.
- Anhang: Einzelne Metalle und Legierungen.
- A. Eisen und einige seiner Legierungen.
- 1. Das Zustandsdiagramm Eisen-Kohlenstoff.
- 2. Einfluß der Abkühlungsgeschwindigkeit auf die Umwandlungen im Eisen-Kohlenstoff-System.
- 3. Widmannstättensches Gefüge.
- 4. Gefügeumbildungen bei der Erhitzung des abgeschreckten Stahles.
- 5. Legierte Stähle.
- a) Allgemeine Übersicht.
- b) Stähle mit erweitertem ?-Feld.
- ?) Eisen-Nickel-Legierungen.
- ?) Manganstähle.
- c) Legierungen mit verengtem ?-Feld.
- d) Stähle mit Carbidbildnern.
- ?) Vanadinstähle.
- ?) Eisen-Chrom-Legierungen.
- 6. Gußeisen.
- B. Kupfer und einige seiner Legierungen.
- 1. Herstellung des Kupfergusses.
- 2. Plastische Deformation und Anlassen des Kupfers.
- 3. Zinn-Bronze.
- 4. Messing.
- C. Leichtmetalle und ihre Legierungen.
- 1. Allgemeine Vorbemerkungen.
- 2. Aluminium und seine Legierungen.
- a) Schmelzbehandlung des Aluminiums und seiner Legierungen.
- b) Formguß aus Aluminium-Legierungen.
- c) Walzlegierungen des Aluminiums.
- 3. Magnesium und seine Legierungen.
- D. Zink und seine Legierungen.
- E. Nickel und seine Legierungen.
- Tabelle der wichtigsten physikalischen Eigenschaften der Metalle.
- Verzeichnis einiger Fachbücher.
- Namenverzeichnis.


