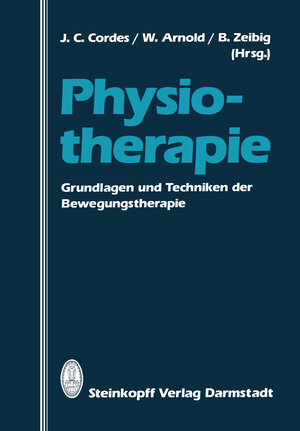
×
![Buchcover ISBN 9783642724138]()
Physiotherapie
Grundlagen und Techniken der Bewegungstherapie
herausgegeben von J.C. Cordes, W. Arnold und B. ZeibigInhaltsverzeichnis
- Theorie der Körpererziehung.
- 1. Einführung in das Fach.
- 2. Merkmale der Bewegungsfunktion.
- 2.1. Bewegungskoordination.
- 2.1.1. Bewegungskoordination — ein komplexer Vorgang im Organismus.
- 2.1.2. Informationsaufnahme und -verarbeitung.
- 2.1.3. Analytische Informationssysteme.
- 2.1.4. Worte als Informationsüberträger.
- 2.1.5. Antizipation und Bewegungsprogrammierung.
- 2.1.6. Bedeutung des Sollwert-Istwert-Vergleiehes.
- 2.2. Allgemeine Bewegungsmerkmale.
- 2.2.1. Struktur azyklischer und zyklischer Bewegungen.
- 2.2.1.1. Besonderheiten im strukturellen Aufbau.
- 2.2.1.2. Bewegungskombinationen.
- 2.2.2. Bewegungsrhythmus.
- 2.2.2.1. Begriffsbestimmung und Bedeutung.
- 2.2.2.2. Rhythmus azyklischer und zyklischer Bewegungen.
- 2.2.3. Bewegungskopplung.
- 2.2.4. Bewegungsfluß.
- 2.2.5. Bewegungspräzision.
- 2.2.6. Bewegungskonstanz.
- 2.2.7. Bewegungsumfang.
- 2.2.8. Bewegungstempo.
- 2.2.9. Bewegungsstärke.
- 2.3. Koordinative Fähigkeiten.
- 2.3.1. Gewandtheit.
- 2.3.2. Spezielle koordinative Fähigkeiten.
- 2.3.3. Beweglichkeit.
- 3. Motorische Ontogenese.
- 3.1. Neugeborenenalter.
- 3.2. Säuglingsalter.
- 3.2.1. Allgemeiner motorischer Befund.
- 3.2.2. Entwicklung des Greifens.
- 3.2.3. Entwicklung zur aufrechten Körperhaltung.
- 3.2.4. Entwicklung der Fortbewegung.
- 3.2.5. Reflexverhalten.
- 3.3. Kleinkindalter.
- 3.3.1. Allgemeiner motorischer Befund.
- 3.3.2. Entwicklung verschiedener Grundbewegungsformen.
- 3.4. Vorschulalter.
- 3.4.1. Allgemeiner motorischer Befund.
- 3.4.2. Weiterentwicklung verschiedener Grundbewegungsformen.
- 3.5. Frühes Schulkindalter.
- 3.5.1. Allgemeiner motorischer Befund.
- 3.5.2. Weiterentwicklung verschiedener Grundbewegungsformen.
- 3.6. Spätes Schulkindalter.
- 3.6.1. Allgemeiner motorischer Befund.
- 3.6.2. Weiterentwicklung verschiedener Grundbewegungsformen.
- 3.7. Pubertätsalter — erste Phase der Reifungszeit.
- 3.7.1. Allgemeiner motorischer Befund.
- 3.7.2. Weiterentwicklung verschiedener Grundbewegungsformen.
- 3.8. Adoleszentenalter — zweite Phase der Reifungszeit.
- 3.8.1. Allgemeiner motorischer Befund.
- 3.8.2. Weiterentwicklung verschiedener Grundbewegungsformen.
- 3.9. Erwachsenenalter.
- 3.9.1. Frühes Erwachsenenalter.
- 3.9.2. Mittleres Erwachsenenalter.
- 3.9.3. Späteres Erwachsenenalter.
- 3.9.4. Spätes Erwachsenenalter.
- 3.10. Motorische Ontogenese — eine wichtige Grundlage in der Physiotherapie.
- 4. Biologische Grundlagen des Trainings.
- 4.1. Wechselbeziehungen zwischen Belastung und Anpassung.
- 4.1.1. Äußere und innere Belastung.
- 4.1.2. Anpassung.
- 4.1.3. Gesetzmäßigkeiten der biologischen Anpassung.
- 4.1.4. Training und Übung.
- 4.1.5. Spezifischer Übungsreiz.
- 4.1.6. Überforderung.
- 4.2. Motorischer Lernprozeß.
- 4.2.1. Bedeutung des motorischen Lernprozesses.
- 4.2.2. Phasen des Lernens.
- 4.2.3. Überprüfung des Leistungsstandes.
- 4.3. Physikalische und physiologische Grundlagen der Muskelarbeit.
- 4.3.1. Physikalische Gesetzmäßigkeiten.
- 4.3.2. Strukturelle und funktionelle Veränderungen am Muskel durch den Übungsprozeß.
- 4.3.3. Bioehemische Vorgänge im Übungsprozeß.
- Krankengymnastik.
- 1. Einführung in die Krankengymnastik.
- 1.1. Aufgaben und Anwendungsmöglichkeiten.
- 1.2. Spezielle Begriffe zur Arbeitsweise der Muskulatur.
- 1.2.1. Möglichkeiten zur Förderung der Muskelaktionen.
- 1.3. Übungsformen in der Krankengymnastik.
- 1.3.1. Achsengerechte Bewegungsform.
- 1.3.2. Kombinierte Bewegungen.
- 1.3.3. PNF (Komplexbewegungen).
- 1.3.4. Einphasige und zweiphasige Übungsformen.
- 1.4. Spezielle Bewegungsformen der Krankengymnastik.
- 1.4.1. Passive Bewegungen.
- 1.4.2. Aktive Bewegungen.
- 1.4.2.1. Aktive Musekelarbeit mit Bewegungserfolg.
- 1.4.2.2. Aktive Muskelarbeit ohne Bewegungserfolg.
- 1.4.3. Aufbau und Steigerungsprobleme krankengymnastischer Behandlungen.
- 1.5. Lagerungen.
- 1.5.1. Dauerlagerungen.
- 1.5.2. Vorbereitende Lagerungen.
- 1.5.3. Behandlungslagerungen.
- 1.6. Ausgangsstellung und Grifftechnik des Physiotherapeuten.
- 1.6.1. Ausgangsstellung des Physiotherapeuten.
- 1.6.2. Griffarten in der Krankengymnastik.
- 1.6.3. Aufgaben der Bewegungs- und Fixa-tionshand.
- 2. Befunderhebung und Dokumentation.
- 2.1. Übersicht zur Befunddokumentation.
- 2.2. Erläuterungen zu verschiedenen Angaben der Befunddokumentation.
- 3. Messungen und Bewegungen für die untere Extremität.
- 3.1. Meßtechnik.
- 3.2. Bewegungen der unteren Extremität.
- 3.2.1. Grifftechnik für Bewegungen im Hüftgelenk.
- 3.2.2. Grifftechnik für Bewegungen im Kniegelenk.
- 3.2.3. Grifftechnik für Bewegungen in den Fuß- und Zehengelenken.
- 3.3. PNF für die untere Extremität.
- 3.3.1. 1. Diagonale.
- 3.3.2. 2. Diagonale.
- 3.4. PNF — Techniken der antagonistischen Bewegungsumkehr.
- 3.4.1. Langsame Umkehr.
- 3.4.2. Langsame Umkehr mit Halten.
- 3.4.3. Rhythmische Stabilisation.
- 3.5. Das Schulen spezieller Muskelgruppen und Muskeln.
- 3.5.1. Muskelmantelschulung für Oberschenkel und gesamtes Bein.
- 3.5.2. Übungen für den M. quadriceps femoris.
- 3.5.3. PNF —Übung en zur speziellen Kräftigung der Unterschenkelextensoren und -flexoren.
- 3.5.4. Schulung der Innenzügler und Außenzügler.
- 3.5.5. Schulung der Mm. glutei.
- 3.5.6. PNF — Übungen zur speziellen Kräftigung der Glutealmuskulatur.
- 3.6. Bewegungskombinationen und Gebrauchsbewegungen.
- 3.6.1. Bewegungskombinationen.
- 3.6.2. Gebrauchsbewegungen.
- 4. Messungen und Bewegungen für die obere Extremität und den Schultergürtel.
- 4.1. Meßtechnik.
- 4.2. Bewegungen der oberen Extremität und des Schultergürtels.
- 4.2.1. Grifftechniken für Bewegungen im Oberarm-Schulter-Gelenk.
- 4.2.2. Grifftechnik für Bewegungen im Ellenbogengelenk.
- 4.2.3. Grifftechnik für Bewegungen im Handgelenk und in den Fingergelenken.
- 4.2.4. Grifftechnik für Bewegungen des Schultergürtels.
- 4.3. PNF für die obere Extremität.
- 4.3.1. 1. Diagonale.
- 4.3.2. 2. Diagonale.
- 4.4. PNF — Techniken der antagonistischen Bewegungsumkehr.
- 4.5. Schulung spezieller Muskelgruppen und Muskeln.
- 4.5.1. Muskelmantelschulung für Oberarm und gesamten Arm.
- 4.5.2. Schulung des M. deltoideus.
- 4.6. Bewegungskombinationen und Gebrauchsbewegungen.
- 4.6.1. Bewegungskombinationen.
- 4.6.2. Gebrauchsbewegungen.
- 5. Messungen und Bewegungen für den Kopf und den Rumpf.
- 5.1. Meßtechnik.
- 5.2. Bewegungen der Wirbelsäule.
- 5.2.1. Grifftechnik für Bewegungen des Kopfes (HWS).
- 5.2.2. Grifftechnik für Bewegungen der Brustwirbelsäule (BWS).
- 5.2.3. Grifftechnik für Bewegungen des Beckens (LWS).
- 5.3. PNF für den Rumpf.
- 5.3.1. PNF für den unteren Rumpf.
- 5.3.2. PNF für den oberen Rumpf.
- 5.3.3. PNF für den Kopf und für den Hals.
- 5.4. Isometrische Spannungsübungen für die Rumpfmuskulatur.
- 6. Entwicklungsbedingte Übungsfolgen.
- 6.1. Übungen im Liegen.
- 6.2. Übungen im Vierfüßlerstand.
- 6.3. Übungen im Sitz.
- 6.4. Übungen im Stand und in der Fortbewegung.
- 6.4.1. Übungen im Stand.
- 6.4.2. Übungen in der Fortbewegimg.
- 7. Kontrakturbehandlung.
- 8. Prä- und postoperative Physiotherapie.
- 9. Übungen in der schwerelosen Aufhängung.
- 9.1. Arten der Aufhängung.
- 9.2. Behandlungsformen in der schwerelosen Aufhängung.
- 10. Übungsbehandlung im Wasser.
- 10.1. Zu berücksichtigende Wirkungsfaktoren.
- 10.1.1. Auftrieb.
- 10.1.2. Hydrostatischer Druck.
- 10.1.3. Wasserwiderstand.
- 10.1.4. Wassertemperatur.
- 10.1.5. Wellen und Strömung.
- 10.2. Durchführung der Übungsbehandlung im Wasser.
- 10.2.1. Organisatorische Hinweise.
- 10.2.2. Inhalt und Formen der Übungsbehandlung im Wasser.
- 10.2.2.1. Allgemeine Grundsätze.
- 10.2.2.2. Behandlungsformen.
- 10.3. Vorteile und Nachteile der Übungsbehandlung im Wasser.
- Gymnastik.
- 1. Einführung in das Lehrgebiet Gymnastik.
- 1.1. Historischer Überblick.
- 1.2. Zielsetzung, Aufgaben und Gestaltung der Gymnastik.
- 2. Allgemeine Voraussetzungen.
- 2.1. Raum.
- 2.2. Inventar.
- 2.3. Pflege der Geräte.
- 2.4. Kleidung.
- 2.5. Raumnutzung.
- 2.5.1. Gymnastik im geschlossenen Raum.
- 2.5.2. Gymnastik im Freien.
- 2.6. Räumliche Veränderungen (Raumwege).
- 2.7. Organisationsformen.
- 2.7.1. Einzelgymnastik.
- 2.7.2. Gruppengymnastik.
- 2.7.2.1. Gruppengröße.
- 2.7.2.2. Einteilung der Gymnastikgruppen.
- 2.7.2.3. Gemeinschaftsübungen in der Gruppengymnastik.
- 2.8. Ausgangsstellen.
- 2.8.1. Ausgangsstellungen der Gruppe im Raum.
- 2.8.1.1. Reihen.
- 2.8.1.2. Blockaufstellungen.
- 2.8.1.3. Kreise.
- 2.8.1.4. Keile.
- 2.8.1.5. Gassenaufstellung.
- 2.8.1.6. Methodische Hinweise.
- 2.8.2. Ausgangsstellungen der Übenden.
- 2.8.2.1. Lagen.
- 2.8.2.2. Sitze.
- 2.8.2.3. Stütze.
- 2.8.2.4. Stände.
- 2.8.3. Armhalten und Armfülirungen.
- 2.9. Schriftliche Vorbereitung von Übungseinheiten und Lehrproben.
- 2.10. Aufbau einer Gymnastikstunde.
- 3. Einflüsse der Krankengymnastik auf die inhaltliche Gestaltung der Gymnastik.
- 4. Grundlagen und Methoden der Gymnastik.
- 4.1. Hauptmerkmale des sportlichen Trainings, bezogen auf die Anforderungen in der Gymnastik.
- 4.2. Leistungstests zur Ermittlung des Zustandes motorischer Fähigkeiten.
- 4.3. Entwicklung konditionelier und koordinativer Fähigkeiten.
- 4.3.1. Ausdauerentwicklung.
- 4.3.2. Entwicklung der Kraft.
- 4.3.3. Schnelligkeitstraining.
- 4.3.4. Gewandtheitsentwicklung.
- 4.3.5. Beweglichkeitsentwicklung.
- 4.4. Gymnastik als Mittel zur Schulung des Körpergefühls und der Entspannungsfähigkeit.
- 4.5. Technische Merkmale der Elementegruppen.
- 4.5.1. Stände.
- 4.5.2. Sehrittarten.
- 4.5.3. Sprünge.
- 4.5.4. Drehungen.
- 4.5.5. Schwünge.
- 4.5.6. Wellen.
- 5. Haltung.
- 5.1. Ruhehaltung.
- 5.2. Aufrechte Haltung.
- 5.2.1. Grundlagen für die Schulung der aufrechten Haltung.
- 5.2.2. Übungsauswahl.
- 6. Schulung motorischer Fälligkeiten.
- 6.1. Methodische Hinweise.
- 6.2. Schulung konditioneller Fähigkeiten.
- 6.2.1. Schulung der Ausdauer.
- 6.2.2. Schulung der Kraft.
- 6.3. Schulungkoordinativer Fähigkeiten.
- 6.3.1. Schulung der Gewandtheit.
- 6.3.2. Schulung der Geschicklichkeit.
- 6.4. Schulung der Beweglichkeit.
- 6.4.1. Schulung der Beweglichkeit in den Fußgelenken.
- 6.4.2. Schulung der Beweglichkeit im Hüftgelenk.
- 6.4.3. Schulung der Beweglichkeit der Wirbelsäule.
- 6.4.4. Schulung der Beweglichkeit im Schultergelenk.
- 7. Schulung der Elementegruppen.
- 7.1. Stände und Schulung des Gleichgewichts.
- 7.1.1. Statische Gleichgewichtsfähigkeit in Form der Stände.
- 7.1.2. Dynamische Gleichgewichtsfähigkeit in Form von Schrittfolgen.
- 7.1.3. Kombinationen dynamischer und statischer Elemente.
- 7.2. Schrittarten.
- 7.2.1. Gehschritte.
- 7.2.2. Laufschritte.
- 7.2.3. Sprungschritte.
- 7.3. Drehungen.
- 7.4. Schwünge.
- 8. Gymnastik mit Geräten.
- 8.1. Gymnastik mit Handgeräten.
- 8.1.1. Gymnastik mit der Keule.
- 8.1.1.1. Beschaffenheit der Keule und ihre Verwendung.
- 8.1.1.2. Praktische Durchführung der Gymnastik mit der Keule.
- 8.1.2. Gymnastik mit dem Gymnastikball.
- 8.1.2.1. Beschaffenheit des Balles und seine Verwendung.
- 8.1.2.2. Praktische Durchführung der Gymnastik mit dem Gymnastikball.
- 8.1.3. Gymnastik mit dem Medizinball.
- 8.1.3.1. Beschaffenheit des Medizinballes und seine Verwendung.
- 8.1.3.2. Praktische Durchführung der Gymnastik mit dem Medizinbali.
- 8.1.4. Gymnastik mit dem Stab.
- 8.1.4.1. Beschaffenheit des Stabes und seine Verwendung.
- 8.1.4.2. Praktische Durchführung der Gymnastik mit dem Stab.
- 8.1.5. Gymnastik mit dem Reifen.
- 8.1.5.1. Beschaffenheit des Reifens und seine Verwendung.
- 8.1.5.2. Praktische Durchführung der Gymnastik mit dem Reifen.
- 8.1.6. Gymnastik mit dem Seil.
- 8.1.6.1. Beschaffenheit der Seilarten und deren Verwendung.
- 8.1.6.2. Praktische Durchführung der Arbeit mit dem Seil.
- 8.1.6.2.1. Sprungseil.
- 8.1.6.2.2. Schwungseil.
- 8.1.6.2.3. Rundseil.
- 8.2 Gymnastik mit Turngeräten.
- 8.2.1. Gymnastik mit der Langbank.
- 8.2.1.1. Beschaffenheit der Langbank und ihre Verwendung.
- 8.2.1.2. Praktische Durchführung der Gymnastik mit der Langbank.
- 8.2.2. Gymnastik an der Sprossenwand.
- 8.2.2.1. Beschaffenheit der Sprossenwand und ihre Verwendung.
- 8.2.2.2. Praktische Durchführung der Gymnastik mit der Sprossenwand.
- 8.3. Der Einsatz von Hilfsgeräten.
- 9. Rhythmische Arbeiten in der Gymnastik.
- 9.1. Rhythmische Lehr- und Arbeitsweise.
- 9.2. Theoretische Grundlagen.
- 9.3. Grundrhythmen der Elementegruppen.
- 9.4. Taktwechsel — Rhythmuswechsel (Notenbeispiel 11).
- 9.5. Instrumentarium für die rhythmische Lehr- und Arbeitsweise.
- 9.5.1. Stimme und Übungskommando.
- 9.5.2. Klatschen und Stampfen.
- 9.5.3. Die musikalische Begleitung der Bewegungen.
- 10. Spiele.
- 10.1. Bedeutung des Spiels.
- 10.2. Die Kleinen Spiele.
- 10.2.1. Begriffserklärung.
- 10.2.2. Einteilung der Kleinen Spiele.
- 10.2.3. Zielsetzung der Kleinen Spiele.
- 10.2.4. Besonderheiten des Spielens in den einzelnen Altersgruppen.
- 10.2.5. Bedeutung des Spielleiters.
- 10.2.6. Zuordnung der Kleinen Spiele zu einer Gymnastikstunde.
- 10.2.7. Zur Spielsammlung.
- Gymnastik für Säuglinge und Kleinkinder.
- 1. Einführung in das Lehrgebiet Gymnastik für Säuglinge und Kleinkinder.
- 1.2. Zielsetzung und Wirkung der Gymnastik für Säuglinge und Kleinkinder.
- 1.3. Indikationen und Kontraindikationen für eine Säuglings- oder Kleinkindergymnastik.
- 2. Säuglingsgymnastik.
- 2.1. Methodische Hinweise für die Säuglingsgymnastik.
- 2.2. Voraussetzungen.
- 2.2.1. Raum.
- 2.2.2. Physiotherapeut.
- 2.2.3. Säugling.
- 2.3. Befunderhebung.
- 2.3.1. Allgemeiner Befund.
- 2.3.2. Spezieller Befund.
- 2.4. Grundübungen.
- 2.4.1. Übungen, die das Kopf- und Rumpfheben fördern.
- 2.4.2. Übungen, die das Drehen um die Körperlängsachse schulen.
- 2.4.3. Übungen, die das Aufrichten unterstützen.
- 2.4.4. Lokomotionsübungen.
- 3. Hinweise zur Kleinkindergymnastik..
- 3.1. Spezielle Hinweise zur Durchführung.
- 3.2. Spezielle Hinweise zur Übungsauswahl.
- 3.3. Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Bezugspersonen.
- Sachwortverzeiehnis.



