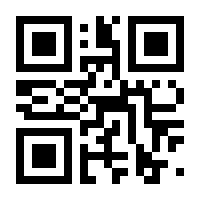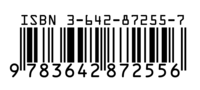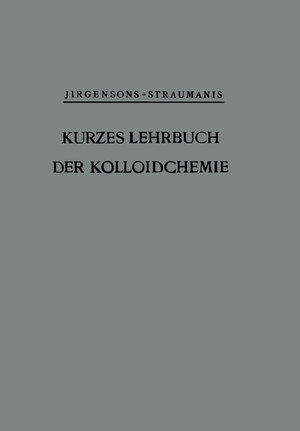
×
![Buchcover ISBN 9783642872556]()
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil.
- Chemie und Kolloidchemie.
- Einiges aus der Entwicklung der Kolloidchemie.
- Bedeutung der Kolloidchemie.
- I. Die Grundbegriffe der Kolloidchemie.
- Einteilung der Kolloide.
- Anorganische und organische Kolloide.
- Sphäro- und Linearkolloide.
- Molekül- und Micellkolloide.
- Solvatisierte (lyophile) und nichtsolvatisierte (lyophobe) Kolloide.
- Hydrophile und lipophile Atomgruppen.
- Teilchengestalt, Solvatation und Oberfläche.
- Zusammenfassendes und Ergänzendes über die kolloidchemische Nomenklatur.
- II. Die elementaren Untersuchungsmethoden der Kolloidchemie.
- Darstellung einiger Kolloide für Versuchszwecke.
- Filtration und Ultrafiltration.
- Diffusion und Dialyse.
- Die Koagulation.
- Die Viskosität.
- Die optischen Eigenschaften.
- Die Konzentration und Dichte der Sole.
- Zweiter Teil.
- III. Disperse Systeme vom molekularkinetischen Standpunkt aus betrachtet.
- Die Brownsche Bewegung.
- Diffusion.
- Sedimentationsgleichgewicht.
- Der Osmotische Druck.
- IV. Die Grenzflächenerscheinungen.
- Die Oberflächenspannung.
- Zustandekommen und Definition der Oberflächenspannung.
- Messung und Größe der Oberflächenspannung.
- Die Adsorption. Dynamische und statische Oberflächenspannung.
- Beeinflussung der Oberflächenspannung des Wassers durch verschiedene kapillaraktive Stoffe.
- Ausbreitung von Stoffen auf Flüssigkeitsoberflächen. Monomolekulare Schichten.
- Die Benetzungsvorgänge, Der Randwinkel.
- Grenzflächenaktivität.
- Oberflächenspannung kolloider Lösungen.
- Anorganische Kolloide.
- Organische Kolloide.
- Die Bedeutung der Oberflächenspannung.
- Die Oberfläche des dispersen Anteils. Adsorptionserscheinungen.
- Oberflächenvergrößerung bei der Dispergierung.
- Oberflächenbeschaffenheit kolloider Teilchen.
- Die Adsorption.
- Definition und Allgemeines.
- Gesetzmäßigkeiten bei der Adsorption.
- Adsorption an der Grenzfläche fest-flüssig.
- Adsorption organischer Stoffe. Chromatographische Analyse.
- Einfluß des Lösungsmittels und der Temperatur auf die Adsorption.
- Die Ionenadsorption.
- Die Adsorption von Kolloidteilchen.
- Die Adsorption an der Grenzfläche festgasförmig.
- Die Desorption.
- Zur Theorie der Adsorption.
- V. Die optischen Eigenschaften disperser Systeme.
- Die Streuung des Lichtes in farblosen Solen.
- Das Rayleigsche Gesetz.
- Abhängigkeit der Lichtstreuung von der Konzentration, Tyndallometrie, Nephelometrie.
- Abhängigkeit der Lichtstreuung von der Teilchengröße.
- Messung des vom Sol durchgelassenen Lichts.
- Opaleszenz und Trübung disperser Systeme.
- Absorption des Lichtes in Solen (Farbe).
- Messung der Lichtabsorption.
- Die absorbierten und zerstreuten Lichtmengen.
- Die Absorption ultravioletter Strahlen.
- Andere optische Eigenschaften.
- Lichtbrechung und Konzentration.
- Die optische Anisotropie kolloider Lösungen.
- VI. Die elektrischen Eigenschaften disperser Systeme.
- Die Elektrophorese (Kataphorese).
- Das elektrokinetische Potential.
- Die Größe der Teilchenladung.
- Die elek-trische Leitfähigkeit.
- Anwendungen der Elektrophorese.
- Die Elektroosmose.
- Die Anwendungen der Elektroosmose.
- Das Strömungspotential und Fallpotential.
- Die Gründe der Aufladung von Kolloidteilchen.
- Aufladung durch Dissoziation der den Teilchen angehörigen Atomgruppen.
- Aufladung durch Adsorption von Ionen.
- Die Reibungselektrizität als Grund der Aufladung.
- Die Beeinflussung der Teilchenladung.
- Der Einfluß verschiedener Elektrolyte auf die Ladung bzw. auf das elektro kinetische Potential.
- Der isoelektrische Punkt.
- Die Proteine als amphotere Kolloidelektrolyte.
- VII. Die Viskosität kolloider Lösungen.
- Die Meßmethoden.
- Das Wilh. Ostwaldsche Kapillarviskosimeter.
- Das Rotationsviskosimeter.
- Das Kugelfallviskosimeter.
- Die Viskosität von Sphärokolloiden.
- Die Konzentrationsabhängigkeit der Viskosität.
- Viskosität und Teilchengröße.
- Die Viskositätszahl.
- Die Abhängigkeit der Viskosität von der Tem-peratur.
- Einfluß elektrischer Ladungen auf die Viskosität.
- Die Viskosität der Linearkolloide.
- Viskosität und Teilchenform.
- Sol- und Gellösungen.
- Die Abhängigkeit der Viskosität vom Polymerisationsgrad (Molekulargewicht, Teilchengröße). Viskositätsmessungen an Sollösungen.
- Die Viskosität heteropolarer Linearkolloide.
- Einfluß der Temperatur und des Alterns auf die Viskosität der Linearkolloide.
- Der Einfluß des Lösungsmittels auf die Viskosität.
- Die Beurteilung der technischen Eigenschaften eines gelösten Stoffes aus der Viskosität seiner Lösungen.
- Die Strukturviskosität.
- Die Abhängigkeit der Viskosität vom Druck bzw. von der Schubspannung.
- Die Charakterisierung nicht-Newtonscher Sole durch Fließkurven.
- VIII. Die Bestimmung der Teilchengröße.
- Bestimmung der Teilchengröße mit Hilfe der Ultrazentrifuge.
- Prinzip der Methode.
- Beschreibung der Apparatur.
- Die mit der Ultrazentrifuge gewonnenen Ergebnisse.
- Bestimmung der Teilchengröße mit Hilfe des Ultramikroskops.
- Anwendungsbereich des Ultramikroskops und die Ergebnisse.
- Bestimmung des Molekulargewichts bzw. der Teilchengröße durch Messung des osmotischen Druckes.
- Bestimmung des Molekulargewichts durch Viskositätsmessungen.
- Weitere Methoden.
- Kryoskopie und Ebullioskopie.
- Isotherme Destination.
- Messung der Diffusion.
- Abschätzung der Teilchengröße durch Ultrafiltration.
- Bestimmung des Molekulargewichts nach der Dialysemethode.
- Bestimmung des Molekulargewichts bzw. der Teilchengröße durch Fällungstitration.
- Teilchengröße aus der Fallgeschwindigkeit.
- Bestimmung der Teilchengröße nach der Streuung des Lichtes.
- Chemische Methoden.
- Bestimmung der Polydispersität.
- IX. Bestimmung der Teilchenform.
- Bestimmung der Teilchenform aus der Lichtstreuung, Depolarisation und Strömungsdoppelbrechung.
- Schlierenbildung.
- Funkeln im Ultramikroskop.
- Messung des zerstreuten Lichtes strömender Teilchen.
- Depolarisation.
- Strömungsdoppelbrechung.
- Doppelbrechung im magnetischen Felde.
- Bestimmung der Teilchenform mit der Ultrazentrifuge.
- Bestimmung der Teilchenform durch Viskositätsmessungen.
- Der Dissymmetriefaktor.
- Über die Gestalt der Fadenmoleküle in der Lösung.
- Eine einfache Klassifikation der Kolloide nach der Teilchenform.
- X. Die Bestimmung der Teilchengröße und -form mittels Röntgen- und Elektronen- strahlen.
- Bestimmung mittels Röntgenstrahlen.
- Geschichtliches.
- Wie kommen die Diagramme kolloider Stoffe zustande?.
- Bestimmung der Teilchengröße.
- Bestimmung der Teilchenform.
- Einige Beispiele der Teilchengröße- und -formbestimmung.
- Bestimmung der Teilchengröße mittels Elektronenstrahlen.
- Elektronenmikroskopische Bestimmung der Teilchengröße und -form.
- Die Methode.
- Das Elektronenübermikroskop.
- Die Resultate der übermikroskopischen Untersuchungen.
- Einige weitere Ergebnisse der Untersuchungen von Kolloiden mit Röntgen strahlen.
- Anorganische Kolloide im Röntgenstrahl.
- Aufbau der Seifenlösungen.
- Kleinwinkelstreuung.
- XI. Die Herstellung kolloider Lösungen.
- Die Dispergierungsmethoden.
- Herstellung kolloider Lösungen durch Mahlen.
- Dispergierung durch Ultraschallwellen.
- Herstellung von Solen durch elektrische Zersteubung von Metallelektroden.
- Herstellung kolloider Lösungen durch Peptisation von Niederschlägen.
- Die Kondensationsmethoden.
- Der Vorgang der Kondensation.
- Kondensationsprozesse durch Verminderung der Löslichkeit.
- Die chemischen Kondensationsmethoden.
- Herstellung von Gold- und Silbersolen und dereh Eigenschaften.
- Die Schwefelscle.
- Die Oxydhydratsole.
- Kolloide Salze.
- Reinigung und Konzentrierung der Kolloide durch Elektrodekantation.
- Die Eigenschaften der erhaltenen Lösungen.
- Die Bildung kolloider Stoffe in Polymerisations- bzw. Polykondensationsreaktionen.
- Isolierung hochpolymerer Naturstoffe.
- Fraktionierte Fällung.
- Die Löslichkeit von Molekülkolloiden.
- XII. Die Zustandsänderungen lyophober Sole.
- Die Beständigkeit der Sole. Alterungserscheinungen.
- Die Ursachen der spontanen Alterung.
- Chemische Änderungen während des Alterns.
- Alterung und Teilchenform.
- Der Lebenslauf eines Sols.
- Die Koagulation lyophober Sole durch Elektrolyte.
- Quantitative Untersuchung der Koagulation.
- Der Flockungswert.
- Die Schultze-Hardysche Regel.
- Der Einfluß hochwertiger Ionen.
- Die verschiedene Wirkung gleichgeladener Ionen.
- Die Wirkung mehrwertiger Ionen, die dasselbe Ladungsvorzeichen wie die Kolloidteilchen haben.
- Der Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration.
- Koagulation durch Elektrolytgemische.
- Das Phänomen der „Unregelmäßigen Reihen“ (Doppelflockung).
- Der Einfluß der Solkonzentration.
- Die physikalisch-chemischen Gründe der Koagulation.
- Warum und wie bewirken die Elektrolyte die Ausflockung?.
- Flockungswert und Aktivitätskoeffizient.
- Die Koagulationsgeschwindigkeit.
- Abnahme der Teilchenzahl.
- Schnelle und langsame Koagulation.
- Die Koagulation polydisperser Sole.
- Der Einfluß der Teilchenform auf die Koagulationsgeschwindigkeit.
- Hervorrufung und Beeinflussung der Koagulation durch verschiedene Mittel.
- Die Gewöhnung.
- Die mechanische Koagulation.
- Die thermische Koagulation.
- Die Koagulation durch Stromwirkung.
- Koagulation durch Strahlenwirkung.
- Der Einfluß verschiedener Nichtelektrolyte auf die Beständigkeit lyophober Sole.
- Die Beständigkeit verschiedener Solgemische.
- Die, gegenseitige Koagulation entgegengesetzt geladener lyophober Sole.
- Die Wirkung gleichgeladener lyophober Sole aufeinander.
- Die Flockung lyophober Sole durch lyophile.
- Die Schutzwirkung lyophiler Sole.
- XIII. Die Zustandsänderungen lyophiler Kolloide.
- Die Bedeutung der Solvatation und Ladung für die Beständigkeit lyophiler Sole.
- Stark und schwach solvatisierte Teilchen.
- Versuche, den Solvatationsgrad zu bestimmen.
- Teilchengröße, Teilchenbau und Solvatation.
- Die Umwandlung lyophiler Kolloide in lyophobe.
- Einteilung lyophiler Kolloide hinsichtlich der Beständigkeit.
- Die Koagulation lyophiler Kolloide durch Elektrolyte.
- Die Koagulation typischer (stabiler) lyophiler Sole.
- Einfluß der Wasserstoff-ionenkonzentration.
- Quantitative Zusammenhänge zwischen Salz- und Kolloidkonzentration.
- Die Koagulation durch Schwermetallsalze.
- Die physikalisch-chemischen Gründe der Koagulation lyophiler Sole durch Elektrolyte.
- Drei Arten der Solvatation.
- Die peptisierende Wirkung von Elektrolyten.
- Fällbarkeit durch Nichtlösungsmittel.
- Fällbarkeit und Löslichkeit.
- Eigenschaften des Fällungsmittels.
- Die Konzentration des Kolloids. Einfluß der Temperatur.
- Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration.
- Fällbarkeit, Teilchengröße und Teilchenform.
- „Unregelmäßige Reihen“ bei der Koagulation durch Nichtlösungsmittel.
- Die Koagulation lyophiler Sole durch Nichtelektrolyte und Salze.
- Niedrige Salzkonzentration.
- Hohe Salzkonzentration.
- Die Gründe der Sensibilisation und Stabilisation.
- Bedeutung der Sensibilisations- und Stabilisationseffekte.
- Die Beeinflussung der Größe und Struktur der Teilchen lyophiler Kolloide.
- Reversible Änderung der Teilchengröße von Mizellkolloiden.
- Reversible Dissoziation der Proteinmoleküle.
- Hervorrufung der Flockung durch verschiedene Mittel.
- Durch chemische Mittel erzwungene irreversible kolloidchemische Umwandlungen.
- Gegenseitige Flockung und Entmischung zweier lyophiler Kolloide.
- Die Koazervation.
- Deutung der gegenseitigen Fällung und Entmischung.
- Die Gelatinierung.
- XIV. Die Gele.
- Klassifikation der Gele.
- Was sind Gele?.
- Einteilung der Gele.
- Die Gelbildung.
- Gelbildung durch Koagulation bzw. Löslichkeitserniedrigung.
- Erstarrung eines Sols infolge von Abkühlung.
- Gele als Reaktionsprodukte zweier konzentrierter Lösungen.
- Die Quellung.
- Der Quellungsdruck.
- Die Quellungsgeschwindigkeit.
- Beeinflussung der Quellung durch verschiedene Mittel.
- Die Eigenschaften der Gele.
- Die Struktur.
- Die Flüssigkeitsabgabe und Aufnahme.
- Das Gefrieren von Gelen.
- Die optischen Eigenschaften der Gele.
- Die Synaerese.
- Die Thixotropie.
- Die technischen Eigenschaften einiger Xerogele.
- Die Membranen als Gele.
- Die Porenweite und Quellungsgrad.
- Donnansches Membrangleichgewicht.
- Permeabilität und Ladung von Membranen.
- Komplizierte Membranen mit veränderlichen Struktur.
- Diffusion und Reaktionen in Gelen.
- Diffusion in Gelen.
- Rhythmische Fällungen in Gelen.
- Organische Gele im Röntgenstrahl.
- XV. Die Emulsionen.
- Herstellung und Eigenschaften der Emulsionen.
- Aggregatzustand, Dispersitätsgrad und Konzentration.
- Die Emulgatoren. Struktur der Emulsionsteilchen.
- Umkehrbare Emulsionen.
- Einige praktisch wichtige Emulsionen.
- XVI. Gasdispersionen und Schäume.
- Einiges über Gasdispersionen.
- Die Schäume.
- Der innere Aufbau der Schäume.
- Die Schaumbildner (Schäumer).
- Zwei- und mehrphasige Schäume.
- Zerstörung der Schäume.
- Die Schäume in der präparativen Praxis und in der Technik.
- XVII. Ärosole (Nebel, Staub, Rauch).
- Definitonen.
- Darstellungsmethoden.
- Die optischen Eigenschaften der Ärosole.
- Die Teilchengröße und -Form der Ärosole.
- Stabilität, Koagulation und Entnebelung.
- Die Bedeutung der Ärosolforschung.
- XVIII. Feste Sole.
- Einschränkung des Gebiets fester Sole.
- Amorphe Stoffe als Dispersionsmittel.
- Durchsichtige kristalline Stoffe als Dispersionsmittel.
- Namenverzeichnis.