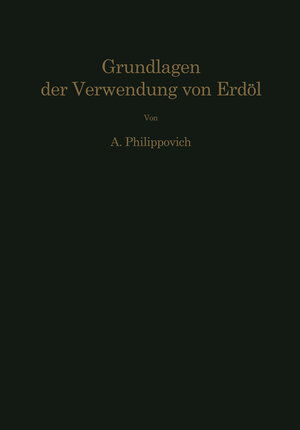
×
![Buchcover ISBN 9783709178973]()
Chemisch-physikalische Grundlagen der Verwendung von Erdöl und seinen Produkten
von Alexander PhilippovichInhaltsverzeichnis
- I. Grundsätzliches über die Messung von Stoifeigenschaften.
- 1. Maßsysteme.
- a) Das metrische System.
- ?) Das physikalische Maßsystem.
- ?) Das technische Maßsystem.
- b) Das angelsächsische Maßsystem.
- c) Temperaturmaße.
- 2. Angabe von Konzentrationen.
- a) Druck- und temperaturunabhängige Angaben.
- b) Druck- und temperaturabhängige Angaben.
- 3. Verwendung von Bezugsstoffen.
- a) Zur Bestimmung chemischer Eigenschaften komplexer Art.
- ?) Die Bezugsstoffe n-Heptan und i-Oktan zur Klopfmessung.
- ?) Die Bezugsstoffe zur Messung der ZündWilligkeit.
- ?) Die Bezugsstoffe zur Messung der Alterungsneigung von Benzinen.
- b) Zur Messung physikalischer Eigenschaften.
- II. Eigenschaften bzw. komplexes Verhalten des Erdöls und seiner Produkte.
- A. Physikalische Eigenschaften 8.
- 1. Atome, Moleküle und ihre Spektren.
- Elektronenbahnen.
- Ordnungszahlen und Elektronenhüllen.
- Röntgenstrahlung.
- Die optischen Spektren.
- Atomspektren.
- Molekülspektren.
- Infrarotspektren und Raman-Spektren.
- Ultraviolettspektren.
- Die Absorptionsspektroskopie.
- Licht-absorption.
- Transparenz und Extinktion.
- Die technischen Kolorimeter.
- Kötschaus Farbenkonstante.
- Die Massen — spektrographie.
- Dipole.
- Lichtbrechung.
- Die Lichtbrechung zur Charakteristik von Erdölprodukten.
- Orientierungspolarisation 14..
- 2. Die Aggregatzustände und die Dichte (das spezifische Gewicht).
- a) Die Aggregatzustände.
- ?) Gase.
- Kinetische Gastheorie.
- Stoßzahl und freie Weglänge.
- ?) Feste Körper.
- Die Entropie.
- Der Begriff der Fehlordnung.
- ?) Flüssigkeiten.
- Fehlstellen.
- b) Dichte (spezifisches Gewicht).
- ?) Begriffsbestimmung.
- ?) Wesen.
- ?) Einflüsse auf die Dichte.
- Temperatur.
- Druck.
- Mischung.
- ?) Messung der Dichte.
- ?) Praktische Bedeutung.
- Strukturelle Gruppenanalyse.
- Reduzierte Dichte.
- 3. Spezifische Wärme.
- a) Definition.
- b) Wesen.
- c) Einflüsse.
- d) Messung.
- e) Praktische Bedeutung.
- 4. Zustandsgieichungen und Zustandsänderungen.
- a) Zustandsgieichungen.
- Das Boyle-Mariottesche Gesetz.
- Die Gay-Lussac-Regel.
- Das Daltonsche Gesetz.
- Die Zustandsgieichung.
- Die Zustandsgleichung von Van Der Waals.
- Die reduzierte Zustands-gieichung.
- Die Zustandsgieichung von Himpan.
- b) Zustandsänderungen idealer Gase.
- Erster Hauptsatz der Wärmelehre.
- Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre.
- Der thermodynamische Wirkungsgrad.
- Triebwerkdaten.
- Kennzeichnung der Motorleistung.
- 5. Die Zähigkeit.
- a) Definition und Wesen.
- b) Maßeinheiten.
- Die absolute Einheit der Zähigkeit.
- Die kinematische Zähigkeit.
- Die konventionellen Zähigkeitsmaße.
- ?) Temperatur.
- Absolute Temperatur-Indizes.
- Temperatur-Indizes relativer Art.
- ?) Druck.
- ?) Schergeschwindigkeit.
- ?) Verdünnung.
- ?) Konstitution.
- e) Praktische Bedeutung der Zähigkeit und des Fließ Verhaltens.
- ?) Schmierung.
- Hydrodynamische Reibung.
- Gleitbegirm.
- Grenzschicht-Schmierung.
- ?) Fließen.
- ?) Absetzgeschwindigkeit fester Teilchen.
- ?) Zerstäubung.
- 6. Fließen nicht-NEwtonscher Stoffe und Erstarren.
- c) Maßeinheiten.
- d) Einflüsse.
- e) Messung.
- f) Praktische Bedeutung.
- 7. Verdampfen, Destillieren, Fraktionieren.
- ?) Dampfdruck.
- ?) Verdampfungswärme.
- ?) Flüchtigkeit.
- ?) Kritische Temperaturen und Drucke.
- ?) Fraktionierung.
- c) Messung von Dampfdruck und Siedeverhalten.
- d) Einflüsse auf den Dampfdruck.
- e) Praktische Bedeutung des Siedeverhaltens und des Dampfdruckes.
- 8. Lösen und Mischen.
- c) Einflüsse auf die Löslichkeit.
- d) Messung des Lösungsvermögens.
- e) Praktische Bedeutung des Lösungsverhaltens.
- 9. Suspendieren und Emulgieren.
- c) Einflüsse auf die Beständigkeit von Suspensionen und Emulsionen.
- ?) Der Auftrieb.
- ?) Feinheit des zerteilten Stoffes.
- ?) Zähigkeit des dispergierenden Mediums.
- ?) Elektrische Aufladung.
- ?) PH (Wasserstoffionenkonzentration).
- ?) Mechanische Bewegung.
- ?)Mehrwertige Ionen.
- d) Messung der Suspensions- und Emulgierfähigkeit.
- e) Praktische Bedeutung der Suspensions- und Emulgierfähigkeit.
- 10. Zerstäubung.
- Zweistoffzerstäubung.
- Mechanische Zerstäubimg.
- Druckzerstäubung.
- Der Sauter-Mean-Diameter als Kennzeichen.
- Konstruktion.
- Kraftstoffeigenschaften.
- Gaseigenschaften.
- 11. Schäumen.
- Elektrolyten.
- Zähigkeit.
- Zusätze.
- d) Messimg der Schaumneigung.
- Wissenschaftlich.
- Technisch.
- e) Praktische Bedeutung der Schaumneigung.
- 12. Filtration.
- d) Messungen der Filtrationsgeschwindigkeit.
- 13. Adsorption und Flotation.
- a) Definition der Adsorption.
- b) Wesen der Adsorption.
- Oberflächenspannung.
- Grenzflächen- und Adhäsionsspannung.
- Gibbs-Thomsonsches Prinzip.
- Chemosorption.
- Chemosorption von Gasen an festen Stoffen.
- Elektrische Adsorption.
- Die Ostwaldsche Formel.
- Langmuirs Formel.
- Die Volmersche Formel.
- Die reversible Adsorption von Gasen an festen Adsorbentien.
- Adsorption von Rauchen und Nebeln.
- Die gegenseitige Adsorptionsenergie von Flüssigkeiten.
- Wesen von Filmen.
- Spreiten von Flüssigkeiten.
- Die Adsorption flüssiger Stoffe an festen.
- Vollkommenes Benetzen.
- Die Verdrängung einer Flüssigkeit durch eine zweite.
- c) Definition der Flotation.
- d) Wesen der Flotation.
- e) Messungen der Adhäsion, Oberflächenspannung, Benetzung usw.
- Randwinkelmessungen.
- Kapillare Steighöhenmethode zur Messung der Oberflächenspannung.
- Tropfengewichtsmethode zur Messung der Oberflächenspannung.
- Abreißmethoden mit Ring und Platten für Messung der Oberflächenspannung.
- Kapillare Steighöhenmethode zur Messung der Grenzflächenspannung.
- Stalagmometermessung der Grenzflächenspannung.
- Arbeitsmethode mit Ring und Platte.
- f) Praktische Bedeutung von Adhäsion und Benetzung.
- 14. Schmieren.
- ?) Allgemeines.
- ?) Benennung der Reibungsarten und Schmier zustände.
- Grundbegriffe.
- Typen der Reibung.
- Mischformen.
- ?) Hydrodynamische Schmierung.
- ?) Grenzschi cht Schmierung.
- ?) Trockenes Gleiten und Oberflächen von Schmierstellen.
- Trockenes Gleiten.
- Die Rauhigkeit.
- ?) Der technische Schmiervorgang.
- ?) Der Verschleiß.
- ?) Die Reibung.
- c) Einflüsse auf den Schmiervorgang.
- ?) Gleitgeschwindigkeit.
- ?) Rauhigkeit.
- ?) Überzug mit anderen Schichten.
- ?) Atmosphäre der Umgebung.
- d) Messung der Schmiereignung.
- ?) Chemisch-physikalische Verfahren.
- ?) Prüfgeräte und Maschinen.
- B. Chemische Eigenschaften 125.
- 1. Bindungsarten zwischen Atomen und Molekülen.
- Unpolare chemische Bindung.
- Polare chemische Bindung.
- Halbpolare chemische Bindung.
- Die Wertigkeit.
- Höher-molekulare Gebilde.
- Bindung durch Haupt- und Nebenvalenzen.
- Die metallische Bindung.
- 2. Chemischer Aufbau der Kohlenwasserstoffe.
- 3. Die chemische Zusammensetzung des Erdöls und seiner Produkte.
- 4. Allgemeines über chemische Reaktionen.
- Reaktionsgleichgewicht.
- Energetik chemischer Reaktionen.
- Kinetik chemischer Reaktionen.
- Reaktionsordnungen.
- Reaktionen nullter Ordnung.
- Reaktionen erster Ordnung.
- Reaktionen zweiter Ordnung.
- Reaktionen dritter Ordnung.
- Temperatureinfluß auf die Reaktionsgeschwindigkeit.
- Aktivierungsenergie.
- Kettenreaktionen.
- Katalyse.
- Homogene Katalyse.
- Heterogene Katalyse.
- Steigerung der Katalysatorwirkung.
- Hemmung der Katalyse.
- 5. Oxydation.
- c) Einflüsse auf die Oxydation.
- ?) Sauerstoffkonzentration.
- ?) Wandeinflüsse.
- ?) Katalytische Einflüsse.
- Positive Katalyse.
- Negative Katalyse 149..
- ?) Elektrisches Feld.
- ?) Bewegung.
- ?) Messung der Kinetik des Oxydationsvorganges.
- ?) Messung der praktisch störenden Veränderungsprodukte.
- Benzin.
- Transformatorenöle.
- Dampfturbinenöle.
- Schmieröle für Verbrennungsturbinen.
- Motorenöle.
- 6. Zündung und Selbstzündung.
- Zündgrenzen.
- Zündung durch eine äußere Zündquelle.
- c) Einflüsse auf die Selbstzündung.
- ?) Zeit.
- ?) Katalytische Einflüsse (Zusätze).
- Negative Katalyse.
- ?) Sauerstoff- und Kraftstoffkonzentration.
- d) Messung der Zündung und Selbstzündungsneigung.
- e) Praktische Bedeutung der Selbstzündung.
- 7. Die ruhige Verbrennung (Flamme).
- a) Definition der Verbrennung im allgemeinen und der ruhigen Verbrennung (Flamme).
- Flammentemperaturen.
- Die Verbrennungsgeschwindigkeit.
- Stabilität der Flamme.
- Vollständigkeit der Verbrennung.
- c) Einflüsse auf die ruhige Verbrennung.
- ?) Gemischbildung.
- ?) Konzentration von Brennstoff und Luft (Sauerstoff).
- d) Messung der Verbrennung.
- ?) Flammengeschwindigkeit.
- ?) Flammentemperatur.
- ?) Vollständigkeit der Verbrennung.
- Errechnung aus Elementaranalyse.
- Errechnung des Heizwertes.
- Chemische Gasanalyse.
- Physikalische Gas-analyse.
- 8. Die klopfende Verbrennung im Ottomotor.
- a) Definition des Klopfens.
- b) Wesen des, Klopfens.
- Einteilung nach Serruys.
- Begriffsbestimmungen des Coordinating Research Council.
- Formeln zur Erfassung des Klopfeinsatzes.
- c) Einflüsse auf das Klopfen.
- ?) Kraftstoff.
- Wirkung von Klopf bremsen.
- ?) Motorkonstruktion.
- Die Verdichtung.
- Das Hubvolumen.
- Ventilüberschneidung.
- Drehmomentwandler.
- Geteilte Einspritzung.
- Form des Verbrennungsraumes; Lage der Kerzen usw..
- d) Betriebsbedingungen.
- Luftüberschuß.
- Ladedruck.
- Zündzeitpunkt.
- Drehzahl.
- Ladelufttemperatur.
- Luftfeuchtigkeit.
- Sauerstoffgehalt.
- Kühlwassertemperaturänderung.
- Kohleablagerung.
- e) Messung des Klopfens.
- ?) Forschungsmäßige Untersuchung von Stoffeigenschaften.
- ?) Technische Gleichmäßigkeitsprüfung.
- ?) Technische Eignungsprüfung.
- Prüfstandmethoden.
- Straßenoktanzahlbestimmung.
- ?) Hilfsgeräte für die Klopfmessung.
- f) Praktische Bedeutung des Klopfens.
- 9. Die klopfende Verbrennung im Dieselmotor.
- c) Einflüsse auf die Dieselverbrennung.
- d) Messung der Zündwilligkeit.
- ?) Motormessungen.
- ?) Laboratoriumsmäßige Erfassung.
- ?) Hilfsmittel.
- 10. Die Detonation.
- 11. Thermische, katalytische und elektrische Aufspaltung (Kracken).
- Bindungsfestigkeiten.
- Thermische Aufspaltung.
- Die katalytische Krackung.
- Carboniumionreaktionen.
- Elektrische Aufspaltung.
- Atomstrahlung.
- c) Einflüsse auf den Spaltvorgang.
- Die Temperatur.
- Die Zeit.
- Der Druck.
- Die Konstitution.
- Katalysatoren.
- Verdünnung mit inerten Gasen.
- Sauerstoff.
- Die Strömungsgeschwindigkeit.
- 12. Harzbildung und -ablagerung in und aus flüssiger Phase.
- a) Definition der Harzbildung.
- b) Wesen der Harzbildung.
- c) Einflüsse auf die Harzbildung.
- d) Definition der Harzablagerung.
- f) Praktische Bedeutung der Harz ablagerung.
- 13. Ablagerungen aus Gasen.
- Rein anorganische Ablagerungen.
- Gemischte Ablagerungen.
- Rein organische Ablagerungen.
- d) Die Messung der Neigung zur Harzbildung und Korrosion und des Staubgehaltes von Gasen.
- 14. Polymerisation und Kondensation.
- b) Wesen der Polymerisation.
- c) Einflüsse auf die Polymerisation.
- d) Messung der Polymerisation.
- e) Praktische Bedeutung der Polymerisation.
- 15. Schlammbildung und -ablagerung.
- c) Einflüsse auf die Schlammablagerung.
- d) Messung der Schlammbildungsneigung.
- e) Praktische Bedeutung der Schlammablagerung.
- 16. Rückstandsbildung (Verkokung).
- ?) Anorganische Rückstände.
- Die Niedertemperaturablagerung von Asche.
- Die Hochtemperaturablagerung von Asche.
- Rückstandsbildung aus Bleitetraäthyl.
- ?) Organische Rückstände.
- c) Einflüsse auf die Ablagerung fester Rückstände.
- ?) Konstruktion.
- ?) Betriebsbedingungen.
- Anorganische Rückstände.
- Organische Rückstände.
- 17. Korrosion.
- ?) Heißkorrosion.
- ?) Wirkung von Aschebestandteilen.
- ?) Kaltkorrosion.
- ?) Korrosionsschutz.
- ?) Schutz gegen Wasserkorrosion.
- Konzentration.
- Wassergehalt.
- Bewegung.
- C. Physiologische Eigenschaften.
- ?) Einwirkung auf den Menschen.
- Physikalisch bedingte Gesundheitsschädigungen.
- Chemisch bedingte Gesundheitsschädigungen.
- ?) Einwirkung auf Tiere.
- ?) Einwirkung auf Pflanzen.
- I. Kontaktgiftwirkung.
- II. Systematische Giftwirkung.
- c) Einflüsse auf die physiologische Wirkung der Mineralöle.
- d) Messung der physiologischen Wirkung.
- D. Feuergefahr und Brandschutz.
- c) Einflüsse auf die Feuergefährlichkeit.
- d) Messung der Feuergefährlichkeit.
- e) Praktische Bedeutung der Feuergefährlichkeit.
- E. Offizielle Prüfvorschriften für die Eigenschaften von Erdölprodukten.
- Liste von offiziellen Prüfverfahren für Erdölprodukte.
- Anhang: Die Luminometerzahl.
- Literatur.



