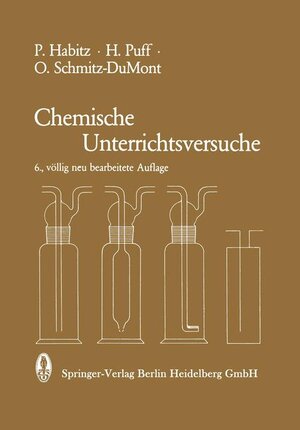
×
![Buchcover ISBN 9783798504936]()
Inhaltsverzeichnis
- I Allgemeines.
- I-1 Abbildungen.
- I-2 Aufbau von Apparaturen.
- I-3 Rohre aus Glas und keramischem Material.
- I-3.1 Glasrohre als Reaktionsrohre.
- I-3.2 Glasrohre zur Verbindung von Apparateteilen.
- I-3.3 Rohre aus keramischem Material.
- I-4 Hähne.
- I-4.1 Quetschhähne.
- I-4.2 Glashähne.
- I-5 Schliffgeräte.
- I-5.1 Allgemeines über Schliffe.
- I-5.2 Schliffstopfen.
- I-5.3 Dichten von Schliffen.
- I-6 Bearbeitung von Glas.
- I-6.1 Biegen von Glasrohren.
- I-6.2 Abschneiden von Glasrohren.
- I-7 Platingeräte.
- I-8 Stopfen.
- I-8.1 Gummistopfen.
- I-8.2 Korkstopfen.
- I-8.3 Asbeststopfen.
- I-8.4 Das Einftihren von Glasrohren in durchbohrte Stopfen.
- I-9 Schläuche.
- I-9.1 Gummischläuche.
- I-9.2 Schläuche aus Kunststoffen.
- I-10 Verbinden von Apparateteilen.
- I-11 Reinigen und Trocknen von Gefäßen.
- I-12 Reinigen und Trocknen von Gasen.
- I-12.1 Allgemeines.
- I-12.2 Trocknen mit flüssigen Reagenzien.
- I-12.3 Trocknen mit festen Reagenzien.
- I-12.4 Trockenmittel für Gase.
- I-13 Behandlung von Flüssigkeiten.
- I-13.1 Aufbewahrung.
- I-13.2 Das Abmessen von Flüssigkeiten.
- I-13.3 Trocknen von Flüssigkeiten.
- I-14 Stromquellen, elektrische Geräte und Schaltungen.
- I-14.1 Stromquellen.
- I-14.2 Meßgeräte.
- I-14.3 Elektrische Schaltungen.
- I-15 Brenner und Öfen.
- I-15.1 Gasbeheizte Geräte.
- I-15.2 Elektrisch beheizte Öfen.
- I-16 Temperaturmessung.
- I-16.1 Flüssigkeitsthermometer.
- I-16.2 Elektrische Thermometer.
- I-17 Spezielle Geräte.
- I-17.1 Thermoskop.
- I-17.2 Waagen.
- I-17.3 Tropftrichter.
- I-17.4 Vakuumpumpen.
- I-17.5 Apparatur zur Vakuumdestillation.
- I-17.6 Kolbenprobergerät.
- I-17.6.1 Beschreibung.
- I-17.6.2 Benutzung und Pflege.
- I-17.6.3 Füllen des Kolbenprobers.
- I-17.6.4 Zusatzgeräte.
- I-17.6.5 Fehlerquellen bei der Benutzung.
- I-17.7 Leitfähigkeitsprüfer.
- I-17.8 Bezugsquellen.
- I-18 Darstellung, Behandlung und Analyse von Gasen.
- I-18.1 Geräte zum Entwickeln von Gasen.
- I-18.2 Auffangen von Gasen.
- I-18.3 Aufbewahren von Gasen.
- I-18.4 Stahlflaschen und Druckdosen.
- I-18.5 Abmessen von Gasen.
- I-18.6 Gasanalyse.
- I-18.7 Reduktion von Gasvolumen auf Normalbedingungen.
- I-18.8 Verflüssigen von Gasen.
- I-18.8.1 Kältemischungen.
- I-18.8.2 Geräte zur Gasverflüssigung.
- I-18.9 Knallgasprobe.
- I-19 Gase für Unterrichtsversuche.
- I-19.1 Wasserstoff.
- I-19.2 Chlor.
- I-19.3 Chlorwasserstoff.
- I-19.4 Sauerstoff.
- I-19.5 Schwefelwasserstoff.
- I-19.6 Schwefeldioxid.
- I-19.7 Stickstoff.
- I-19.8 Ammoniak.
- I-19.9 Distickstoffmonoxid.
- I-19.10 Stickstoffmonoxid.
- I-19.11 Methan.
- I-19.12 Äthan.
- I-19.13 Äthylen (Äthen).
- I-19.14 Acetylen (Äthin).
- I-19.15 Kohlenmonoxid.
- I-19.16 Kohlendioxid.
- I-20 Handhabung gefährlicher Substanzen.
- I-20.1 Quecksilber.
- I-20.2 Natrium.
- I-20.3 Kalium.
- I-20.4 Phosphor.
- I-20.5 Brom.
- I-20.6 Diäthyläther.
- I-20.7 Schwefelkohlenstoff.
- II Allgemeine Chemie.
- II-1 Stöchiometrie.
- II-1.1 Quantitative Wassersynthese bei Überschuß von Wasserstoff oder Sauerstoff.
- II-1.2 Quantitative Wassersynthese in stöchiometrischem Volumenverhältnis.
- II-1.3 Thermische Dissoziation von Schwefelwasserstoff.
- II-1.4 Quantitative Zersetzung von Ammoniak.
- a) Durch elektrische Funken.
- b) Katalytische Zersetzung.
- II-1.5 Quantitative Synthese von Chlorwasserstoff.
- II-1.6 Quantitative Oxidation von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid (Formelbestimmung von Kohlenmonoxid).
- II-1.7 Quantitative Oxidation von Kohlenstoff zu Kohlendioxid (Formelbestimmung von Kohlendioxid).
- II-1.8 Quantitative Oxidation von Schwefel zu Schwefeldioxid (Formelbestimmung von Schwefeldioxid).
- II-1.9 Quantitative Reduktion von Schwefeldioxid.
- II-1.10 Quantitative Reduktion von Stickstoffmonoxid.
- II-1.11 Bestimmung der Äquivalentmassen von Metallen durch Reaktion mit Chlor.
- II-1.12 Bestimmung der Äquivalentmassen von Kupfer und Sauerstoff.
- a) Reduktion von Kupferoxid durch Wasserstoff (Indirekte Synthese des Wassers).
- b) Oxidation des bei der Reduktion erhaltenen Kupfers.
- II-1.13 Sauerstoffentwicklung aus Wasserstoffperoxid und Kaliumpermanganat.
- II-1.14 Kristallwasserbestimmung von Natriumcarbonat.
- II-1.15 Thermische Zersetzung von Kohlenwasserstoffen.
- II-1.16 Quantitative Analyse organischer Verbindungen.
- II-1.16.1 Bestimmung von Kohlenstoff nach Schöniger.
- II-1.16.2 Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff.
- II-1.16.3 Bestimmung von Chlor nach Schöniger.
- II-2 Molmassenbestimmung.
- II-2.1 Bestimmung der Molmasse von Gasen durch Wägung (Molmasse von Methylnitrit).
- II-2.2 Bestimmung der Molmasse von Gasen aus der Ausströmungszeit.
- II-2.3 Bestimmung der Molmasse durch Gefrierpunktserniedrigung.
- a) Lösungsmittel bei Zimmertemperatur fest.
- b) Lösungsmittel bei Zimmertemperatur flüssig.
- II-2.4 Bestimmung der Molmasse durch Siedepunktserhöhung.
- II-3 Bestimmung der Loschmidtschen Konstante.
- II-4 Diffusion und Osmose.
- II-4.1 Diffusion von Wasserstoff durch eine Tonzelle.
- II-4.2 Nachweis des osmotischen Druckes.
- II-5 Kalorimetrie.
- II-5.1 Bestimmung der Wärmekapazität eines Kalorimeters.
- II-5.2 Bestimmung der spezifischen Wärme von Metallen.
- II-5.3 Bestimmung von molaren Lösungsenthalpien.
- a) Lösungsenthalpien von Salzen.
- b) Lösungsenthalpie von Naphthalin in Benzol.
- II-5.4 Bestimmung einer Hydratbildungsenthalpie.
- II-5.5 Bestimmung von Neutralisationsenthalpien.
- II-5.6 Reaktionsenthalpie bei der Bildung eines Niederschlags.
- II-6 Chemisches Gleichgewicht.
- II-6.1 Heterogenes Gleichgewicht: Thermische Zersetzung von Carbonaten.
- II-6.2 Heterogenes Gleichgewicht: Thermische Zersetzung eines Amminkomplexes.
- II-6.3 Boudouard-Gleichgewicht.
- a) Gleichgewicht bei einer bestimmten Temperatur.
- b) Temperaturabhängigkeit des Gleichgewichts.
- II-6.4 Estergleichgewicht (Bildung und Verseifung von Essigsäureäthylester).
- II-6.5 Verschiebung eines Estergleichgewichts durch azeotrope Destillation (Darstellung von Essigsäurebutylester).
- II-7 Reaktionskinetik.
- II-7.1 Zersetzung von Ameisensäure.
- II-7.2 Entfärbung von Kristallviolett.
- II-7.3 Inversion von Saccharose (Rohrzucker).
- II-8 Adsorption.
- II-8.1 Adsorption von Gasen durch Aktivkohle.
- II-8.2 Selektive Adsorption von Stickstoffdioxid.
- II-8.3 Adsorption von Wasserdampf durch Kieselgel.
- II-8.4 Adsorption flüchtiger Lösungsmittel durch Aktivkohle.
- a) Adsorption von Benzol.
- b) Wiedergewinnung des Benzols.
- II-8.5 Adsorption gelöster Farbstoffe durch Aktivkohle.
- II-8.6 Enthrbung von Rohzuckerlösung durch Aktivkohle.
- II-9 Chromatographie und Ionenaustausch.
- II-9.1 Säulenchromatographie.
- a) Trennung anorganischer Kationen.
- b) Trennung organischer Farbstoffe.
- II-9.2 Papierchromatographie.
- II-9.2.1 Rundfiltermethode (Trennung der Farbstoffkomponenten einer Tinte).
- II-9.2.2 Streifenmethode (Trennung von Aminosäuren).
- II-9.2.3 Zylindermethode (Trennung der Farbstoffkomponenten eines Universalindikators).
- II-9.3 Dünnschichtchromatographie.
- a) Trennung von Farbstoffgemischen.
- b) Trennung der Blattfarbstoffe.
- c) Trennung der Hydrolyseprodukte von Rohrzucker.
- d) Trennung von Aminosäuren (zweidimensional).
- II-9.4 Ionenaustauscher (Enthärtung von Wasser).
- II-10 Elektrochemie.
- II-10.1 Ionenleitung.
- II-10.1.1 Elektrolyte und Nichtelektrolyte.
- a) Organische Lösungsmittel und wäßrige Lösungen.
- b) Leitfähigkeit und Ionenkonzentration.
- c) Leitfähigkeit von Salzschmelzen.
- d) Erweichendes und schmelzendes Glas als Elektrolyt.
- II-10.1.2 Ionenwanderung im elektrischen Feld.
- II-10.1.3 Konduktometrische Titration (Leitfähigkeitstitration).
- a) Titration von Salzsäure bzw. Essigsäure mit Natronlauge.
- b) Titration eines Gemisches von Salzsäure und Essigsäure.
- c) Titration von Oxalsäure mit Natronlauge.
- d) Titration einer Bariumhydroxidlösung mit Schwefelsäure.
- II-10.2 Elektrodenpotentiale.
- II-10.2.1 Elektrochemische Spannungsreihe (qualitativ).
- a) Nachweis der Reaktionswärme.
- b) Einordnung einiger Metalle.
- II-10.2.2 Messung von Elektrodenpotentialen.
- II-10.2.3 Konzentrationsabhängigkeit der EMK.
- a) Silberelektrode (Elektroden I. Art).
- b) Silber-Silberchloridelektroden (Elektroden II. Art).
- II-10.2.4 Konzentrationsabhängigkeit des Redoxpotentials Fe3+/Fe2+.
- II-10.2.5 Bestimmung des Löslichkeitsproduktes von Silberchlorid.
- II-10.2.6 Bestimmung des Ionenproduktes von Wasser.
- II-10.2.7 Elektrochemische Spannungsquellen.
- a) Daniell-Element.
- b) Bleiakkumulator.
- II-10.2.8 Potentiometrische Titration.
- II-10.3 Elektrolytische Vorgänge.
- II-10.3.1 Gleichzeitige elektrolytische Abscheidung von Kupfer und Silber (Faradaysche Gesetze).
- II-10.3.2 Bestimmung der Faradaykonstante durch Elektrolyse einer Kaliumjodidlösung.
- II-10.3.3 Bestimmung des Ladungsverhältnisses Cu+/Cu2+.
- II-10.3.4 Zersetzungsspannung einer Kupfersulfatlösung.
- II-10.3.5 Schmelzflußelektrolyse von Lithiumchlorid.
- II-10.3.6 Elektrolyse von Wasser.
- II-10.3.7 Elektrolyse einer Zinksulfatlösung.
- II-10.3.8 Kathodische Reduktion von Sauerstoff zu Wasserstoffperoxid.
- II-10.3.9 Elektrolytische Trennung von Kupfer und Nickel.
- a) Qualitative Trennung.
- b) Quantitative Trennung.
- II-11 Kolloidchemie.
- II-11.1 Silbersol durch elektrische Zerstäubung.
- II-11.2 Silbersol durch Reduktion von Silbernitrat.
- II-11.3 Eisen(III)-hydroxid-Sol.
- II-11.4 Antimon(III)-sulfid-Sol.
- II-11.5 Elektrophorese.
- II-11.6 Kieselsäure-Sol und -Gel.
- II-12 Wasserähnliche Lösungsmittel.
- II-12.1 Reaktionen in flüssigem Ammoniak.
- II-12.2 Titration von Aminen mit Perchlorsäure in Eisessig.
- III Anorganische Chemie.
- III-1 Wasserstoff.
- III-1.1 Wasserstoff aus Wasserdampf und Eisen.
- Eigenschaften von Wasserstoff.
- III-1.2 Wasserstoff aus Wasserdampf und Magnesium.
- III-1.3 Wasser als Verbrennungsprodukt von Wasserstoff.
- III-1.4 Thermische Dissoziation von Wasserdampf.
- III-2 Siebente Hauptgruppe.
- III-2.1 Chlor.
- III-2.1.1 Chlor aus Salzsäure und Kaliumpermanganat.
- Eigenschaften von Chlor.
- III-2.1.2 Chlor aus Salzsäure und Mangan(IV)-oxid.
- III-2.1.3 Chloralkali-Elektrolyse.
- a) Amalgamverfahren.
- b) Glocken- und Diaphragmaverfahren.
- III-2.1.4 Chlor durch Oxidation von Chlorwasserstoff (Deacon-Prozeß).
- III-2.1.5 Reduktion von Chlor durch Wasserdampf (Umkehrung des Deaconprozesses).
- III-2.1.6 Chlorwasserstoff aus den Elementen (Chlorknallgas — Photochemische Reaktion).
- a) Zündung durch Flamme.
- b) Zündung durch Licht.
- III-2.1.7 Chlorwasserstoff aus Natriumchlorid und Schwefelsäure.
- Eigenschaften von Chlorwasserstoff.
- III-2.1.8 Kaliumhypochlorit aus Kaliumcarbonatlösung und Chlor.
- Eigenschaften von Hypochlorit.
- III-2.1.9 Chlorkalk aus Calciumhydroxid und Chlor.
- Eigenschaften von Chlorkalk.
- III-2.1.10 Katalytische Zersetzung von Chlorkalk.
- III-2.1.11 Kaliumchlorat durch Elektrolyse einer Kaliumchloridlösung.
- Eigenschaften von Chlorat.
- III-2.1.12 Kaliumperchlorat durch anodische Oxidation einer Kaliumchloratlösung.
- Eigenschaften von Perchlorat.
- III-2.2 Brom.
- III-2.2.1 Bromwasserstoff aus den Elementen.
- Eigenschaften von Bromwasserstoffsäure.
- III-2.2.2 Bromwasserstoff aus Phosphor, Brom und Wasser.
- Eigenschaften von Bromwasserstoff.
- III-2.2.3 Bromwasserstoff aus Brom und Kohlenwasserstoffen.
- III-2.3 Jod.
- III-2.3.1 Synthese und thermische Dissoziation von Jodwasserstoff.
- Eigenschaften von Jodwasserstoffsäure.
- III-2.3.2 Jodwasserstoff aus Phosphor, Jod und Wasser.
- Eigenschaften von Jodwasserstoff.
- III-3 Sechste Hauptgruppe.
- III-3.1 Sauerstoff.
- III-3.1.1 Sauerstoff durch thermische Zersetzung von Quecksilberoxid.
- III-3.1.2 Sauerstoff aus Kaliumchlorat.
- a) Katalysatorwirkung von Mangan(IV)-oxid.
- b) Darstellung größerer Mengen Sauerstoff.
- Eigenschaften von Sauerstoff.
- III-3.1.3 Sauerstoff aus Bariumperoxid.
- III-3.1.4 Ozon aus Sauerstoff durch elektrische Funken.
- III-3.1.5 Ozon aus Sauerstoff durch stille elektrische Entladung.
- Eigenschaften von Ozon.
- III-3.1.6 Wasserstoffperoxid als primäres Verbrennungsprodukt von Wasserstoff.
- III-3.1.7 Wasserstoffperoxid aus Bariumperoxid und Schwefelsäure.
- Eigenschaften von Wasserstoffperoxid.
- III-3.2 Schwefel.
- III-3.2.1 Polymorphie von Schwefel.
- a) Monokliner Schwefel aus der Schmelze.
- b) Rhombischer Schwefel aus monoklinem durch Umkristallisieren.
- c) Plastischer Schwefel aus der Schmelze.
- III-3.2.2 Synthese und thermische Dissoziation von Schwefelwasserstoff.
- III-3.2.3 Schwefelwasserstoff aus Schwefeleisen und Salzsäure.
- Eigenschaften von Schwefelwasserstoff.
- III-3.2.4 Schwefelwasserstoff aus Schwefel und Kohlenwasserstoffen.
- III-3.2.5 Katalytische Oxidation von Schwefelwasserstoff.
- III-3.2.6 Natriumsulfid aus Natriumsulfat und Kohlenstoff.
- III-3.2.7 Dischwefeldichlorid aus Schwefel und Chlor.
- Eigenschaften von Dischwefeldichlorid.
- III-3.2.8 Schwefeldioxid aus Natriumhydrogensulfit und Schwefelsäure.
- Eigenschaften von flüssigem und gasförmigem Schwefeldioxid.
- III-3.2.9 Reduktion von Schwefeldioxid durch Magnesium.
- III-3.2.10 Sulfurylchlorid aus Schwefeldioxid und Chlor.
- Eigenschaften von Sulfurylchlorid.
- III-3.2.11 Katalytische Oxidation von Schwefeldioxid zu Schwefeltrioxid (Kontaktverfahren).
- III-3.2.12 Schwefelsäure nach dem Bleikammerverfahren.
- Eigenschaften von Schwefelsäure.
- III-3.2.13 Reduktion von Schwefelsäure durch Kohlenstoff.
- III-3.2.14 Kaliumperoxodisulfat durch anodische Oxidation.
- Eigenschaften von Peroxodisulfat.
- III-4 Fünfte Hauptgruppe.
- III-4.1 Stickstoff.
- III-4.1.1 Stickstoff aus Luft durch Bindung des Sauerstoffs an Kupfer.
- III-4.1.2 Stickstoff aus Luft durch Bindung des Sauerstoffs an Phosphor.
- III-4.1.3 Bildung und Zersetzung von Ammoniak (Ammoniak-Synthese).
- III-4.1.4 Ammoniak aus Ammoniaklösung und Kaliumhydroxid.
- Eigenschaften von Ammoniak und Ammoniumsalzen.
- III-4.1.5 Katalytische Oxidation von Ammoniak zu Stickstoffoxiden („Ammoniakverbrennung“).
- III-4.1.6 Oxidation von Ammoniak durch Chrom(VI)-oxid.
- III-4.1.7 Stickstofftrichlorid durch Elektrolyse einer Ammoniumchloridlösung.
- III-4.1.8 Distickstoffmonoxid aus Ammoniumsulfat und Natriumnitrat.
- Eigenschaften von Distickstoffmonoxid.
- III-4.1.9 Synthese von Stickstoffoxiden aus Luft.
- III-4.1.10 Stickstoffmonoxid aus Salpetersäure und Kupfer.
- Eigenschaften von Stickstoffmonoxid.
- III-4.1.11 Distickstofftrioxid aus Salpetersäure und Arsen(III)-oxid.
- Eigenschaften von Distickstofftrioxid.
- III-4.1.12 Stickstoffdioxid (Distickstofftetroxid) durch thermische Zersetzung von Bleinitrat.
- Eigenschaften von Stickstoffdioxid und Distickstofftetroxid.
- III-4.1.13 Salpetersäure aus Kaliumnitrat und Schwefelsäure.
- Eigenschaften von Salpetersäure.
- III-4.1.14 Kaliumnitrit aus Kaliumnitrat.
- Eigenschaften von Nitrit und salpetriger Säure.
- III-4.2 Phosphor.
- III-4.2.1 Darstellung von Phosphor.
- Eigenschaften von Phosphor.
- III-4.2.2 Phosphornachweis nach Mitscherlich.
- III-4.2.3 Umwandlung von rotem in weißen Phosphor.
- III-4.2.4 Umwandlung von weißem in roten Phosphor.
- III-4.2.5 Verbrennung von Phosphor unter Wasser.
- III-4.2.6 Phosphorwasserstoffe (Mono- und Diphosphan) aus Phosphor und Kalilauge.
- III-4.2.7 Phosphortrichlorid aus Phosphor und Chlor.
- Eigenschaften von Phosphortrichlorid.
- III-4.2.8 Phosphorpentoxid.
- III-4.3 Arsen und Antimon.
- III-4.3.1 Bildung und thermische Zersetzung von Arsenwasserstoff.
- III-4.3.2 Antimon aus Antimonsulfid und Eisen.
- Eigenschaften von Antimon.
- III-4.3.3 Bildung und thermische Zersetzung von Antimonwasserstoff.
- III-5 Vierte Hauptgruppe.
- III-5.1 Kohlenstoff.
- III-5.1.1 Kohlenmonoxid und Kohlendioxid als Verbrennungsprodukte von Kohlenstoff.
- III-5.1.2 Kohlenmonoxid durch Dehydratisierung von Ameisensäure.
- III-5.1.3 Oxidation von Kohlenmonoxid durch Wasserdampf.
- III-5.1.4 Reduktion von Kohlendioxid durch Kohlenstoff.
- III-5.1.5 Reduktion von Kohlendioxid durch Magnesium.
- III-5.1.6 Kohlendioxid in der Atemluft.
- a) Beim Menschen.
- b) Bei Pflanzen.
- III-5.2 Silicium.
- III-5.2.1 Monosilan aus Magnesiumsilicid und Salzsäure.
- III-5.2.2 Siliciumtetrafluorid und Hexafluorokieselsäure.
- Eigenschaften von Hexafluorokieselsäure.
- III-5.3 Zinn und Blei.
- III-5.3.1 Blei aus Blei(II)-oxid und Kohlenstoff.
- Eigenschaften von Blei.
- III-6 Dritte Hauptgruppe.
- III-6.1 Aluminium.
- III-6.1.1 Aluminiumchlorid aus Aluminium und Chlor.
- III-6.1.2 Aluminothermie (Darstellung von Metallen durch Reduktion von Oxiden mit Aluminium).
- III-6.1.3 Thermischer Effekt bei der Reaktion von Eisenthermit.
- III-6.1.4 Reaktion von Aluminium mit Natronlauge.
- III-7 Zweite Hauptgruppe.
- III-7.1 Magnesium.
- III-7.1.1 Magnesiumnitrid aus Magnesium und Ammoniak.
- III-7.1.2 Magnesiumnitrid aus Magnesium und Luftstickstoff.
- III-7.2 Calcium.
- III-7.2.1 Calciumhydrid aus Calcium und Wasserstoff.
- Eigenschaften von Calciumhydrid.
- III-7.2.2 Thermische Dissoziation von Calciumcarbonat.
- III-7.2.3 Calciumcarbonat aus Calciumoxid und Kohlendioxid (Umkehrung des Kalkbrennens).
- III-7.2.4 Einwirkung von Kohlendioxid auf Calciumhydroxid (Erhärten von Luftmörtel).
- III-7.2.5 Calciumcarbid aus Calciumoxid und Kohlenstoff.
- III-7.2.6 Calciumcyanamid („Kalkstickstoff“) aus Calciumcarbid und Stickstoff.
- III-7.3 Strontium und Barium.
- III-7.3.1 Bariumsulfid aus Bariumsulfat und Kohlenstoff.
- III-8 Erste Hauptgruppe.
- III-8.1 Lithium.
- III-8.1.1 Lithiumhydrid aus Lithium und Wasserstoff.
- III-8.1.2 Lithiumnitrid aus den Elementen.
- III-8.2 Natrium und Kalium.
- III-8.2.1 Natriumperoxid aus Natrium und Sauerstoff.
- Eigenschaften von Natriumperoxid.
- III-8.2.2 Natriumamid aus Natrium und Ammoniak.
- III-8.2.3 Natriumcarbonat nach dem Ammoniaksoda-Verfahren.
- III-9 Nebengruppen.
- III-9.1 Kupfer und Silber.
- III-9.1.1 Reduktion von Kupfer(II)-oxid durch Kohlenstoff.
- III-9.1.2 Kupfer(I)-sulfid aus Kupfer und Schwefeldampf.
- III-9.2 Zink, Cadmium, Quecksilber.
- III-9.2.1 Oxidation von Zinksulfid (Zinkblende).
- III-9.3 Chrom.
- III-9.3.1 Chrom(III)-chlorid aus Chrom(III)-oxid und Tetrachlorkohlenstoff.
- Eigenschaften von Chrom(III)-chlorid.
- III-9.3.2 Chrom(II)-chlorid durch Reduktion von Chrom(III)-chlorid.
- Eigenschaften von Chrom(II)-Verbindungen.
- III-9.3.3 Alkalische Oxidationsschmelze von Chrom(III)-Verbindungen.
- III-9.4 Mangan.
- III-9.4.1 Alkalische Oxidationsschmelze von Mangan(IV)-oxid.
- Oxidationsstufen des Mangans.
- III-9.4.2 Anodische Oxidation von Mangan zu Permanganat.
- III-9.5 Eisen.
- III-9.5.1 Reduktion von Eisen(III)-oxid durch Kohlenmonoxid.
- III-9.5.2 Reduktion von Eisen(III)-oxid durch Wasserstoff.
- III-9.5.3 Langsame Oxidation von feuchtem Eisen.
- III-9.5.4 Eisen(II)-chlorid aus Eisen und Chlorwasserstoff.
- III-9.5.5 Eisen(II)-hydrogencarbonat.
- III-9.5.6 Magnetische Eigenschaften von Eisenverbindungen.
- III-9.6 Nickel.
- III-9.6.1 Nickeltetracarbonyl aus Nickel und Kohlenmonoxid.
- IV Organische Chemie.
- IV-1 Kohlenwasserstoffe.
- IV-1.1 Alkane aus Alkylhalogeniden (Synthese nach Wurtz).
- IV-1.2 Methan aus Natriumacetat und Natronkalk.
- Eigenschaften von Methan.
- IV-1.3 Explosion von Methan-Luftgemischen.
- IV-1.4 Entstehung von Methan bei der Zersetzung pflanzlicher Stoffe.
- IV-1.5 Äthan durch Elektrolyse einer Natriumacetat-Lösung.
- IV-1.6 Äthan durch Hydrolyse von Äthylmagnesiumbromid.
- IV-1.7 Äthylen (Äthen) aus Athanol.
- Eigenschaften von Äthylen.
- a) Dehydratisierung durch konz. Schwefelsäure.
- b) Katalytische Dehydratisierung.
- IV-1.8 Acetylen (Äthin) aus den Elementen.
- IV-1.9 Acetylen (Äthin) aus Methan.
- a) Bei unvollständiger Verbrennung.
- b) Bei thermischer Zersetzung.
- IV-1.10 Acetylen (Äthin) aus Calciumcarbid und Wasser.
- Eigenschaften von Acetylen.
- IV-1.11 Katalytische Hydrierung von Äthylen (Äthen).
- IV-1.12 Trockene Destillation von Steinkohle.
- IV-1.13 Trockene Destillation von Holz.
- IV-1.14 Crackung von Paraffinöl.
- IV-2 Halogenkohlenwasserstoffe.
- IV-2.1 Chlorierung von Methan.
- IV-2.2 Dichloräthan aus Äthylen (Äthen) und Chlor.
- IV-2.3 Quantitative Bromierung von Acetylen (Äthin).
- IV-2.4 Bromierung von Toluol.
- a) Bromierung am Ring.
- b) Bromierung der Seitenkette.
- IV-2.5 Monochloräthan (Äthylchlorid) aus Äthanol und Salzsäure.
- IV-2.6 Jodoform durch Elektrolyse.
- IV-3 Alkohole, Ester, Äther.
- IV-3.1 Alkoholische Gärung.
- Eigenschaften von Äthanol.
- IV-3.2 Quantitative Umsetzung von Äthanol mit Natrium.
- IV-3.3 Ester aus Carbonsäure und Alkohol.
- IV-3.4 Salpetrigsäure-äthylester (Äthylnitrit).
- Eigenschaften von Äthylnitrit.
- IV-3.5 Cellulosenitrat („Nitrocellulose“) aus Cellulose und Salpetersäure.
- IV-3.6 Diäthyläther aus Äthanol.
- IV-4 Aldehyde und Ketone.
- IV-4.1 Formaldehyd durch katalytische Oxidation von Methanol.
- Eigenschaften von Formaldehyd.
- IV-4.2 Acetaldehyd durch Anlagerung von Wasser an Acetylen.
- Eigenschaften von Acetaldehyd.
- IV-4.3 Quantitative Oxidation von Acetaldehyd.
- IV-4.4 Aceton aus Essigsäure.
- IV-4.5 Aceton durch thermische Spaltung von Calciumacetat.
- Eigenschaften von Aceton.
- IV-4.6 Aceton durch Oxidation von Isopropanol.
- a) Oxidation durch Dichromat.
- b) Oxidation durch Sauerstoff.
- IV-5 Carbonsäuren und Säurederivate.
- IV-5.1 Natriumformiat aus Kohlenmonoxid und Natriumhydroxid.
- IV-5.2 Essigsäure aus Natriumacetat und Schwefelsäure.
- Eigenschaften von konz. Essigsäure.
- IV-5.3 Carbonsäuren durch Oxidation von primären Alkoholen.
- IV-5.4 Natriumoxalat durch thermische Spaltung von Natriumformiat.
- IV-5.5 Acetylchlorid aus Essigsäure und Phosphortrichlorid.
- IV-5.6 Acetanilid aus Acetylchlorid und Anilin.
- IV-5.7 Verseifung eines Fettes.
- IV-5.8 Katalytische Hydrierung eines ungesättigten Fettes.
- IV-5.9 Bestimmung der Jodzahl von Fetten.
- IV-6 Organische Stickstoffverbindungen.
- IV-6.1 Nitrierung aromatischer Kohlenwasserstoffe.
- IV-6.2 Anilin durch kathodische Reduktion von Nitrobenzol.
- IV-6.3 Anilin durch Reduktion von Nitrobenzol mit Wasserstoff.
- IV-6.4 Diazotierung und Kupplung.
- a) Diazotierung von Anilin.
- b) Kupplung zu Azofarbstoffen.
- IV-6.5 Quantitative Bestimmung von Amino-Gruppen mit salpetriger Säure.
- IV-6.6 Harnstoff.
- IV-6.6.1 Harnstoff aus Ammoniumcyanat (Harnstoffsynthese nach Wöhler).
- Eigenschaften von Harnstoff.
- IV-6.6.2 Quantitative Zersetzung von Harnstoff mit Hypobromit.
- IV-6.6.3 Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
- IV-6.7 Titration von Aminosäuren mit Kalilauge.
- IV-7 Polymere Verbindungen (Kunststoffe).
- IV-7.1 Polyamid (Nylon) aus Sebacinsäuredichlorid und Hexamethylendiamin.
- a) Sebacinsäuredichlorid aus Sebacinsäure und Phosphortrichlorid.
- b) Polykondensation.
- IV-7.2 Thioplast (kautschukähnlicher Kunststoff) aus Dichloräthan und Natriumpolysulfid.
- IV-7.3 Polykondensation von Phenol mit Formaldehyd (Bakelit).
- IV-7.4 Polykondensation von Harnstoff mit Formaldehyd.
- V Reagenzlösungen und andere Hilfsmittel.
- Namenverzeichnis.




