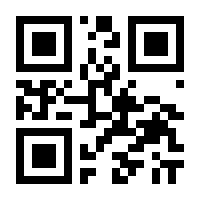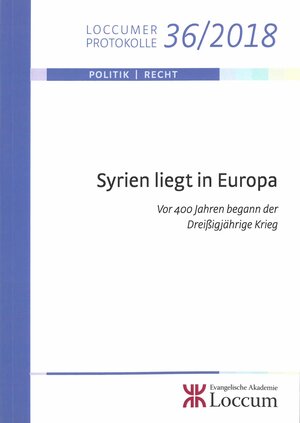
×
![Buchcover ISBN 9783817236183]()
Syrien liegt in Europa
Vor 400 Jahren begann der Dreißigjährige Krieg
herausgegeben von Stephan Schaede und Karlies AbmeierInhalt
Karlies Abmeier und Stephan Schaede Vorwort
Martin Tamcke Konfessionelle und religiöse Kriege, Konflikte und Spannungen im syrischen Raum. Ein historisches Panorama
Dieter Breuer Friedenskonzepte in literarischen Texten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Harald Suermann Religiöse Positionen der Christen im Kontext der religiösen Propaganda in Syrien und im Irak
Christian Mühling Wie der Dreißigjährige Krieg zum Religionskrieg wurde
Ashti Amir Religiöse Aufladungen und Entladungen in den Konfliktregionen des Nahen und Mittleren Ostens
Holger Böning Vom Krieg erzählen. Das neue Medium Zeitung und die Publizistik während des Dreißigjährigen Krieges
Larissa Bender Mediale Äußerungen als Politikum im Syrienkonflikt
Hendrik Munsonius Vom Religionskonflikt zur Friedensordnung: Der Westfälische Frieden von 1648
Markus Böckenförde Welche rechtspolitischen Interventionen könnten im Syrienkonflikt hilfreich sein?
Christopher Voigt-Goy Die Herausbildung neuer staatlicher Formationen im Zuge des Dreißigjährigen Krieges und ihre religionspolitischen Implikationen
Michael Rohrschneider Kriegsverdichtung und Friedensfähigkeit. Verhandlungstechniken auf dem Weg zum Frieden am Beispiel des Kongresses von Münster und Osnabrück (1643–1649)
Maria-Elisabeth Brunert Erfolgreiche Friedenspolitik im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Der Jülicher Erbfolgestreit (1609–1678) und seine friedliche Beilegung
Patrick Milton Lektionen und Analogien: Lehren für Nahost aus dem Dreißigjährigen Krieg und dem Westfälischen Frieden
Vorwort Syrien liegt in Europa – dieser Titel markiert bündig den doppelten Erkundungsgang der Tagung. Erkundet wurde erstens 400 Jahre nach Beginn und 430 Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges dessen politisch-historische Prägnanz. Erkundet wurde zweitens die analytische Relevanz dieser politisch-historischen Sichtungen für den im Jahr 2018 in sein siebtes Jahr gehenden Syrienkonflikt. Im Fokus der Tagung standen also ein historischer und ein aktueller Kriegsschauplatz mit ihren politisch religiös aufgeladenen Konfliktkonstellationen. So machten sich mit historischer, politologischer, religionshistorischer und literaturwissenschaftlicher Expertise Forschende an die Arbeit, um die neben unter anderen von Herfried Münkler vorgetragene These zu prüfen, dass der Dreißigjährige Krieg als Analysefolie für den Syrienkonflikt dienen könne. Die Frage lautete: Wirft die Analyse eines unter völlig anderen geschichtlichen Bedingungen verlaufenden langjährigen Konfliktes wie des Dreißigjährigen Krieges Ideen für die Beilegung einer aktuellen Auseinandersetzung im Nahen Osten ab? Hilft eine solche Prüfung, den Syrienkonflikt und seine Mechanismen besser zu verstehen? Kann sie vor bestimmten Konfliktlösungsstrategien oder -fantasien warnen? Oder ist ein solcher Vergleich naiv, kurzschlüssig, ja irreführend und nur scheinbar produktiv? In Beitragspaaren, die jeweils die Konstellation des Dreißigjährigen Krieges und des Syrienkonfliktes beleuchteten, wurde diesen zentralen Fragen nachgegangen. Nach einer umfassenden Einführung in das Panorama historisch bedingter und bis heute erkennbarer Linien konfessioneller und religiöser Kriege, Konflikte und Spannungen im syrischen Raum skizzierte ein erstes Panel die friedensstiftende und konflikteskalierende Wirkung von Sprache und Kommunikation in Syrien sowie während des Dreißigjährigen Krieges. Ein zweites Panel exponierte die jeweiligen religionspolitischen Konturen. Mit welchen Formen und Modellen argumentierten und argumentieren die Parteien vor allem religiös? Ein drittes Panel führte vor Augen, wie literarische Narrationen die Konflikte bearbeiteten und bewältigten. Sodann wurden in der Gegenüberstellung von Dreißigjährigem Krieg und Syrien die Leistung zweier Konfliktlöser aufgerufen, nämlich die des Konfliktlösers Recht und die des Konfliktlösers eines territorialen bzw. staatlichen (Neu)formierungsprozesses. Drei Beiträge boten eine Analyse der Konfliktlösungsstrategien und langwierigen Friedensschlussdynamiken während des Dreißigjährigen Krieges und schätzten – unterschiedlich kritisch – die Relevanz dieser Strategien und Dynamiken für den Syrienkonflikt ein. Der vorliegende Band dokumentiert fast alle Beiträge der Tagung. Leider konnte ein Abendgespräch mit Jörg Armbruster zur Eigenart des Syrienkonfliktes nicht dokumentiert werden. Und Christian Mühling hat seinen Tagungsbeitrag für einen anderen Publikationsort zugesagt, dafür aber einen anderen für die Frage nicht weniger instruktiven Text für diese Dokumentation zur Verfügung gestellt. Die Texte sind dem Genre eines Loccumer Protokollbandes folgend als Vortrags- und Beitragstexte in einer durchaus hohen stilistischen Varianz abgedruckt. Gerade darin mag der besondere Reiz dieser Publikation liegen. So wäre es auch vermessen, in wenigen Quintessenzen zusammenzufassen, was sich durch die Tagungsdiskussion ergab. Weniges sei hier notiert:
Wir danken allen Autorinnen und Autoren dafür, dass sie ihre überarbeiteten Vortragsmanuskripte für die Drucklegung zur Verfügung gestellt haben. Anne Sator sei für das Layout und die Unterstützung der Drucklegung gedankt. Peter Neu hat bei der Durchsicht der Manuskripte keine Mühen gescheut und sich um das zum Teil sehr anspruchsvolle Lektorat verdient gemacht. Zu danken ist schließlich der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie der Bundeszentrale für politische Bildung für den namhaften finanziellen Beitrag zur Tagung.
Berlin/Loccum, im Februar 2020 Karlies Abmeier und Stephan Schaede
Karlies Abmeier und Stephan Schaede Vorwort
Martin Tamcke Konfessionelle und religiöse Kriege, Konflikte und Spannungen im syrischen Raum. Ein historisches Panorama
Dieter Breuer Friedenskonzepte in literarischen Texten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Harald Suermann Religiöse Positionen der Christen im Kontext der religiösen Propaganda in Syrien und im Irak
Christian Mühling Wie der Dreißigjährige Krieg zum Religionskrieg wurde
Ashti Amir Religiöse Aufladungen und Entladungen in den Konfliktregionen des Nahen und Mittleren Ostens
Holger Böning Vom Krieg erzählen. Das neue Medium Zeitung und die Publizistik während des Dreißigjährigen Krieges
Larissa Bender Mediale Äußerungen als Politikum im Syrienkonflikt
Hendrik Munsonius Vom Religionskonflikt zur Friedensordnung: Der Westfälische Frieden von 1648
Markus Böckenförde Welche rechtspolitischen Interventionen könnten im Syrienkonflikt hilfreich sein?
Christopher Voigt-Goy Die Herausbildung neuer staatlicher Formationen im Zuge des Dreißigjährigen Krieges und ihre religionspolitischen Implikationen
Michael Rohrschneider Kriegsverdichtung und Friedensfähigkeit. Verhandlungstechniken auf dem Weg zum Frieden am Beispiel des Kongresses von Münster und Osnabrück (1643–1649)
Maria-Elisabeth Brunert Erfolgreiche Friedenspolitik im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Der Jülicher Erbfolgestreit (1609–1678) und seine friedliche Beilegung
Patrick Milton Lektionen und Analogien: Lehren für Nahost aus dem Dreißigjährigen Krieg und dem Westfälischen Frieden
Vorwort Syrien liegt in Europa – dieser Titel markiert bündig den doppelten Erkundungsgang der Tagung. Erkundet wurde erstens 400 Jahre nach Beginn und 430 Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges dessen politisch-historische Prägnanz. Erkundet wurde zweitens die analytische Relevanz dieser politisch-historischen Sichtungen für den im Jahr 2018 in sein siebtes Jahr gehenden Syrienkonflikt. Im Fokus der Tagung standen also ein historischer und ein aktueller Kriegsschauplatz mit ihren politisch religiös aufgeladenen Konfliktkonstellationen. So machten sich mit historischer, politologischer, religionshistorischer und literaturwissenschaftlicher Expertise Forschende an die Arbeit, um die neben unter anderen von Herfried Münkler vorgetragene These zu prüfen, dass der Dreißigjährige Krieg als Analysefolie für den Syrienkonflikt dienen könne. Die Frage lautete: Wirft die Analyse eines unter völlig anderen geschichtlichen Bedingungen verlaufenden langjährigen Konfliktes wie des Dreißigjährigen Krieges Ideen für die Beilegung einer aktuellen Auseinandersetzung im Nahen Osten ab? Hilft eine solche Prüfung, den Syrienkonflikt und seine Mechanismen besser zu verstehen? Kann sie vor bestimmten Konfliktlösungsstrategien oder -fantasien warnen? Oder ist ein solcher Vergleich naiv, kurzschlüssig, ja irreführend und nur scheinbar produktiv? In Beitragspaaren, die jeweils die Konstellation des Dreißigjährigen Krieges und des Syrienkonfliktes beleuchteten, wurde diesen zentralen Fragen nachgegangen. Nach einer umfassenden Einführung in das Panorama historisch bedingter und bis heute erkennbarer Linien konfessioneller und religiöser Kriege, Konflikte und Spannungen im syrischen Raum skizzierte ein erstes Panel die friedensstiftende und konflikteskalierende Wirkung von Sprache und Kommunikation in Syrien sowie während des Dreißigjährigen Krieges. Ein zweites Panel exponierte die jeweiligen religionspolitischen Konturen. Mit welchen Formen und Modellen argumentierten und argumentieren die Parteien vor allem religiös? Ein drittes Panel führte vor Augen, wie literarische Narrationen die Konflikte bearbeiteten und bewältigten. Sodann wurden in der Gegenüberstellung von Dreißigjährigem Krieg und Syrien die Leistung zweier Konfliktlöser aufgerufen, nämlich die des Konfliktlösers Recht und die des Konfliktlösers eines territorialen bzw. staatlichen (Neu)formierungsprozesses. Drei Beiträge boten eine Analyse der Konfliktlösungsstrategien und langwierigen Friedensschlussdynamiken während des Dreißigjährigen Krieges und schätzten – unterschiedlich kritisch – die Relevanz dieser Strategien und Dynamiken für den Syrienkonflikt ein. Der vorliegende Band dokumentiert fast alle Beiträge der Tagung. Leider konnte ein Abendgespräch mit Jörg Armbruster zur Eigenart des Syrienkonfliktes nicht dokumentiert werden. Und Christian Mühling hat seinen Tagungsbeitrag für einen anderen Publikationsort zugesagt, dafür aber einen anderen für die Frage nicht weniger instruktiven Text für diese Dokumentation zur Verfügung gestellt. Die Texte sind dem Genre eines Loccumer Protokollbandes folgend als Vortrags- und Beitragstexte in einer durchaus hohen stilistischen Varianz abgedruckt. Gerade darin mag der besondere Reiz dieser Publikation liegen. So wäre es auch vermessen, in wenigen Quintessenzen zusammenzufassen, was sich durch die Tagungsdiskussion ergab. Weniges sei hier notiert:
Wir danken allen Autorinnen und Autoren dafür, dass sie ihre überarbeiteten Vortragsmanuskripte für die Drucklegung zur Verfügung gestellt haben. Anne Sator sei für das Layout und die Unterstützung der Drucklegung gedankt. Peter Neu hat bei der Durchsicht der Manuskripte keine Mühen gescheut und sich um das zum Teil sehr anspruchsvolle Lektorat verdient gemacht. Zu danken ist schließlich der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie der Bundeszentrale für politische Bildung für den namhaften finanziellen Beitrag zur Tagung.
Berlin/Loccum, im Februar 2020 Karlies Abmeier und Stephan Schaede