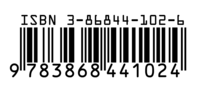Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA): Ein möglicher Trigger des Höhenlungenödems
die Chance zur frühzeitigen Identifizierung gefährdeter Individuen
von Kerstin Nicole Hornung1. Einleitung
1.1. Pathogenese und Epidemiologie des Höhenlungenödems
Das Höhenlungenödem (HAPE – high altitude pulmonary edema) ist ein nicht- kardiales Lungenödem, das gewöhnlich erst ab einer Höhe von 2500 – 3000m auftritt, wobei der niedrigste dokumentierte Fall bei 1800m liegt (persönliche Mitteilung Dr. Bernd Haditsch; Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin). Das HAPE tritt in der Regel nach einer Latenzzeit von 2 – 5 Tagen nach Ankunft in der Höhe auf. Dabei spielt die Aufstiegsgeschwindigkeit ebenso wie die individuelle Anfälligkeit und die maximale Höhe eine entscheidende Rolle.
Neben der individuellen Anfälligkeit für ein HAPE gibt es weitere Faktoren, die das Entstehen eines HAPE begünstigen, wie z. B. eine bestehende oder kurz vorher abgeklungene Infektionskrankheit, vor allem wenn sie im oberen Respirationstrakt lokalisiert ist bzw. war. Ebenfalls gelten Männer und vor allem Kinder als anfälliger.
Bei einer Höhe von 4500m liegt die Prävalenz im allgemeinen unter 0,2%, wenn der Aufstieg innerhalb von 2 – 4 Tagen zurückgelegt wurde. Erfolgt der Aufstieg aber in 22 Stunden, erhöht sich die Prävalenz bereits auf 10% bei Bergsteigern, bei denen noch kein HAPE radiologisch nachgewiesen wurde, und sogar auf 60% bei Bergsteigern, bei denen das der Fall war. Bei einer Höhe von 5500m schwankt die Prävalenz zwischen 2 und 15% in Abhängigkeit von der Aufstiegsgeschwindigkeit. Andererseits können HAPE- anfällige Bergsteiger in Höhen bis zu 7000m aufsteigen, ohne dass sie ein Höhenlungenödem entwickeln, wenn ihr durchschnittlicher Höhengewinn 300 bis maximal 350m pro Tag ab 2000m Höhe beträgt. Als Fazit gilt: jeder kann an einem Höhenlungenödem erkranken – er muss nur schnell genug hoch genug.
Die ersten Symptome eines HAPE sind vermehrte Anstrengungsdyspnoe, trockener Husten und ein am Trainigszustand gemessener inadäquater Leistungsabfall. In den meisten Fällen gehen Symptome der Akuten Bergkrankheit (AMS, s. Kap.1.3.) voraus. Bei Progredienz des Ödems verschlimmert sich der Husten. Eventuell kommt es zu blutig tingiertem, schaumigen Auswurf. Ruhedyspnoe sowie Orthopnoe kommen hinzu. Bei der klinischen Untersuchung zeigen sich Zyanose, Tachypnoe, Tachykardie und eine erhöhte Körpertemperatur, die aber 38,5°C für gewöhnlich nicht überschreitet. Bei der Auskultation lassen sich feinblasige Rasselgeräusche feststellen, die aber auch bei ausgeprägtem radiologischen Befund meist diskret und über dem Mittelfeld lokalisiert sind.
Differentialdiagnostisch müssen Pneumonien, toxische Ödeme und Linksherz-dekompensation bei vermindertem O2- Partialdruck und vorbestehender kardialer Erkrankung ausgeschlossen werden. Dies ist anamnestisch meistens möglich. Im Zweifelsfall handelt es sich um ein HAPE, und der Patient muss in jedem Fall passiv abtransportiert werden bis auf die Höhe, bei der er die letzte beschwerdefreie Nacht verbracht hat oder um mindestens 1000 Höhenmeter [8].
Im Röntgen Thorax eines frühen HAPE- Stadiums zeigt sich eine unregelmäßige periphere Verteilung (s. Abb.1), während es sich im fortgeschrittenen Stadium oder während der Rekonvaleszenz homogener präsentiert. Bei Personen, die nur mit einer unilateralen Pulmonalarterie geboren wurden, entsteht das Ödem immer in der kontralateralen Lungenseite. [.]
HAPE tritt häufig über Nacht auf und kann rasch progredient sein, so dass ein Abstieg zu Fuß, auch in einfachem Gelände, nicht mehr möglich ist. Oft entwickelt sich zusätzlich noch ein Hirnödem, das sich initial lediglich in einer Apathie und Ataxie äußert, das aber innerhalb von 24 Stunden zum Koma führen kann [4, 5, 7].
HAPE weist eine Letalität von 24% auf. (Unter adäquater Therapie ist die Prognose sehr gut, während jeder zweite stirbt, wenn keine Therapie möglich ist)[7].
Pathophysiologie
Der Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes (PAP) gilt als zentraler Mechanismus bei der Entwicklung eines HAPE. Akute und chronische Hypoxie führen über den Euler-Liljestrand-Reflex zur Vasokonstriktion der Lungengefäße. Diese Vasokonstriktion fällt regional heterogen aus, wodurch Gebiete mit Überperfusion und welche mit Unterperfusion entstehen [22, 61]. Im Lungenkreislauf kontrahieren sich auf Hypoxiereiz vor allem die kleinen Arterien (Durchmesser unter 0,8mm) und Arteriolen, was zu dem Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes (PAPs - pulmonary arterial systolic pressure) führt [43]. Dabei trägt die Konstriktion der Pulmonalvenen 20% - 25% zur Gesamt-vasokonstriktion bei, was eine Druckerhöhung aufwärts zu den alveolären Kapillaren bewirkt [61]. Durch diesen erhöhten Kapillardruck wird HAPE auch initial verursacht [42]. Der Normalwert für den Kapillardruck liegt bei 10mmHg. Aufgrund der erhöhten Lungenperfusion und des überschießenden Anstiegs des PAPs steigt der kapilläre Druck. Bei Personen, die ein HAPE entwickelten, wurden Druckwerte von über 20mmHg gemessen [6, 42].
Diese hypoxische Vasokonstriktion wird durch eine Hemmung von K-Kanälen, Membrandepolarisation und einem Anstieg des intrazellulären Kalziums in den glatten Muskelzellen ausgelöst. Daher können auch Kalzium- Antagonisten (Nifedipin) diese hypoxische Vasokonstriktion verhindern [43]. Calcium spielt eine wichtige Rolle für die Regulation des Zellstoffwechsels. So hat es z. B. folgende Effekte auf eine Zelle: Ca2+ Ionen führen zur Ausschüttung von Vesikeln (Exozytose), was in Muskelzellen eine Kontraktion bewirkt [31].
Für die hypoxiebedingte Vasokonstriktion sind interindividuell sehr unterschiedliche Ausprägungsgrade festzustellen: so haben HAPE- anfällige Individuen sowohl in hypobarer Hypoxie als auch bei Anstrengung (Fahrradergometer) unter Normoxie einen signifikant höheren PAPs- Anstieg als HAPE- Resistente, so dass aufgrund mehrerer Studien ein cut- off Wert zur Identifizierung von HAPE- Anfälligen festgelegt wurde [7, 23, 29]. Dieser cut- off liegt bei 41mmHg bei Hypoxie in Ruhe und zeigt eine Sensitivität von 77% und eine Spezifität von 93%. Der Negativ Prädiktive Wert liegt dabei bei 97% [23].
Ebenfalls wurde festgestellt, dass HAPE- anfällige Personen eine deutlich niedrigere NO- Konzentration in ihrer Ausatemluft haben als die nicht- anfälligen [7, 22]. Duplain et al. zeigten, dass anfällige Bergsteiger nach 48 Stunden auf einer Höhe von 4559m 30% weniger NO in ihrer Ausatemluft haben. Auch korreliert die Veränderung des PAPs in der Höhe mit der prozentualen Verringerung der NO- Konzentration [22]. Ebenso zeigte sich, dass durch die Gabe von NO der PAPs gesenkt werden kann, und zwar bei HAPE- anfälligen auf die Druckwerte von HAPE- resistenten Bergsteigern [7, 57].
Diese und weitere Versuchsergebnisse legen eine hypoxiebedingte Störung der endothelialen Funktion bei HAPE- Anfälligen nahe. Dies resultiert in einer verminderten Bioverfügbarkeit von NO und seinem second messenger cGMP, was wahrscheinlich zu einer verstärkten hypoxischen Vasokonstriktion der Pulmonal-gefäße beiträgt. Ebenfalls kann ein verstärkter Blutfluß im Lungenkreislauf eine gestörte endotheliale NO Freisetzung bewirken [7].
NO ist einer der bedeutendsten sogenannten „endothel derived factors“ und wirkt als potenter Vasodilatator und als Gefäßrelaxans. NO bindet an eine lösliche Guanylatzyklase. Die Guanylatzyklase führt zu einer Erhöhung der Konzentration an zyklischem GMP (cGMP) in der Zelle. cGMP aktiviert verschiedene Proteinkinasen, die unter anderem die Absenkung des intrazellulären Kalziums vermitteln, welche zur Relaxation der glatten Gefäß-muskulatur führen. Der Abbau des cGMP erfolgt durch spezifische Phosphodiesterasen [31]. So können Phosphodiesterase- 5- Hemmer, wie Sildenafil (Viagra) oder Tadalafil, die den cGMP- Spiegel im Lungengewebe durch Inhibierung des Abbaus erhöhen, dadurch den PAPs senken und somit die Leistungsfähigkeit in der Höhe verbessern und einem HAPE vorbeugen [7]. Neben einer reduzierten NO- Synthese weisen HAPE- Anfällige weitere Charakteristika auf wie eine geringere Vitalkapazität und damit ein geringeres Lungenvolumen mit reduziertem Gefäßquerschnitt, ein höheres funktionelles Residualvolumen, sowie vermehrte Sympathikusaktivität unter Hypoxie. Diese Mechanismen können zum überschießenden Druckanstieg in der Lunge beitragen [9]. Generell führt Hypoxie beim Menschen zu einem erhöhten Sympathikotonus. Daher kommt es aufgrund anhaltend erhöhter Katecholaminspiegel zu einer Nieder-regulierung der Betarezeptoren und dadurch zur Verminderung der maximalen Herzfrequenz und des Herzminutenvolumens (HMV). Dies kann als kardio-protektiver Mechanismus gewertet werden [43].
In verschiedenen Studien wurden bei Bergsteigern sowohl auf 450m als auch auf 4559m Höhe der PAPs untersucht und eine bronchoalveoläre Lavage (BAL) durchgeführt. In der BAL- Flüssigkeit war die Konzentration von Nitraten und Nitriten bei den HAPE- resistenten Personen stark angestiegen, während sie bei der HAPE- anfälligen Gruppe signifikant abfiel [61], was auf eine verminderte NO- Produktion in der Lunge von HAPE- Prädestinierten hinweist [6]. Weiterhin findet sich in der BAL- Flüssigkeit von HAPE- Anfälligen eine hohe Konzentration an Erythrozyten und Albumin. Allerdings besteht in der Anzahl der Leukozyten, der proinflammatorischen Zytokine, wie Interleukine und TNF alpha, und der Eikosanoide wie Thromboxan, Prostaglandin E2 und Leukotrien B4 kein Unterschied zu HAPE- Resistenten. Erythrozyten treten ab einem PAPs von 60mmHg in den Alveolarraum über, während die Albuminkonzentration bereits ab einem Druck von 35mmHg ansteigt. Daraus ist zu schließen, dass bei einem HAPE durch den erhöhten mikrovaskulären Druck, bedingt durch einen erhöhten PAPs, ein kapilläres Leck entsteht, wobei ein nicht- inflammatorisches, aber proteinreiches und diskret hämorrhagisches Ödem auftritt. Beim beginnenden HAPE ist also durch ein hydrostatisches Leck die alveolokapilläre Permeabilität verändert, besonders für hochmolekulare Proteine [6, 61]. In manchen HAPE- Fällen tritt eine sekundäre inflammatorische Reaktion auf, die dann die kapilläre Permeabilität noch verstärkt [6, 7]. Für die Erhaltung der normalen Permeabilität scheint die NO- Produktion auch von Relevanz zu sein, da bei isoliert perfundierten Kaninchenlungen die Inhibition der NO- Synthese zu einer schnelleren Gewichtszunahme führte als bei Kontrolllungen mit gleichen und konstanten Gefäßdrücken. Die linksventrikuläre Funktion bleibt stets unbeeinträchtigt [61].
Ferner zeigen Bergkranke eine verminderte Urinausscheidung bei erhöhten Plasmaspiegeln von Aldosteron und ADH (Antidiuretisches Hormon), die zu einer Zunahme des intravasalen Volumens führt, was die Ödemneigung und die pulmonale Überperfusion zusätzlich begünstigt [4].
Die Theorie der geringeren Atemantwort auf Hypoxie (HVR) besagt folgendes: Individuelle Unterschiede im Ansprechen der Chemorezeptoren auf Hypoxämie sind beträchtlich und können zu unterschiedlicher Steigerung der Atmung führen. Eine verminderte HVR (hypoxic ventilatory response) verstärkt die alveoläre Hypoxie und soll wesentlich an der überschießenden hypoxisch- pulmonalen Vasokonstriktion beteiligt sein. Bei Personen mit erhöhter Anfälligkeit für AMS und HAPE wurde eine verminderte HVR festgestellt, während die Leistungsfähigkeit in der Höhe mit einem hohen HVR steigt [8].
1. 2. Prävention und Therapie des Höhenlungenödems
Die Mortalität des HAPE liegt bei durchschnittlich 24%. Das beruht darauf, dass im Himalaja, wo ein Abstieg häufig problematisch und keine andere Therapie verfügbar ist, 50% der Erkrankten sterben, während die Prognosen bei adäquaten Therapiemöglichkeiten äußerst günstig sind [7].
Inzwischen haben sich verschiedene Medikamente zur Prophylaxe und Therapie des HAPE etabliert. Die wichtigste Therapie des HAPE ist und bleibt aber der Abstieg sowie die beste präventive Maßnahme der langsame Aufstieg ist [8].
An erster Stelle der Medikamentenliste ist die Gabe von Sauerstoff als eine der wichtigsten therapeutische Maßnahmen zu nennen [8]. Der Kalziumantagonist Nifedipin (20mg retard, sofort und alle 6 h) ist ein anerkanntes Medikament zur Therapie und Prophylaxe des HAPE [39, 43]. Es gilt sogar als Notfalltherapeutikum der Wahl, da es zu einer raschen Senkung des PAPs führt, die Oxygenierung verbessert und sich die Alveolarödeme rasch zurückbilden [10]. Sildenafil wirkt ebenfalls über das NO / cGMP- System, und kann somit, wie in 1.1. bereits beschrieben, auch für diese Zwecke eingesetzt werden. Dabei hat Sildenafil nicht nur auf die Pulmonalarterien sondern auch auf die -venen einen dilatatorischen Effekt. Zusätzlich wird die Gabe von Theophyllin empfohlen, das als unspezifischer Phosphodiesterase- Inhibitor bronchodilatatorische Wirkung zeigt und zugleich die Aktivierung der Entzündungskaskade unterdrückt [39]. Weitere Therapieoptionen würden NO, Iloprost und Beta2- Mimetika (z. B. Salmeterol) bieten. Letztere senken den PAPs, erhöhen die Atemantwort auf Hypoxie (HVR) und verbessern Zell- Zellkontakte und wirken somit präventiv und therapeutisch [6, 7]. Iloprost, ein Prostaglandin, und NO – beide zur inhalativen Anwendung – senken ebenfalls den PAPs. Alle diese drei genannten Medikamente sind aber nicht offiziell für diese Indikation zugelassen.
Dexamethason verbessert den Gasaustausch und die Ventilation und senkt den PAPs signifikant. In einer Dosierung von 2 mal 8mg täglich senkt Dexamethason den PAPs genauso wie Tadalafil und ist in der Prävention von HAPE genau so effektiv. Dexamethason kann die endotheliale NO- Synthetase auf non- transskriptionaler Ebene aktivieren und die Hypoxie- induzierte endotheliale Dysfunktion in den Pulmonalarterien dadurch blockieren, dass die Expression von eNOS erhöht wird [7].
Alternative Möglichkeiten zur medikamentösen Therapie bieten der Überdrucksack als mobile hyperbare Kammer oder die CEPAP- Maske. Bei der CEPAP- Methode (continous expiratory positive airway pressure) atmet der Patient durch eine Maske mit Ventil, was zu einer Druckerhöhung bei der Ausatmung führt. Dadurch wird der Gasaustausch verbessert, und die Sauerstoffsättigung kann damit um 10 – 20 Prozentpunkte gesteigert werden. In einem transportablen Überdrucksack wird quasi ein Abstieg simuliert. Der Patient soll aber nur ein bis zwei Stunden in dem luftdicht verschlossenen Sack verbleiben, da eine längere Verweildauer keine Wirkungssteigerung erzielt und die klinische Überwachung des Patienten im Sack stark eingeschränkt ist. Allerdings ist der positive Effekt dieser Behandlungsmethode zeitlich begrenzt, und ein möglicher Abstieg bzw. Abtransport sollte dadurch nicht verzögert werden. Hauptprobleme dieser Methode sind die richtige Indikationsstellung und die richtige Handhabung, die eine regelmäßige Übung erfordert. Beachtet werden muss unter anderem die Frischluftzufuhr von mindestens 40 l/min, da sonst das CO2 in dem Überdrucksack zu toxischen Konzentrationen akkumuliert [8, 10, 11].
1.3. Höhenerkrankungen und der Lake Louise Score
Akute Bergkrankheit und Höhenhirnödem
Das bisher beschriebene HAPE ist die pulmonale Form der Höhenkrankheit. Davon unterscheidet sich die zerebrale Form der akuten Höhenkrankheit.
Akute Bergkrankheit, kurz ABK oder AMS (acute mountain sickness), tritt vornehmlich in Höhen zwischen 2500 und 6000m und mit einer Latenz von 6 – 12 Stunden auf. Kommt kein weiterer Höhengewinn hinzu, klingt die AMS in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen spontan ab. In seltenen Fällen kann sie sich aber auch zu einem Höhenhirnödem (HACE - high altitude cerebral edema) weiterentwickeln. Die Steigerung von AMS zum seltenen, aber häufig letalen HACE ist fließend. AMS und HACE beruhen wahrscheinlich auf den selben Pathomechanismen. HACE tritt sehr oft in der Nacht auf und kann innerhalb weniger Stunden zum Tode führen. HACE und HAPE treten oft gemeinsam auf, obwohl bezüglich der Pathophysiologie der beiden Krankheiten wesentliche Unterschiede bestehen und ihr Zusammenhang nicht geklärt ist. HACE führt unbehandelt stets zum Tode und weist auch unter Therapie eine Letalität von 40% auf.
Die Prävalenz der AMS ist ebenfalls wie beim HAPE abhängig von der Aufstiegsgeschwindigkeit und einer eventuell vorausgegangenen Akklimatisation. Bei Untersuchungen in den Alpen wurden folgende Daten erhoben: Auf 2850m Höhe (Konkordiahütte) liegt die Prävalenz bei 9% und auf 3150m bei 13%. Nur 600m höher, also auf 3650m Höhe beträgt die Prävalenz bereits 34% und auf 4559m Höhe (Margheritahütte) sogar 53%. Die AMS ist klinisch definiert. Kopfschmerzen, Apathie, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schlafstörungen und periphere Unterhautödeme können auftreten. Wenn mindestens 2 oder 3 dieser Symptome vorliegen, spricht man von einer AMS. Das Auftreten von Ataxie ist das wichtigste Alarmzeichen für den Übergang von einer AMS zum HACE. Zu den weiteren Symptomen, die ein HACE manifestieren, zählen schwerste analgetikaresistente Kopfschmerzen, Schwindelzustände, Lichtscheue, Halluzinationen, neurologische Veränderungen wie Nystagmus oder Nacken-steifigkeit, subfebrile Temperaturen und Bewusstseinseintrübungen bis Koma. Differentialdiagnostisch müssen hier vor allem Migräne oder ein Sonnenstich in Betracht gezogen werden.
Pathophysiologisch spielt hier die Hypoxämie eine bedeutende Rolle, da das Ausmaß der Symptome in der Regel mit dem Grad der Hypoxämie korreliert und die Beschwerden nach Verabreichung von zusätzlichem Sauerstoff rasch verschwinden. Drei Faktoren sind bisher identifiziert, die zur Entstehung einer AMS beitragen könnten: eine zu geringe HVR, die zum Abfall der Sauerstoffsättigung und zur Gewebshypoxie führt, die Natrium- und Wasserretention und eine erhöhte Kapillarpermeabilität, was zur verstärkten Ödembildung führt. (Die Gewebehypoxie wird durch die Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve aufgrund der höhenbedingten Alkalose noch verstärkt.)
Zur Prophylaxe der AMS eignen sich neben der bereits erwähnten Aufstiegsgeschwindigkeit Acetazolamid (Diamox, 2x 250mg pro Tag, Einnahme-beginn 1-2 Tage vor dem Aufstieg) und Dexamethason (4mg, alle 8h). Der Höhenkopfschmerz bei AMS kann mit Analgetika wie Ibuprofen oder Naproxen behandelt werden. Weiterhin sollte bei ausgeprägteren Beschwerden ein Ruhetag eingelegt werden; ggf. Gabe von Antiemetika. Tritt innerhalb von 12 – 24 Stunden keine Besserung ein, muss ein Abstieg um mindestens 1000 Höhenmetern erfolgen. Beim Auftreten von neurologischen Symptomen ist die Gabe von Dexamethason indiziert, initial 4 – 8mg, gefolgt von 4mg alle 6 Stunden [8, 10].
Lake Louise Score (LLS)
Der LLS ist eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode, sowohl um eine vorliegende Höhenkrankheit festzustellen als auch um deren Verlauf zu beobachten. Bevor der LLS sich international als Standard etabliert hat, gab es eine große Streubreite in den Daten zur Prävalenz der AMS in den unterschiedlichen Studien. Um eine standardisierte Beurteilung von Höhenkrankheiten zu ermöglichen, wurde bereits 1983 ein entsprechender Fragebogen entwickelt, der allerdings aus 67 Fragen bestand.
Der LLS wurde erstmals 1991 auf dem Internationalen Lake Louise Hypoxie Symposium vorgestellt. Ein wichtiger Schritt dafür war der Konsensus über eine gemeinsame Definition der Höhenkrankheit. Zwei Jahre später erfolgte eine Überarbeitung mit neuen diagnostischen Kriterien, um die Beurteilung der AMS noch einfacher zu machen. Diese Version ist der heute gebräuchliche Standard zur Quantifizierung von Höhenkrankheiten [41, 56].
1.4. ADMA und seine Funktion
Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) ist ein potenter, nicht- selektiver Inhibitor der NO- Synthetase und vermindert auf diese Weise die endotheliale NO- Produktion, wodurch indirekt eine Vasokonstriktion ausgelöst wird.
ADMA hat sich seit seiner Erstbeschreibung durch Vallence et al. im Jahre 1992 als ein zunehmend interessanter werdender Marker für die Dysfunktion des vaskulären Endothels und als ein kardiovaskulärer Risikofaktor herausgestellt, der sogar als unabhängiger Prädiktor für kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität dienen kann [15, 64].
Es sind 4 Isoformen der NO- Synthetase bekannt. Durch die kompetitive Hemmung der endothelialen Form (eNOS) in der glatten Gefäßmuskulatur wirkt ADMA der NO vermittelten Gefäßdilatation entgegen [13]. ADMA wird unter anderem von Endothelzellen synthetisiert und wirkt somit als ein autokriner Regulator der endothelialen NO- Synthese. Das vom Endothel gebildete NO ist wiederum ein wichtiger Regulator des vaskulären Gefäßtonus aufgrund seiner verschiedenen Effekte auf die Gefäßwand. Neben seiner Eigenschaft als potenter Vasodilatator hemmt NO die Monozytenadhäsion, die Thrombozytenaggregation, die LDL- Oxidation, die Super-oxidradikalfreisetzung und die Proliferation glatter Gefäßmuskelzellen. Da eine Reduzierung der NO- Synthese zur endothelialen Dysfunktion und zur beschleunigten Entwicklung von Atherosklerose führen kann, wird einem erhöhten AMDA- Spiegel ein erhöhtes Risiko für endotheliale Dysfunktion und kardio-vaskuläre Erkrankungen zugeschrieben [14, 64]. Viele weitere Risikofaktoren für kardiovaskuläre Krankheiten wie Hypertonie, Diabetes mellitus TypII, Hypercholesterinämie und Hyperhomocysteinämie werden mit einer verminderten NO- Verfügbarkeit und endothelialer Dysfunktion assoziiert [64]. Bei allen diesen Erkrankungen sowie bei Herzinsuffizienz, KHK, pAVK und chronischer Niereninsuffizienz sowie bei schwangerschaftsinduzierter und Pulmonaler Hypertonie konnten erhöhte ADMA- Spiegel im menschlichen Blut nachgewiesen werden [14, 15].
In einer multivariaten Studie wurde eine direkte Korrelation zwischen der Intima- Media- Dicke der A. carotis und der Plasma- ADMA- Konzentration festgestellt. In einer Studie mit 225 Patienten mit Nierenerkrankung im Endstadium waren das ADMA und das Alter die stärksten Prädiktoren für kardiovaskuläre Ereignisse und die Gesamtsterblichkeit, auch nach der Korrektur für altbekannte und neue Risikofaktoren. Ebenfalls zeigte sich ADMA als stärkster Prädiktor für ein schlechtes Outcome bei schwerkranken Patienten auf Intensivstation: So hatten Patienten mit einem ADMA- Spiegel im obersten Quartil ein 17fach erhöhtes Todesrisiko [64].
Durch die konzentrationsabhängige Hemmung von ADMA kann die NOS ihr eigentliches Substrat, das L-Arginin, nicht verstoffwechseln. In vielen klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass die Gabe von (exogenem) L-Arginin die NO- vermittelten vaskulären Funktionen bei Personen mit erhöhtem ADMA- Spiegel verbessern kann. So könnten erhöhte ADMA- Spiegel der Grund für das „L-Arginin- Paradox“ sein. Das „L-Arginin- Paradox“ beruht auf der Diskrepanz von eben dieser Beobachtung einerseits und andererseits der ausreichend hohen L-Arginin- Konzentrationen - auch im Plasma von kardiovaskulär erkrankten Patienten - die die Michaelis-Menten- Kon-stante der isolierten, gereinigten eNOS um das 15- bis 30fache übersteigt [14, 15]. Wobei in einer anderen Studie belegt wurde, dass bei Patienten mit essentieller Hypertonie, die aber noch keine kardiovaskulären Komplikationen aufwiesen, sowohl ADMA als auch L-Arginin invers mit der endothelialen Funktion korrelieren, und dass die L-Arginin Konzentration direkt mit der ADMA- Konzentration korreliert. Vielleicht ist dieser Anstieg des L-Arginin eine gegenregulatorische Antwort, um die NOS- Hemmung durch ADMA zu kompensieren [49]. Interessanterweise wird die Aminosäure L-Arginin aus Citrullin, dem Abbauprodukt des ADMA, synthetisiert.
Bei der Synthese von ADMA entsteht Homocystein, ein weiterer bekannter kardiovaskulärer Risikofaktor. Das Homocystein kann wiederum zum Anstieg des ADMA- Spiegels führen, da es eine hemmende Wirkung auf die Aktivität des ADMA- abbauenden Enzyms zeigt.
ADMA entsteht in allen Zellen bei den Prozessen der Proteinumwandlung durch die posttranslationelle Veränderung der Aminosäure Arginin. Arginin wird dabei innerhalb eines Proteins von Proteinmethyltransferasen (PRMT), von der 2 Isoformen bestehen, methyliert. Durch die PRMT- I entsteht ADMA, während durch die PRMT- II die isomere Form, das symetrische Dimethylarginin (SDMA), gebildet wird. Die Arginin- Methylierung ist irreversibel, und durch die Proteolyse dieser Proteine entsteht freies ADMA; nur dieses kann eNOS inhibieren. Freies ADMA wird durch die Dimethylarginin- Dymethylaminohydrolase (DDAH) aktiv zu Citrullin und Dimethylamin abgebaut. Die DDAH ist ein im Zytosol lokalisiertes Enzym und kommt vor allem in Leber, Niere und Lunge vor. Von der DDAH gibt es ebenfalls 2 Isoformen (DDAH- I und II) [64]. Die DDAH- I findet sich vornehmlich in Geweben, die die neuronale Form der NOS exprimieren, wohingegen die DDAH- II hauptsächlich in eNOS- exprimierenden Geweben vorherrscht [45]. Ein kleiner Teil des im Plasma befindlichen ADMA wird renal ausgeschieden, der größte Teil, schätzungsweise bis zu 80%, wird aber nach Aufnahme aus dem Blutkreislauf ins Zytosol durch die DDAH abgebaut [64]. Die DDAH- Aktivität und somit der Abbau von ADMA scheint komplexen Regulationsmechanismen zu unterliegen, die noch nicht vollständig aufgeklärt sind [15]. So führt oxidativer Stress, induziert durch TNF alpha oder oxidiertes LDL (oxLDL) zur Reduktion der DDAH- Enzymaktivität. Außer in kultivierten Endothelzellen wurde dies auch in Gewebehomogenaten aus der Aorta, Niere und Leber hyper-cholesterinämischer Kaninchen nachgewiesen. Zusätzlich konnte eine konzen-trationsabhängige Konstriktion isolierter Arteriensegmente demonstriert werden [15]. Änderungen der Nierenfunktion oder eine Hemmung der DDAH- Aktivität, die durch kardiovaskuläre Risikofaktoren ausgelöst werden können, führen zum Ansteigen der ADMA- Plasmaspiegel bei den verschiedensten kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen [14]. Vermutlich entstehen im menschlichen Körper jeden Tag beinahe 300µmol ADMA, von denen fast 250µmol durch die DDAHs metabolisiert werden [1].
Die durchschnittliche Konzentration des ADMA im Plasma beträgt nach einer Studie an 500 gesunden Menschen im Alter von 19 bis 75 Jahren 0,69 µmol/l, wobei 95% der Werte im Bereich zwischen 0,36 und 1,17 µmol/l liegen. Die Bestimmung dieser Werte erfolgte mittels ELISA [58]. Bei Frauen unter 50 konnten deutlich geringere Konzentrationen als bei Frauen über 50 nachgewiesen werden. Männer weisen so einen Unterschied nicht auf.
Eine andere Studie an 726 gesunden Teilnehmern ergab ähnliche Ergebnisse. Der mittlere ADMA- Spiegel im Plasma lag hier bei 0,50 µmol/l und unter Einbeziehung der Werte bis zur 98. Perzentile ergab sich ein Spektrum von 0,35 bis 0, 89 µmol/l. Bestimmt wurden diese Werte allerdings mittels HPLC – Verfahren [64].
1.5. ADMA und das Höhenlungenödem
Akute und chronische Hypoxie führen im Lungenkreislauf zu individuell unterschied-lichen Steigerungen des pulmonalarteriellen Druckes (Euler-Liljestrand-Reflex). Bei vielen Menschen ist diese Reaktion auf Hypoxie überschießend und führt zu massiven Anstiegen des pulmonalarteriellen Druckes mit der Entwicklung eines lebensbedrohenden Höhenlungenödems. Man vermutet eine genetische Prädispo-sition als zugrunde liegende Ursache. Da NO eine Hauptrolle bei der Regulation des pulmonalen Gefäßtonus spielt, macht die Hypothese Sinn, dass erhöhte ADMA- Spiegel ursächlich an der überschießenden pulmonalen Vasokonstriktion beteiligt sind [62].
Nach den nachfolgend genannten Studien finden sich unter hypoxischen Bedingungen erhöhte ADMA- Konzentrationen sowohl durch eine vermehrte Bildung (aufgrund vermehrter Methylierung von proteininkorporiertem Arginin) als auch durch einen verminderten Abbau, und lassen hier einen wesentlichen Schlüssel in der Entstehung des HAPE vermuten. Als eine weitergehende Schlussfolgerung wäre sogar eine direkte Korrelation zwischen dem ADMA- Spiegel und dem pulmonalarteriellen Druck (PAPs) unter Hypoxie denkbar.
Eine Studiengruppe untersuchte das Lungengewebe von Mäusen, die einer dreiwöchigen Hypoxie (10% Sauerstoff) ausgesetzt waren. In den Lungen zeigte sich eine erhöhte PRMT II- Expression, während die anderen PRMT- Isoformen unverändert blieben. Dies war vor allem in Alveolarzellen vom Typ 2 der Fall, die unter normoxischen Bedingungen fast gar keine PRMT exprimieren. Ebenso fanden sich unter hypoxischen Bedingungen erhöhte ADMA- Konzentrationen und das Verhältnis ADMA zu L- Arginin war erhöht. Daraus lässt sich schließen, dass Hypoxie einen potenter Regulator der PRMT II- Expression und der pulmonalen ADMA- Konzentration darstellt. Diese Daten suggerieren, dass die strukturellen und funktionalen Veränderungen unter Hypoxie mit dem Stoffwechsel des ADMA assoziiert sind [75].
Weitere Analysen legen nahe, dass der ADMA- Metabolismus im pulmonalen System signifikant zu zirkulierenden ADMA- und auch SDMA- Konzentrationen beiträgt. Dabei kommt man auch zu dem Ergebnis, dass der pulmonale ADMA- Abbau durch die DDAH I geschieht und dass Niere und Leber komplementäre Wege zur Clearance und metabolischen Umwandlung von zirkulierendem ADMA bereitstellen [20].
Die idiopathische Pulmonale Hypertonie (IPHT) wird ebenfalls mit einer gestörten endogenen NO- Synthese- Störung assoziiert. So konnten Pullamsetti et al. bei Patienten mit IPHT einen 2,2-fach erhöhten ADMA- Spiegel und auch eine 2,7-fach erhöhte SDMA- Konzentration (im Plasma) sowie eine deutlich verminderte DDAH II- Expression im Lungengewebe nachweisen. SDMA und ADMA haben einen synergistischen Effekt, da SDMA als Inhibitor des menschlichen Transportproteins hCAT- 2B mit der L- Arginin- Aufnahme interferiert und auf diese Weise indirekt zur Hemmung der NO- Synthese beiträgt [50].
Vergleichbare Ergebnisse stellten sich bei den Forschungen von Millat et al. heraus, die männliche Ratten einer einwöchigen Hypoxie von 10% Sauerstoff aussetzten und im Lungengewebe die Konzentrationen sowohl von ADMA und DDAH als auch die von eNOS und NO analysierten. Bei der eNOS zeigte sich eine Zunahme um das 2- fache und bei der DDAH eine Reduktion um 37%. Das Volumen von NO verringerte sich jedoch signifikant (um 22,4%). Gleichzeitig war die pulmonale ADMA- Konzentration 2,3 mal so hoch wie bei der Kontrollgruppe unter Normoxie [45]. Aufgrund der dargelegten Studienlage kann gefolgert werden, dass eine NO- Synthesestörung die Entstehung des HAPE begünstigt [57]. In anderen höhen-physiologischen Studien konnte die Senkung des PAP und ein verbesserter Gasaustausch durch die Gabe von Sildenafil gezeigt werden [28, 39, 51] (siehe Kap.1.1 und 1.2). Sollte bei HAPE- anfälligen Personen ursächlich eine ADMA- bedingte NO- Synthesestörung vorliegen, wäre neben dem beschriebenen therapeutischen ein prädiktiv diagnostischer Ansatz möglich.
Ein weiterer Wirkmechanismus, der ADMA und HAPE miteinander in Verbindung bringt, besteht darin, dass die Gabe von ADMA auch eine signifikante Natriumretention verursacht [38], und die Natrium- und Wasserretention zählt zu einem der drei Mechanismen, die über eine verstärkte Ödembildung zur Entstehung einer AMS beitragen können [8].
1.6. Fragestellung und Zielsetzung
In dieser experimentellen Studie werden Grundlagen erforscht. Folgende Fragen sollen beantwortet werden können:
Sollte der ADMA- Spiegel mit der Höhe des PAPs korrelieren, würde ein einfach anwendbarer Parameter zur individuellen Abschätzung der HAPE- Anfälligkeit zur Verfügung stehen. Hierfür ist die Messung des PAPs bislang die einzige Screeningmethode. Allerdings ist die dopplerechokardiographische Bestimmung messmethodisch an das Vorhandensein eines trikuspidalen Refluxes (in bis zu 1/3 der Probanden nicht vorhanden [23, 29]), sowie entsprechendes Gerät und Personal gebunden. Alternativ müsste invasiv mittels Rechtherzkatheter gemessen werden, was sich verständlicherweise verbietet.
1.1. Pathogenese und Epidemiologie des Höhenlungenödems
Das Höhenlungenödem (HAPE – high altitude pulmonary edema) ist ein nicht- kardiales Lungenödem, das gewöhnlich erst ab einer Höhe von 2500 – 3000m auftritt, wobei der niedrigste dokumentierte Fall bei 1800m liegt (persönliche Mitteilung Dr. Bernd Haditsch; Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin). Das HAPE tritt in der Regel nach einer Latenzzeit von 2 – 5 Tagen nach Ankunft in der Höhe auf. Dabei spielt die Aufstiegsgeschwindigkeit ebenso wie die individuelle Anfälligkeit und die maximale Höhe eine entscheidende Rolle.
Neben der individuellen Anfälligkeit für ein HAPE gibt es weitere Faktoren, die das Entstehen eines HAPE begünstigen, wie z. B. eine bestehende oder kurz vorher abgeklungene Infektionskrankheit, vor allem wenn sie im oberen Respirationstrakt lokalisiert ist bzw. war. Ebenfalls gelten Männer und vor allem Kinder als anfälliger.
Bei einer Höhe von 4500m liegt die Prävalenz im allgemeinen unter 0,2%, wenn der Aufstieg innerhalb von 2 – 4 Tagen zurückgelegt wurde. Erfolgt der Aufstieg aber in 22 Stunden, erhöht sich die Prävalenz bereits auf 10% bei Bergsteigern, bei denen noch kein HAPE radiologisch nachgewiesen wurde, und sogar auf 60% bei Bergsteigern, bei denen das der Fall war. Bei einer Höhe von 5500m schwankt die Prävalenz zwischen 2 und 15% in Abhängigkeit von der Aufstiegsgeschwindigkeit. Andererseits können HAPE- anfällige Bergsteiger in Höhen bis zu 7000m aufsteigen, ohne dass sie ein Höhenlungenödem entwickeln, wenn ihr durchschnittlicher Höhengewinn 300 bis maximal 350m pro Tag ab 2000m Höhe beträgt. Als Fazit gilt: jeder kann an einem Höhenlungenödem erkranken – er muss nur schnell genug hoch genug.
Die ersten Symptome eines HAPE sind vermehrte Anstrengungsdyspnoe, trockener Husten und ein am Trainigszustand gemessener inadäquater Leistungsabfall. In den meisten Fällen gehen Symptome der Akuten Bergkrankheit (AMS, s. Kap.1.3.) voraus. Bei Progredienz des Ödems verschlimmert sich der Husten. Eventuell kommt es zu blutig tingiertem, schaumigen Auswurf. Ruhedyspnoe sowie Orthopnoe kommen hinzu. Bei der klinischen Untersuchung zeigen sich Zyanose, Tachypnoe, Tachykardie und eine erhöhte Körpertemperatur, die aber 38,5°C für gewöhnlich nicht überschreitet. Bei der Auskultation lassen sich feinblasige Rasselgeräusche feststellen, die aber auch bei ausgeprägtem radiologischen Befund meist diskret und über dem Mittelfeld lokalisiert sind.
Differentialdiagnostisch müssen Pneumonien, toxische Ödeme und Linksherz-dekompensation bei vermindertem O2- Partialdruck und vorbestehender kardialer Erkrankung ausgeschlossen werden. Dies ist anamnestisch meistens möglich. Im Zweifelsfall handelt es sich um ein HAPE, und der Patient muss in jedem Fall passiv abtransportiert werden bis auf die Höhe, bei der er die letzte beschwerdefreie Nacht verbracht hat oder um mindestens 1000 Höhenmeter [8].
Im Röntgen Thorax eines frühen HAPE- Stadiums zeigt sich eine unregelmäßige periphere Verteilung (s. Abb.1), während es sich im fortgeschrittenen Stadium oder während der Rekonvaleszenz homogener präsentiert. Bei Personen, die nur mit einer unilateralen Pulmonalarterie geboren wurden, entsteht das Ödem immer in der kontralateralen Lungenseite. [.]
HAPE tritt häufig über Nacht auf und kann rasch progredient sein, so dass ein Abstieg zu Fuß, auch in einfachem Gelände, nicht mehr möglich ist. Oft entwickelt sich zusätzlich noch ein Hirnödem, das sich initial lediglich in einer Apathie und Ataxie äußert, das aber innerhalb von 24 Stunden zum Koma führen kann [4, 5, 7].
HAPE weist eine Letalität von 24% auf. (Unter adäquater Therapie ist die Prognose sehr gut, während jeder zweite stirbt, wenn keine Therapie möglich ist)[7].
Pathophysiologie
Der Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes (PAP) gilt als zentraler Mechanismus bei der Entwicklung eines HAPE. Akute und chronische Hypoxie führen über den Euler-Liljestrand-Reflex zur Vasokonstriktion der Lungengefäße. Diese Vasokonstriktion fällt regional heterogen aus, wodurch Gebiete mit Überperfusion und welche mit Unterperfusion entstehen [22, 61]. Im Lungenkreislauf kontrahieren sich auf Hypoxiereiz vor allem die kleinen Arterien (Durchmesser unter 0,8mm) und Arteriolen, was zu dem Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes (PAPs - pulmonary arterial systolic pressure) führt [43]. Dabei trägt die Konstriktion der Pulmonalvenen 20% - 25% zur Gesamt-vasokonstriktion bei, was eine Druckerhöhung aufwärts zu den alveolären Kapillaren bewirkt [61]. Durch diesen erhöhten Kapillardruck wird HAPE auch initial verursacht [42]. Der Normalwert für den Kapillardruck liegt bei 10mmHg. Aufgrund der erhöhten Lungenperfusion und des überschießenden Anstiegs des PAPs steigt der kapilläre Druck. Bei Personen, die ein HAPE entwickelten, wurden Druckwerte von über 20mmHg gemessen [6, 42].
Diese hypoxische Vasokonstriktion wird durch eine Hemmung von K-Kanälen, Membrandepolarisation und einem Anstieg des intrazellulären Kalziums in den glatten Muskelzellen ausgelöst. Daher können auch Kalzium- Antagonisten (Nifedipin) diese hypoxische Vasokonstriktion verhindern [43]. Calcium spielt eine wichtige Rolle für die Regulation des Zellstoffwechsels. So hat es z. B. folgende Effekte auf eine Zelle: Ca2+ Ionen führen zur Ausschüttung von Vesikeln (Exozytose), was in Muskelzellen eine Kontraktion bewirkt [31].
Für die hypoxiebedingte Vasokonstriktion sind interindividuell sehr unterschiedliche Ausprägungsgrade festzustellen: so haben HAPE- anfällige Individuen sowohl in hypobarer Hypoxie als auch bei Anstrengung (Fahrradergometer) unter Normoxie einen signifikant höheren PAPs- Anstieg als HAPE- Resistente, so dass aufgrund mehrerer Studien ein cut- off Wert zur Identifizierung von HAPE- Anfälligen festgelegt wurde [7, 23, 29]. Dieser cut- off liegt bei 41mmHg bei Hypoxie in Ruhe und zeigt eine Sensitivität von 77% und eine Spezifität von 93%. Der Negativ Prädiktive Wert liegt dabei bei 97% [23].
Ebenfalls wurde festgestellt, dass HAPE- anfällige Personen eine deutlich niedrigere NO- Konzentration in ihrer Ausatemluft haben als die nicht- anfälligen [7, 22]. Duplain et al. zeigten, dass anfällige Bergsteiger nach 48 Stunden auf einer Höhe von 4559m 30% weniger NO in ihrer Ausatemluft haben. Auch korreliert die Veränderung des PAPs in der Höhe mit der prozentualen Verringerung der NO- Konzentration [22]. Ebenso zeigte sich, dass durch die Gabe von NO der PAPs gesenkt werden kann, und zwar bei HAPE- anfälligen auf die Druckwerte von HAPE- resistenten Bergsteigern [7, 57].
Diese und weitere Versuchsergebnisse legen eine hypoxiebedingte Störung der endothelialen Funktion bei HAPE- Anfälligen nahe. Dies resultiert in einer verminderten Bioverfügbarkeit von NO und seinem second messenger cGMP, was wahrscheinlich zu einer verstärkten hypoxischen Vasokonstriktion der Pulmonal-gefäße beiträgt. Ebenfalls kann ein verstärkter Blutfluß im Lungenkreislauf eine gestörte endotheliale NO Freisetzung bewirken [7].
NO ist einer der bedeutendsten sogenannten „endothel derived factors“ und wirkt als potenter Vasodilatator und als Gefäßrelaxans. NO bindet an eine lösliche Guanylatzyklase. Die Guanylatzyklase führt zu einer Erhöhung der Konzentration an zyklischem GMP (cGMP) in der Zelle. cGMP aktiviert verschiedene Proteinkinasen, die unter anderem die Absenkung des intrazellulären Kalziums vermitteln, welche zur Relaxation der glatten Gefäß-muskulatur führen. Der Abbau des cGMP erfolgt durch spezifische Phosphodiesterasen [31]. So können Phosphodiesterase- 5- Hemmer, wie Sildenafil (Viagra) oder Tadalafil, die den cGMP- Spiegel im Lungengewebe durch Inhibierung des Abbaus erhöhen, dadurch den PAPs senken und somit die Leistungsfähigkeit in der Höhe verbessern und einem HAPE vorbeugen [7]. Neben einer reduzierten NO- Synthese weisen HAPE- Anfällige weitere Charakteristika auf wie eine geringere Vitalkapazität und damit ein geringeres Lungenvolumen mit reduziertem Gefäßquerschnitt, ein höheres funktionelles Residualvolumen, sowie vermehrte Sympathikusaktivität unter Hypoxie. Diese Mechanismen können zum überschießenden Druckanstieg in der Lunge beitragen [9]. Generell führt Hypoxie beim Menschen zu einem erhöhten Sympathikotonus. Daher kommt es aufgrund anhaltend erhöhter Katecholaminspiegel zu einer Nieder-regulierung der Betarezeptoren und dadurch zur Verminderung der maximalen Herzfrequenz und des Herzminutenvolumens (HMV). Dies kann als kardio-protektiver Mechanismus gewertet werden [43].
In verschiedenen Studien wurden bei Bergsteigern sowohl auf 450m als auch auf 4559m Höhe der PAPs untersucht und eine bronchoalveoläre Lavage (BAL) durchgeführt. In der BAL- Flüssigkeit war die Konzentration von Nitraten und Nitriten bei den HAPE- resistenten Personen stark angestiegen, während sie bei der HAPE- anfälligen Gruppe signifikant abfiel [61], was auf eine verminderte NO- Produktion in der Lunge von HAPE- Prädestinierten hinweist [6]. Weiterhin findet sich in der BAL- Flüssigkeit von HAPE- Anfälligen eine hohe Konzentration an Erythrozyten und Albumin. Allerdings besteht in der Anzahl der Leukozyten, der proinflammatorischen Zytokine, wie Interleukine und TNF alpha, und der Eikosanoide wie Thromboxan, Prostaglandin E2 und Leukotrien B4 kein Unterschied zu HAPE- Resistenten. Erythrozyten treten ab einem PAPs von 60mmHg in den Alveolarraum über, während die Albuminkonzentration bereits ab einem Druck von 35mmHg ansteigt. Daraus ist zu schließen, dass bei einem HAPE durch den erhöhten mikrovaskulären Druck, bedingt durch einen erhöhten PAPs, ein kapilläres Leck entsteht, wobei ein nicht- inflammatorisches, aber proteinreiches und diskret hämorrhagisches Ödem auftritt. Beim beginnenden HAPE ist also durch ein hydrostatisches Leck die alveolokapilläre Permeabilität verändert, besonders für hochmolekulare Proteine [6, 61]. In manchen HAPE- Fällen tritt eine sekundäre inflammatorische Reaktion auf, die dann die kapilläre Permeabilität noch verstärkt [6, 7]. Für die Erhaltung der normalen Permeabilität scheint die NO- Produktion auch von Relevanz zu sein, da bei isoliert perfundierten Kaninchenlungen die Inhibition der NO- Synthese zu einer schnelleren Gewichtszunahme führte als bei Kontrolllungen mit gleichen und konstanten Gefäßdrücken. Die linksventrikuläre Funktion bleibt stets unbeeinträchtigt [61].
Ferner zeigen Bergkranke eine verminderte Urinausscheidung bei erhöhten Plasmaspiegeln von Aldosteron und ADH (Antidiuretisches Hormon), die zu einer Zunahme des intravasalen Volumens führt, was die Ödemneigung und die pulmonale Überperfusion zusätzlich begünstigt [4].
Die Theorie der geringeren Atemantwort auf Hypoxie (HVR) besagt folgendes: Individuelle Unterschiede im Ansprechen der Chemorezeptoren auf Hypoxämie sind beträchtlich und können zu unterschiedlicher Steigerung der Atmung führen. Eine verminderte HVR (hypoxic ventilatory response) verstärkt die alveoläre Hypoxie und soll wesentlich an der überschießenden hypoxisch- pulmonalen Vasokonstriktion beteiligt sein. Bei Personen mit erhöhter Anfälligkeit für AMS und HAPE wurde eine verminderte HVR festgestellt, während die Leistungsfähigkeit in der Höhe mit einem hohen HVR steigt [8].
1. 2. Prävention und Therapie des Höhenlungenödems
Die Mortalität des HAPE liegt bei durchschnittlich 24%. Das beruht darauf, dass im Himalaja, wo ein Abstieg häufig problematisch und keine andere Therapie verfügbar ist, 50% der Erkrankten sterben, während die Prognosen bei adäquaten Therapiemöglichkeiten äußerst günstig sind [7].
Inzwischen haben sich verschiedene Medikamente zur Prophylaxe und Therapie des HAPE etabliert. Die wichtigste Therapie des HAPE ist und bleibt aber der Abstieg sowie die beste präventive Maßnahme der langsame Aufstieg ist [8].
An erster Stelle der Medikamentenliste ist die Gabe von Sauerstoff als eine der wichtigsten therapeutische Maßnahmen zu nennen [8]. Der Kalziumantagonist Nifedipin (20mg retard, sofort und alle 6 h) ist ein anerkanntes Medikament zur Therapie und Prophylaxe des HAPE [39, 43]. Es gilt sogar als Notfalltherapeutikum der Wahl, da es zu einer raschen Senkung des PAPs führt, die Oxygenierung verbessert und sich die Alveolarödeme rasch zurückbilden [10]. Sildenafil wirkt ebenfalls über das NO / cGMP- System, und kann somit, wie in 1.1. bereits beschrieben, auch für diese Zwecke eingesetzt werden. Dabei hat Sildenafil nicht nur auf die Pulmonalarterien sondern auch auf die -venen einen dilatatorischen Effekt. Zusätzlich wird die Gabe von Theophyllin empfohlen, das als unspezifischer Phosphodiesterase- Inhibitor bronchodilatatorische Wirkung zeigt und zugleich die Aktivierung der Entzündungskaskade unterdrückt [39]. Weitere Therapieoptionen würden NO, Iloprost und Beta2- Mimetika (z. B. Salmeterol) bieten. Letztere senken den PAPs, erhöhen die Atemantwort auf Hypoxie (HVR) und verbessern Zell- Zellkontakte und wirken somit präventiv und therapeutisch [6, 7]. Iloprost, ein Prostaglandin, und NO – beide zur inhalativen Anwendung – senken ebenfalls den PAPs. Alle diese drei genannten Medikamente sind aber nicht offiziell für diese Indikation zugelassen.
Dexamethason verbessert den Gasaustausch und die Ventilation und senkt den PAPs signifikant. In einer Dosierung von 2 mal 8mg täglich senkt Dexamethason den PAPs genauso wie Tadalafil und ist in der Prävention von HAPE genau so effektiv. Dexamethason kann die endotheliale NO- Synthetase auf non- transskriptionaler Ebene aktivieren und die Hypoxie- induzierte endotheliale Dysfunktion in den Pulmonalarterien dadurch blockieren, dass die Expression von eNOS erhöht wird [7].
Alternative Möglichkeiten zur medikamentösen Therapie bieten der Überdrucksack als mobile hyperbare Kammer oder die CEPAP- Maske. Bei der CEPAP- Methode (continous expiratory positive airway pressure) atmet der Patient durch eine Maske mit Ventil, was zu einer Druckerhöhung bei der Ausatmung führt. Dadurch wird der Gasaustausch verbessert, und die Sauerstoffsättigung kann damit um 10 – 20 Prozentpunkte gesteigert werden. In einem transportablen Überdrucksack wird quasi ein Abstieg simuliert. Der Patient soll aber nur ein bis zwei Stunden in dem luftdicht verschlossenen Sack verbleiben, da eine längere Verweildauer keine Wirkungssteigerung erzielt und die klinische Überwachung des Patienten im Sack stark eingeschränkt ist. Allerdings ist der positive Effekt dieser Behandlungsmethode zeitlich begrenzt, und ein möglicher Abstieg bzw. Abtransport sollte dadurch nicht verzögert werden. Hauptprobleme dieser Methode sind die richtige Indikationsstellung und die richtige Handhabung, die eine regelmäßige Übung erfordert. Beachtet werden muss unter anderem die Frischluftzufuhr von mindestens 40 l/min, da sonst das CO2 in dem Überdrucksack zu toxischen Konzentrationen akkumuliert [8, 10, 11].
1.3. Höhenerkrankungen und der Lake Louise Score
Akute Bergkrankheit und Höhenhirnödem
Das bisher beschriebene HAPE ist die pulmonale Form der Höhenkrankheit. Davon unterscheidet sich die zerebrale Form der akuten Höhenkrankheit.
Akute Bergkrankheit, kurz ABK oder AMS (acute mountain sickness), tritt vornehmlich in Höhen zwischen 2500 und 6000m und mit einer Latenz von 6 – 12 Stunden auf. Kommt kein weiterer Höhengewinn hinzu, klingt die AMS in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen spontan ab. In seltenen Fällen kann sie sich aber auch zu einem Höhenhirnödem (HACE - high altitude cerebral edema) weiterentwickeln. Die Steigerung von AMS zum seltenen, aber häufig letalen HACE ist fließend. AMS und HACE beruhen wahrscheinlich auf den selben Pathomechanismen. HACE tritt sehr oft in der Nacht auf und kann innerhalb weniger Stunden zum Tode führen. HACE und HAPE treten oft gemeinsam auf, obwohl bezüglich der Pathophysiologie der beiden Krankheiten wesentliche Unterschiede bestehen und ihr Zusammenhang nicht geklärt ist. HACE führt unbehandelt stets zum Tode und weist auch unter Therapie eine Letalität von 40% auf.
Die Prävalenz der AMS ist ebenfalls wie beim HAPE abhängig von der Aufstiegsgeschwindigkeit und einer eventuell vorausgegangenen Akklimatisation. Bei Untersuchungen in den Alpen wurden folgende Daten erhoben: Auf 2850m Höhe (Konkordiahütte) liegt die Prävalenz bei 9% und auf 3150m bei 13%. Nur 600m höher, also auf 3650m Höhe beträgt die Prävalenz bereits 34% und auf 4559m Höhe (Margheritahütte) sogar 53%. Die AMS ist klinisch definiert. Kopfschmerzen, Apathie, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schlafstörungen und periphere Unterhautödeme können auftreten. Wenn mindestens 2 oder 3 dieser Symptome vorliegen, spricht man von einer AMS. Das Auftreten von Ataxie ist das wichtigste Alarmzeichen für den Übergang von einer AMS zum HACE. Zu den weiteren Symptomen, die ein HACE manifestieren, zählen schwerste analgetikaresistente Kopfschmerzen, Schwindelzustände, Lichtscheue, Halluzinationen, neurologische Veränderungen wie Nystagmus oder Nacken-steifigkeit, subfebrile Temperaturen und Bewusstseinseintrübungen bis Koma. Differentialdiagnostisch müssen hier vor allem Migräne oder ein Sonnenstich in Betracht gezogen werden.
Pathophysiologisch spielt hier die Hypoxämie eine bedeutende Rolle, da das Ausmaß der Symptome in der Regel mit dem Grad der Hypoxämie korreliert und die Beschwerden nach Verabreichung von zusätzlichem Sauerstoff rasch verschwinden. Drei Faktoren sind bisher identifiziert, die zur Entstehung einer AMS beitragen könnten: eine zu geringe HVR, die zum Abfall der Sauerstoffsättigung und zur Gewebshypoxie führt, die Natrium- und Wasserretention und eine erhöhte Kapillarpermeabilität, was zur verstärkten Ödembildung führt. (Die Gewebehypoxie wird durch die Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve aufgrund der höhenbedingten Alkalose noch verstärkt.)
Zur Prophylaxe der AMS eignen sich neben der bereits erwähnten Aufstiegsgeschwindigkeit Acetazolamid (Diamox, 2x 250mg pro Tag, Einnahme-beginn 1-2 Tage vor dem Aufstieg) und Dexamethason (4mg, alle 8h). Der Höhenkopfschmerz bei AMS kann mit Analgetika wie Ibuprofen oder Naproxen behandelt werden. Weiterhin sollte bei ausgeprägteren Beschwerden ein Ruhetag eingelegt werden; ggf. Gabe von Antiemetika. Tritt innerhalb von 12 – 24 Stunden keine Besserung ein, muss ein Abstieg um mindestens 1000 Höhenmetern erfolgen. Beim Auftreten von neurologischen Symptomen ist die Gabe von Dexamethason indiziert, initial 4 – 8mg, gefolgt von 4mg alle 6 Stunden [8, 10].
Lake Louise Score (LLS)
Der LLS ist eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode, sowohl um eine vorliegende Höhenkrankheit festzustellen als auch um deren Verlauf zu beobachten. Bevor der LLS sich international als Standard etabliert hat, gab es eine große Streubreite in den Daten zur Prävalenz der AMS in den unterschiedlichen Studien. Um eine standardisierte Beurteilung von Höhenkrankheiten zu ermöglichen, wurde bereits 1983 ein entsprechender Fragebogen entwickelt, der allerdings aus 67 Fragen bestand.
Der LLS wurde erstmals 1991 auf dem Internationalen Lake Louise Hypoxie Symposium vorgestellt. Ein wichtiger Schritt dafür war der Konsensus über eine gemeinsame Definition der Höhenkrankheit. Zwei Jahre später erfolgte eine Überarbeitung mit neuen diagnostischen Kriterien, um die Beurteilung der AMS noch einfacher zu machen. Diese Version ist der heute gebräuchliche Standard zur Quantifizierung von Höhenkrankheiten [41, 56].
1.4. ADMA und seine Funktion
Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) ist ein potenter, nicht- selektiver Inhibitor der NO- Synthetase und vermindert auf diese Weise die endotheliale NO- Produktion, wodurch indirekt eine Vasokonstriktion ausgelöst wird.
ADMA hat sich seit seiner Erstbeschreibung durch Vallence et al. im Jahre 1992 als ein zunehmend interessanter werdender Marker für die Dysfunktion des vaskulären Endothels und als ein kardiovaskulärer Risikofaktor herausgestellt, der sogar als unabhängiger Prädiktor für kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität dienen kann [15, 64].
Es sind 4 Isoformen der NO- Synthetase bekannt. Durch die kompetitive Hemmung der endothelialen Form (eNOS) in der glatten Gefäßmuskulatur wirkt ADMA der NO vermittelten Gefäßdilatation entgegen [13]. ADMA wird unter anderem von Endothelzellen synthetisiert und wirkt somit als ein autokriner Regulator der endothelialen NO- Synthese. Das vom Endothel gebildete NO ist wiederum ein wichtiger Regulator des vaskulären Gefäßtonus aufgrund seiner verschiedenen Effekte auf die Gefäßwand. Neben seiner Eigenschaft als potenter Vasodilatator hemmt NO die Monozytenadhäsion, die Thrombozytenaggregation, die LDL- Oxidation, die Super-oxidradikalfreisetzung und die Proliferation glatter Gefäßmuskelzellen. Da eine Reduzierung der NO- Synthese zur endothelialen Dysfunktion und zur beschleunigten Entwicklung von Atherosklerose führen kann, wird einem erhöhten AMDA- Spiegel ein erhöhtes Risiko für endotheliale Dysfunktion und kardio-vaskuläre Erkrankungen zugeschrieben [14, 64]. Viele weitere Risikofaktoren für kardiovaskuläre Krankheiten wie Hypertonie, Diabetes mellitus TypII, Hypercholesterinämie und Hyperhomocysteinämie werden mit einer verminderten NO- Verfügbarkeit und endothelialer Dysfunktion assoziiert [64]. Bei allen diesen Erkrankungen sowie bei Herzinsuffizienz, KHK, pAVK und chronischer Niereninsuffizienz sowie bei schwangerschaftsinduzierter und Pulmonaler Hypertonie konnten erhöhte ADMA- Spiegel im menschlichen Blut nachgewiesen werden [14, 15].
In einer multivariaten Studie wurde eine direkte Korrelation zwischen der Intima- Media- Dicke der A. carotis und der Plasma- ADMA- Konzentration festgestellt. In einer Studie mit 225 Patienten mit Nierenerkrankung im Endstadium waren das ADMA und das Alter die stärksten Prädiktoren für kardiovaskuläre Ereignisse und die Gesamtsterblichkeit, auch nach der Korrektur für altbekannte und neue Risikofaktoren. Ebenfalls zeigte sich ADMA als stärkster Prädiktor für ein schlechtes Outcome bei schwerkranken Patienten auf Intensivstation: So hatten Patienten mit einem ADMA- Spiegel im obersten Quartil ein 17fach erhöhtes Todesrisiko [64].
Durch die konzentrationsabhängige Hemmung von ADMA kann die NOS ihr eigentliches Substrat, das L-Arginin, nicht verstoffwechseln. In vielen klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass die Gabe von (exogenem) L-Arginin die NO- vermittelten vaskulären Funktionen bei Personen mit erhöhtem ADMA- Spiegel verbessern kann. So könnten erhöhte ADMA- Spiegel der Grund für das „L-Arginin- Paradox“ sein. Das „L-Arginin- Paradox“ beruht auf der Diskrepanz von eben dieser Beobachtung einerseits und andererseits der ausreichend hohen L-Arginin- Konzentrationen - auch im Plasma von kardiovaskulär erkrankten Patienten - die die Michaelis-Menten- Kon-stante der isolierten, gereinigten eNOS um das 15- bis 30fache übersteigt [14, 15]. Wobei in einer anderen Studie belegt wurde, dass bei Patienten mit essentieller Hypertonie, die aber noch keine kardiovaskulären Komplikationen aufwiesen, sowohl ADMA als auch L-Arginin invers mit der endothelialen Funktion korrelieren, und dass die L-Arginin Konzentration direkt mit der ADMA- Konzentration korreliert. Vielleicht ist dieser Anstieg des L-Arginin eine gegenregulatorische Antwort, um die NOS- Hemmung durch ADMA zu kompensieren [49]. Interessanterweise wird die Aminosäure L-Arginin aus Citrullin, dem Abbauprodukt des ADMA, synthetisiert.
Bei der Synthese von ADMA entsteht Homocystein, ein weiterer bekannter kardiovaskulärer Risikofaktor. Das Homocystein kann wiederum zum Anstieg des ADMA- Spiegels führen, da es eine hemmende Wirkung auf die Aktivität des ADMA- abbauenden Enzyms zeigt.
ADMA entsteht in allen Zellen bei den Prozessen der Proteinumwandlung durch die posttranslationelle Veränderung der Aminosäure Arginin. Arginin wird dabei innerhalb eines Proteins von Proteinmethyltransferasen (PRMT), von der 2 Isoformen bestehen, methyliert. Durch die PRMT- I entsteht ADMA, während durch die PRMT- II die isomere Form, das symetrische Dimethylarginin (SDMA), gebildet wird. Die Arginin- Methylierung ist irreversibel, und durch die Proteolyse dieser Proteine entsteht freies ADMA; nur dieses kann eNOS inhibieren. Freies ADMA wird durch die Dimethylarginin- Dymethylaminohydrolase (DDAH) aktiv zu Citrullin und Dimethylamin abgebaut. Die DDAH ist ein im Zytosol lokalisiertes Enzym und kommt vor allem in Leber, Niere und Lunge vor. Von der DDAH gibt es ebenfalls 2 Isoformen (DDAH- I und II) [64]. Die DDAH- I findet sich vornehmlich in Geweben, die die neuronale Form der NOS exprimieren, wohingegen die DDAH- II hauptsächlich in eNOS- exprimierenden Geweben vorherrscht [45]. Ein kleiner Teil des im Plasma befindlichen ADMA wird renal ausgeschieden, der größte Teil, schätzungsweise bis zu 80%, wird aber nach Aufnahme aus dem Blutkreislauf ins Zytosol durch die DDAH abgebaut [64]. Die DDAH- Aktivität und somit der Abbau von ADMA scheint komplexen Regulationsmechanismen zu unterliegen, die noch nicht vollständig aufgeklärt sind [15]. So führt oxidativer Stress, induziert durch TNF alpha oder oxidiertes LDL (oxLDL) zur Reduktion der DDAH- Enzymaktivität. Außer in kultivierten Endothelzellen wurde dies auch in Gewebehomogenaten aus der Aorta, Niere und Leber hyper-cholesterinämischer Kaninchen nachgewiesen. Zusätzlich konnte eine konzen-trationsabhängige Konstriktion isolierter Arteriensegmente demonstriert werden [15]. Änderungen der Nierenfunktion oder eine Hemmung der DDAH- Aktivität, die durch kardiovaskuläre Risikofaktoren ausgelöst werden können, führen zum Ansteigen der ADMA- Plasmaspiegel bei den verschiedensten kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen [14]. Vermutlich entstehen im menschlichen Körper jeden Tag beinahe 300µmol ADMA, von denen fast 250µmol durch die DDAHs metabolisiert werden [1].
Die durchschnittliche Konzentration des ADMA im Plasma beträgt nach einer Studie an 500 gesunden Menschen im Alter von 19 bis 75 Jahren 0,69 µmol/l, wobei 95% der Werte im Bereich zwischen 0,36 und 1,17 µmol/l liegen. Die Bestimmung dieser Werte erfolgte mittels ELISA [58]. Bei Frauen unter 50 konnten deutlich geringere Konzentrationen als bei Frauen über 50 nachgewiesen werden. Männer weisen so einen Unterschied nicht auf.
Eine andere Studie an 726 gesunden Teilnehmern ergab ähnliche Ergebnisse. Der mittlere ADMA- Spiegel im Plasma lag hier bei 0,50 µmol/l und unter Einbeziehung der Werte bis zur 98. Perzentile ergab sich ein Spektrum von 0,35 bis 0, 89 µmol/l. Bestimmt wurden diese Werte allerdings mittels HPLC – Verfahren [64].
1.5. ADMA und das Höhenlungenödem
Akute und chronische Hypoxie führen im Lungenkreislauf zu individuell unterschied-lichen Steigerungen des pulmonalarteriellen Druckes (Euler-Liljestrand-Reflex). Bei vielen Menschen ist diese Reaktion auf Hypoxie überschießend und führt zu massiven Anstiegen des pulmonalarteriellen Druckes mit der Entwicklung eines lebensbedrohenden Höhenlungenödems. Man vermutet eine genetische Prädispo-sition als zugrunde liegende Ursache. Da NO eine Hauptrolle bei der Regulation des pulmonalen Gefäßtonus spielt, macht die Hypothese Sinn, dass erhöhte ADMA- Spiegel ursächlich an der überschießenden pulmonalen Vasokonstriktion beteiligt sind [62].
Nach den nachfolgend genannten Studien finden sich unter hypoxischen Bedingungen erhöhte ADMA- Konzentrationen sowohl durch eine vermehrte Bildung (aufgrund vermehrter Methylierung von proteininkorporiertem Arginin) als auch durch einen verminderten Abbau, und lassen hier einen wesentlichen Schlüssel in der Entstehung des HAPE vermuten. Als eine weitergehende Schlussfolgerung wäre sogar eine direkte Korrelation zwischen dem ADMA- Spiegel und dem pulmonalarteriellen Druck (PAPs) unter Hypoxie denkbar.
Eine Studiengruppe untersuchte das Lungengewebe von Mäusen, die einer dreiwöchigen Hypoxie (10% Sauerstoff) ausgesetzt waren. In den Lungen zeigte sich eine erhöhte PRMT II- Expression, während die anderen PRMT- Isoformen unverändert blieben. Dies war vor allem in Alveolarzellen vom Typ 2 der Fall, die unter normoxischen Bedingungen fast gar keine PRMT exprimieren. Ebenso fanden sich unter hypoxischen Bedingungen erhöhte ADMA- Konzentrationen und das Verhältnis ADMA zu L- Arginin war erhöht. Daraus lässt sich schließen, dass Hypoxie einen potenter Regulator der PRMT II- Expression und der pulmonalen ADMA- Konzentration darstellt. Diese Daten suggerieren, dass die strukturellen und funktionalen Veränderungen unter Hypoxie mit dem Stoffwechsel des ADMA assoziiert sind [75].
Weitere Analysen legen nahe, dass der ADMA- Metabolismus im pulmonalen System signifikant zu zirkulierenden ADMA- und auch SDMA- Konzentrationen beiträgt. Dabei kommt man auch zu dem Ergebnis, dass der pulmonale ADMA- Abbau durch die DDAH I geschieht und dass Niere und Leber komplementäre Wege zur Clearance und metabolischen Umwandlung von zirkulierendem ADMA bereitstellen [20].
Die idiopathische Pulmonale Hypertonie (IPHT) wird ebenfalls mit einer gestörten endogenen NO- Synthese- Störung assoziiert. So konnten Pullamsetti et al. bei Patienten mit IPHT einen 2,2-fach erhöhten ADMA- Spiegel und auch eine 2,7-fach erhöhte SDMA- Konzentration (im Plasma) sowie eine deutlich verminderte DDAH II- Expression im Lungengewebe nachweisen. SDMA und ADMA haben einen synergistischen Effekt, da SDMA als Inhibitor des menschlichen Transportproteins hCAT- 2B mit der L- Arginin- Aufnahme interferiert und auf diese Weise indirekt zur Hemmung der NO- Synthese beiträgt [50].
Vergleichbare Ergebnisse stellten sich bei den Forschungen von Millat et al. heraus, die männliche Ratten einer einwöchigen Hypoxie von 10% Sauerstoff aussetzten und im Lungengewebe die Konzentrationen sowohl von ADMA und DDAH als auch die von eNOS und NO analysierten. Bei der eNOS zeigte sich eine Zunahme um das 2- fache und bei der DDAH eine Reduktion um 37%. Das Volumen von NO verringerte sich jedoch signifikant (um 22,4%). Gleichzeitig war die pulmonale ADMA- Konzentration 2,3 mal so hoch wie bei der Kontrollgruppe unter Normoxie [45]. Aufgrund der dargelegten Studienlage kann gefolgert werden, dass eine NO- Synthesestörung die Entstehung des HAPE begünstigt [57]. In anderen höhen-physiologischen Studien konnte die Senkung des PAP und ein verbesserter Gasaustausch durch die Gabe von Sildenafil gezeigt werden [28, 39, 51] (siehe Kap.1.1 und 1.2). Sollte bei HAPE- anfälligen Personen ursächlich eine ADMA- bedingte NO- Synthesestörung vorliegen, wäre neben dem beschriebenen therapeutischen ein prädiktiv diagnostischer Ansatz möglich.
Ein weiterer Wirkmechanismus, der ADMA und HAPE miteinander in Verbindung bringt, besteht darin, dass die Gabe von ADMA auch eine signifikante Natriumretention verursacht [38], und die Natrium- und Wasserretention zählt zu einem der drei Mechanismen, die über eine verstärkte Ödembildung zur Entstehung einer AMS beitragen können [8].
1.6. Fragestellung und Zielsetzung
In dieser experimentellen Studie werden Grundlagen erforscht. Folgende Fragen sollen beantwortet werden können:
Sollte der ADMA- Spiegel mit der Höhe des PAPs korrelieren, würde ein einfach anwendbarer Parameter zur individuellen Abschätzung der HAPE- Anfälligkeit zur Verfügung stehen. Hierfür ist die Messung des PAPs bislang die einzige Screeningmethode. Allerdings ist die dopplerechokardiographische Bestimmung messmethodisch an das Vorhandensein eines trikuspidalen Refluxes (in bis zu 1/3 der Probanden nicht vorhanden [23, 29]), sowie entsprechendes Gerät und Personal gebunden. Alternativ müsste invasiv mittels Rechtherzkatheter gemessen werden, was sich verständlicherweise verbietet.