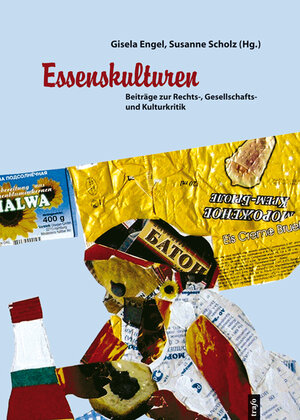
×
![Buchcover ISBN 9783896267269]()
Interssenten für das Thema Essen als gesellschaftliches Kulturphänomen
Essen ist in den letzten Jahren Gegenstand vielfältiger Betrachtungen geworden, vor allem im Bereich der Kulturwissenschaften gibt es über das Essen viel zu sagen. Der Titel dieses Bandes, Essens-Kulturen, betont besonders die kulturellen Semantiken von Essen sowie die Mahlzeit als eine (inter)kulturelle Verständigungsleistung. Die Beiträge beschäftigen sich damit, wie Essen kulturelle Bedeutungen stiftet, wie das gemeinsame Mahl als Schauplatz der Aushandlung intersubjektiver Beziehungen dient, wie Essen kulturelle Erinnerung bewahrt oder etwa Reinheitsgebote ausagiert, die eine Kultur von der anderen abgrenzen. Hier ergibt sich eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten, z. B. im Fragen nach der Produktion von nationalen oder regionalen Stereotypisierungen via Essen und Trinken, nach der Repräsentation von Fremdheitserfahrung und nach der Stiftung von Machtbeziehungen via Essen.
Kollektiv gewendet könnte man sagen: Essen ist ein Schauplatz interkultureller Beziehungen, Essensgewohnheiten sind soziale und kulturelle Distinktionsmerkmale, und zwar sowohl was die Tischmanieren als auch die Zusammensetzung der Speisekarte angeht. Nahrungsethnologisch gesehen kann Essen die Verbundenheit mit heimatlichen Traditionen, Herkunft und Zugehörigkeit ausstellen; in kulturellen Repräsentation verbildlicht oder versprachlicht Essen oft die Kategorien reich und arm, bürgerlich oder nicht-bürgerlich, heimisch oder fremd; es grenzt ab, es verbindet aber auch. Die Offenheit für die Essensgewohnheiten anderer Kulturen weist uns selbst als tolerant aus, und häufig werden Essen und Trinken zum Testfall für Gelingen oder Misslingen kultureller Kommunikation.
Essen, das zeigt auch das rudimentärste Nachdenken über diese Fragen, etabliert dialektische Beziehungen zwischen dem Lokalen und dem Globalen. Die Begeisterung für ethnic food und die damit zur Schau gestellte interkulturelle Kompetenz weist uns aber auch als westlich, gebildet und bürgerlich aus. Connaisseurs auf dem Gebiet des Essens verstehen ihre Kompetenz oder ihren überlegenen Geschmack als Distinktionsmerkmal im Sinn ästhetischer bzw. kulinarischer Urteilskraft (Bourdieu 1982). Auch die ‘Migration’ von Lebensmitteln und die Inkorporation von vormals als ‘ethnisch’ eingrenzbarem Essen in neue Versionen der nationalen Küche – man denke an die ‘Einverleibung’ von indischen und afrikanischem Essensbestandteilen in die sogenannte New British Cuisine – zeigen, wie über Essensgewohnheiten soziale und politische Identitätskonzepte verhandelt werden. Hier repräsentiert die Migration und die identitätspolitische Umwertung des Essens einerseits die politische Ausweitung des Begriffs Britishness auch auf einem sehr materiellen Gebiet, andererseits verweist es auf die erzwungene Mobilität nicht nur des Essens im Zeitalter der Globalisierung. “Food travels”, heißt es bei bell hooks (hooks 1998), Essen durchquert materielle und kulturelle Diskurse, und der Zusammenhang zwischen food migration und imperialen Machtbeziehungen ist im 18. Jahrhundert, in dem Joseph Addison unbedingt die Kartoffeln aus dem Mutterland und die Soße aus der Kolonie zusammenbringen wollte (und damit den Warenfluss und den Tausch für ‘natürlich’ erklärt hat), genauso deutlich wie heute, wo das Essen zu globaler Bewegung quasi gezwungen wird und dahin reist, wo am meisten dafür bezahlt wird, nicht wo es am nötigsten gebraucht wird. In Zeiten der Globalisierung knüpfen sich an die Problematik der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln noch ganz andere Fragen, von der Überfischung der Meere bis zum gentechnisch veränderten Lebensmittel.
Im Zusammenhang mit Essen und Kochen, mit der Beschaffung, Zubereitung und dem Genuss der Nahrung geht es immer auch um Verhaltenskodizes: Wer isst mit wem, wie hat man sich zu benehmen, wer lädt ein, was darf gegessen werden und was nicht. Die Gender-Codierungen dieser Praktiken sind überdeutlich: Essen ist traditionell die Domäne der Frauen; selbst wenn es da zu Umkehrungen kommt, wird dies fast immer als eine Abweichung vom Alltäglichen dargestellt und das Muster damit bestätigt. Dass Essen weiblich codiert ist, ist wiederum eng verknüpft mit einer Vorstellung von öffentlich und privat, von Innerlichkeit und Häuslichkeit als Orten des Rückzugs, der Familie und damit auch des gemeinschaftsstiftenden Mahls.
Schon an diesen wenigen Beispielen zeigt sich, dass man die materiellen und die symbolischen Dimensionen des Essens nicht voneinander trennen kann. Essen ist Teil der material culture, es stellt aber gleichzeitig auch ein semantisches Feld parat, auf dem weiterreichende kulturelle Bedeutungen verhandelt werden. Zu denken wäre hier etwa an die sinnstiftenden ‘Achsen’ roh – gekocht, essbar – nicht-essbar; wohlschmeckend – ekelhaft, Fleisch – Nicht-Fleisch, oder – wenn es um asketische bzw. diätetische Praktiken geht, auch ganz radikal: essen oder nicht essen.
Besonders spannend ist daher die Frage, welche Bedeutung das Essen in kulturellen Repräsentationen einnimmt, z. B. in der Literatur oder im Film, wie Essen hier inszeniert wird, welche Geschlechtercodierungen, Ein- und Ausschlussmechanismen, Machtbeziehungen und kulturellen Reinheitsgebote über das Essen verhandelt werden. In der literarischen Rede vom Essen überblenden sich häufig die Semantiken von Haus, Körper, Privatheit und Innerlichkeit, so dass auch benachbarte Sinnenfreuden imaginär miteinander verwoben werden. Körpertopographisch gesehen könnte man auch sagen, es geht beim Essen um einen Genuss, der mit einer Grenzüberschreitung einhergeht. Wenn wir von Grenzen oder Schwellen reden, rufen wir damit in der Repräsentation immer zugleich zwei Dinge auf: das Tabu und den Exzess. Gerade das Essen scheint sich als metaphorischer Raum für alle Arten von Grenzüberschreitungen, Transgressionen, Tabubrüche und Exzesse zu eignen, zwischen Innen und Außen, zwischen der Ratio und den Trieben. Hier geht es also um lustvolle und/oder angstbesetzte Einverleibung, um das prekäre Spannungsfeld von Subjekt, Objekt und Abjekt, um Grenzverletzungen also, die die jeweiligen kulturellen Regeln neu aushandeln, unterminieren oder auch bestätigen. Im übertragenen Sinn ergeben sich hier Anschlussstellen für andere Lüste: Die imaginative Gleichsetzung von Essen und Sex etwa ist ein eingeführter Topos in unseren Kulturen.
Während bei den bisher genannten immerhin noch die lustvolle Überschreitung der Körpergrenzen als gemeinsamer Nenner fungiert, ist das bei den extremeren Formen von ‘Nahrungsdelinquenz’ (alimentary delinquency) nicht mehr bzw. nur noch über den Kitzel des Horrors vermittelt der Fall. Repräsentationen von Kannibalismus inszenieren die ultimative Transgression aller Reinheitsgebote und Essenstabus: Verschlingen, Einverleiben. Die “Schwarze Küche” (Wördehoff 2000, S. 128) inszeniert die ultimative Umkehrung der nährenden, lustvollen und gemeinschaftsstiftenden Semantiken des Essens.
Kollektiv gewendet könnte man sagen: Essen ist ein Schauplatz interkultureller Beziehungen, Essensgewohnheiten sind soziale und kulturelle Distinktionsmerkmale, und zwar sowohl was die Tischmanieren als auch die Zusammensetzung der Speisekarte angeht. Nahrungsethnologisch gesehen kann Essen die Verbundenheit mit heimatlichen Traditionen, Herkunft und Zugehörigkeit ausstellen; in kulturellen Repräsentation verbildlicht oder versprachlicht Essen oft die Kategorien reich und arm, bürgerlich oder nicht-bürgerlich, heimisch oder fremd; es grenzt ab, es verbindet aber auch. Die Offenheit für die Essensgewohnheiten anderer Kulturen weist uns selbst als tolerant aus, und häufig werden Essen und Trinken zum Testfall für Gelingen oder Misslingen kultureller Kommunikation.
Essen, das zeigt auch das rudimentärste Nachdenken über diese Fragen, etabliert dialektische Beziehungen zwischen dem Lokalen und dem Globalen. Die Begeisterung für ethnic food und die damit zur Schau gestellte interkulturelle Kompetenz weist uns aber auch als westlich, gebildet und bürgerlich aus. Connaisseurs auf dem Gebiet des Essens verstehen ihre Kompetenz oder ihren überlegenen Geschmack als Distinktionsmerkmal im Sinn ästhetischer bzw. kulinarischer Urteilskraft (Bourdieu 1982). Auch die ‘Migration’ von Lebensmitteln und die Inkorporation von vormals als ‘ethnisch’ eingrenzbarem Essen in neue Versionen der nationalen Küche – man denke an die ‘Einverleibung’ von indischen und afrikanischem Essensbestandteilen in die sogenannte New British Cuisine – zeigen, wie über Essensgewohnheiten soziale und politische Identitätskonzepte verhandelt werden. Hier repräsentiert die Migration und die identitätspolitische Umwertung des Essens einerseits die politische Ausweitung des Begriffs Britishness auch auf einem sehr materiellen Gebiet, andererseits verweist es auf die erzwungene Mobilität nicht nur des Essens im Zeitalter der Globalisierung. “Food travels”, heißt es bei bell hooks (hooks 1998), Essen durchquert materielle und kulturelle Diskurse, und der Zusammenhang zwischen food migration und imperialen Machtbeziehungen ist im 18. Jahrhundert, in dem Joseph Addison unbedingt die Kartoffeln aus dem Mutterland und die Soße aus der Kolonie zusammenbringen wollte (und damit den Warenfluss und den Tausch für ‘natürlich’ erklärt hat), genauso deutlich wie heute, wo das Essen zu globaler Bewegung quasi gezwungen wird und dahin reist, wo am meisten dafür bezahlt wird, nicht wo es am nötigsten gebraucht wird. In Zeiten der Globalisierung knüpfen sich an die Problematik der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln noch ganz andere Fragen, von der Überfischung der Meere bis zum gentechnisch veränderten Lebensmittel.
Im Zusammenhang mit Essen und Kochen, mit der Beschaffung, Zubereitung und dem Genuss der Nahrung geht es immer auch um Verhaltenskodizes: Wer isst mit wem, wie hat man sich zu benehmen, wer lädt ein, was darf gegessen werden und was nicht. Die Gender-Codierungen dieser Praktiken sind überdeutlich: Essen ist traditionell die Domäne der Frauen; selbst wenn es da zu Umkehrungen kommt, wird dies fast immer als eine Abweichung vom Alltäglichen dargestellt und das Muster damit bestätigt. Dass Essen weiblich codiert ist, ist wiederum eng verknüpft mit einer Vorstellung von öffentlich und privat, von Innerlichkeit und Häuslichkeit als Orten des Rückzugs, der Familie und damit auch des gemeinschaftsstiftenden Mahls.
Schon an diesen wenigen Beispielen zeigt sich, dass man die materiellen und die symbolischen Dimensionen des Essens nicht voneinander trennen kann. Essen ist Teil der material culture, es stellt aber gleichzeitig auch ein semantisches Feld parat, auf dem weiterreichende kulturelle Bedeutungen verhandelt werden. Zu denken wäre hier etwa an die sinnstiftenden ‘Achsen’ roh – gekocht, essbar – nicht-essbar; wohlschmeckend – ekelhaft, Fleisch – Nicht-Fleisch, oder – wenn es um asketische bzw. diätetische Praktiken geht, auch ganz radikal: essen oder nicht essen.
Besonders spannend ist daher die Frage, welche Bedeutung das Essen in kulturellen Repräsentationen einnimmt, z. B. in der Literatur oder im Film, wie Essen hier inszeniert wird, welche Geschlechtercodierungen, Ein- und Ausschlussmechanismen, Machtbeziehungen und kulturellen Reinheitsgebote über das Essen verhandelt werden. In der literarischen Rede vom Essen überblenden sich häufig die Semantiken von Haus, Körper, Privatheit und Innerlichkeit, so dass auch benachbarte Sinnenfreuden imaginär miteinander verwoben werden. Körpertopographisch gesehen könnte man auch sagen, es geht beim Essen um einen Genuss, der mit einer Grenzüberschreitung einhergeht. Wenn wir von Grenzen oder Schwellen reden, rufen wir damit in der Repräsentation immer zugleich zwei Dinge auf: das Tabu und den Exzess. Gerade das Essen scheint sich als metaphorischer Raum für alle Arten von Grenzüberschreitungen, Transgressionen, Tabubrüche und Exzesse zu eignen, zwischen Innen und Außen, zwischen der Ratio und den Trieben. Hier geht es also um lustvolle und/oder angstbesetzte Einverleibung, um das prekäre Spannungsfeld von Subjekt, Objekt und Abjekt, um Grenzverletzungen also, die die jeweiligen kulturellen Regeln neu aushandeln, unterminieren oder auch bestätigen. Im übertragenen Sinn ergeben sich hier Anschlussstellen für andere Lüste: Die imaginative Gleichsetzung von Essen und Sex etwa ist ein eingeführter Topos in unseren Kulturen.
Während bei den bisher genannten immerhin noch die lustvolle Überschreitung der Körpergrenzen als gemeinsamer Nenner fungiert, ist das bei den extremeren Formen von ‘Nahrungsdelinquenz’ (alimentary delinquency) nicht mehr bzw. nur noch über den Kitzel des Horrors vermittelt der Fall. Repräsentationen von Kannibalismus inszenieren die ultimative Transgression aller Reinheitsgebote und Essenstabus: Verschlingen, Einverleiben. Die “Schwarze Küche” (Wördehoff 2000, S. 128) inszeniert die ultimative Umkehrung der nährenden, lustvollen und gemeinschaftsstiftenden Semantiken des Essens.


