Dieser Titel wurde ersetzt durch:
- Die Form des Kindes (978-3-95832-390-2) - Einband - flex.(Paperback)
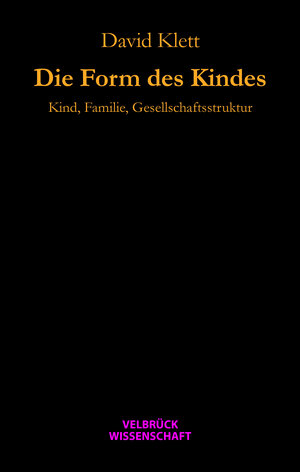
×
![Buchcover ISBN 9783942393461]()
Die Form des Kindes
Kind, Familie, Gesellschaftsstruktur Mit einem Vorwort von Dirk Baecker
von David KlettDie Form des Kindes ist ein Beitrag zur soziologischen Systemtheorie der Familie. Ausgangspunkt der Untersuchung sind die von Niklas Luhmann vorgeschlagenen Bedingungen familiärer Kommunikation: Die Familie inkludiert als einziges System der Gesellschaft ihre Mitglieder als Vollpersonen. Alles, was diese jenseits der Familie betrifft, sei es als Wähler, als Patient, als Konsument, als Kunstgenießer etc., kann die Familie zu ihrer Angelegenheit machen. Damit setzt sie sich auffallend ab von den Inklusionsbedingungen anderer gesellschaftlicher Bereiche, die in der modernen Gesellschaft immer nur hochselektiv auf ihre Beteiligten zurückgreifen.
Hier deutet sich ein Zusammenhang zwischen Inklusionsverhältnissen der Familie und Gesellschaftsstruktur an, der die theoretische Klammer der Untersuchung bildet. Sie geht der Frage nach, wie die Familie (oder deren alteuropäisches Äquivalent, der Familienhaushalt) das Kind, seinen Körper, seine Psyche und seine (im weitesten Sinne) Karriere sozial berücksichtigt. Da alle drei Horizonte durch die gesellschaftlichen Verhältnisse dimensioniert werden, muss die Familie ihrerseits Strukturen aufbauen und erhalten, um mit diesen sich aufschließenden Horizonten ihres Personals zurechtzukommen. Entsprechend sind die Konditionen des Aufwachsens in der stratifizierten Gesellschaft des Mittelalters kaum mit denen der modernen Gesellschaft vergleichbar.
Die zentrale These des historischen Teils der Arbeit betrifft die Ausdifferenzierung der Familie als selbstreferentiell geschlossenes System: Zu ihr kommt es erst mit der 'Entdeckung des Kindes', die wiederum im Familiengeschehen ihre entscheidenden Anregungen findet. So ist das Kind Produkt und Ursache der Schließung und Ausdifferenzierung der modernen Familie. Mit der Sensibilität für das Kind und seine drei Horizonte, die erst in der modernen Gesellschaft eröffnet werden, verdichtet sich die familiäre Kommunikation zeitlich, sachlich und sozial so weit, dass es zum ›Takeoff‹ eines sich rekursiv reproduzierenden Systems kommt. Auf dieser Grundlage sortiert die Familie die Möglichkeiten der Beteiligung an ihr neu. So gewinnt die Unterscheidung von eigenen Kindern und übrigem Personal des Hauses an Gewicht. Das Gesinde wird räumlich abgetrennt – und erhält so die Aussicht, selbst eine Familie gründen zu können. Vorerst nur im Bürgertum schließt sich die Familie immer weiter ein und den Rest der Welt aus. Sie entdeckt als entscheidenden Sozialisationskontext des Kindes – sich selbst. Sie schaltet sich als Zurechnungsadresse vor Gott und Natur, Dämonen und Ammen, Hauslehrer und Schule. Sie exponiert sich als einzig legitimer Ort für alle erdenklichen Ansprüche und Zumutungen ihres Personals. Derlei ist nicht die Folge einer (irgendwie aufkommenden) affektiven Hinwendung zum Kind, wie so oft behauptet wird, sondern deren Voraussetzung.
Damit bleibt zu beantworten, wie die Familie diese hochgetriebene interne Resonanzfähigkeit für das Kind organisiert. Bereits in der Kybernetik Heinz von Foersters findet sich der Verdacht, dass Systeme ihren Umweltbezug über Unterscheidungen realisieren. Durch deren rekursive Verwendung erlauben sie, Strukturen auszubilden, die mit diesem Umweltbezug kompatibel sind. Das ist in der Soziologie längst angekommen, nicht nur in Form von binären Codes in der Gesellschaftstheorie Niklas Luhmanns, sondern auch in Studien Andrew Abbotts oder Everett Hughes. Auch Carl Schmitts Differenz von 'Freund und Feind' als Agens des Politischen lässt sich unter Umständen so verstehen. In Anlehnung an den Form-Begriff Spencer Browns wird die These entfaltet, dass die Familie sich über eine Form von ›formierbar/nichtformierbar‹ strukturell für das Kind resonanzfähig hält. Während die Form im Mittelalter noch ›offen‹ gehandhabt wurde – das heißt: man musste wissen, wie das Kind je nach Lebensalter formierbar oder nichtformierbar war –, eröffnet die moderne Familie ein reflexives Formiertwerden. Sie sieht sich selbst als Sozialisationskontext des Kindes und bezieht potentiell alles, womit das Kind in Psyche, Körper und Karriere aufwartet, auf ihre eigene Geschichte. So kann alles, was in ihr geschieht, über das eingeschlossene Kind auf sie zurückfallen – während die Form dabei gleichsam das Instrument ist, um die durch die Dauerreflexion angeregte Irritation verarbeitbar zu machen.
Die Sozialisierbarkeit des Kindes wird an vielen Stellen in der Gesellschaft registriert, nicht nur in der Familie. Aber nur die Familie rechnet sich das Kind vorwiegend als Resultat ihres Geschehens zu. Sie ist das einzige System, in dem die kommunikativen Verhältnisse für eine solche Art von Beobachtung ausreichend konzentriert sind. Hier ist eine absehbare Zahl von Personen über lange Zeiträume einander ausgesetzt, und was man voneinander erwarten kann, ist nicht vorsortiert durch politische, rechtliche, wirtschaftliche oder religiöse Motive. Die mögen dauernd in der Familie eine Rolle spielen, allerdings nur als in erster Linie an Personen gebundene Motive. Nur unter solchen Bedingungen kann die Selbstzurechnung von Sozialisationsgeschehen fortwährend Bestätigung finden. Die moderne Familie – das setzt sie von jedem anderen System ab – inkludiert das Kind als sozialisierbar.
Hier deutet sich ein Zusammenhang zwischen Inklusionsverhältnissen der Familie und Gesellschaftsstruktur an, der die theoretische Klammer der Untersuchung bildet. Sie geht der Frage nach, wie die Familie (oder deren alteuropäisches Äquivalent, der Familienhaushalt) das Kind, seinen Körper, seine Psyche und seine (im weitesten Sinne) Karriere sozial berücksichtigt. Da alle drei Horizonte durch die gesellschaftlichen Verhältnisse dimensioniert werden, muss die Familie ihrerseits Strukturen aufbauen und erhalten, um mit diesen sich aufschließenden Horizonten ihres Personals zurechtzukommen. Entsprechend sind die Konditionen des Aufwachsens in der stratifizierten Gesellschaft des Mittelalters kaum mit denen der modernen Gesellschaft vergleichbar.
Die zentrale These des historischen Teils der Arbeit betrifft die Ausdifferenzierung der Familie als selbstreferentiell geschlossenes System: Zu ihr kommt es erst mit der 'Entdeckung des Kindes', die wiederum im Familiengeschehen ihre entscheidenden Anregungen findet. So ist das Kind Produkt und Ursache der Schließung und Ausdifferenzierung der modernen Familie. Mit der Sensibilität für das Kind und seine drei Horizonte, die erst in der modernen Gesellschaft eröffnet werden, verdichtet sich die familiäre Kommunikation zeitlich, sachlich und sozial so weit, dass es zum ›Takeoff‹ eines sich rekursiv reproduzierenden Systems kommt. Auf dieser Grundlage sortiert die Familie die Möglichkeiten der Beteiligung an ihr neu. So gewinnt die Unterscheidung von eigenen Kindern und übrigem Personal des Hauses an Gewicht. Das Gesinde wird räumlich abgetrennt – und erhält so die Aussicht, selbst eine Familie gründen zu können. Vorerst nur im Bürgertum schließt sich die Familie immer weiter ein und den Rest der Welt aus. Sie entdeckt als entscheidenden Sozialisationskontext des Kindes – sich selbst. Sie schaltet sich als Zurechnungsadresse vor Gott und Natur, Dämonen und Ammen, Hauslehrer und Schule. Sie exponiert sich als einzig legitimer Ort für alle erdenklichen Ansprüche und Zumutungen ihres Personals. Derlei ist nicht die Folge einer (irgendwie aufkommenden) affektiven Hinwendung zum Kind, wie so oft behauptet wird, sondern deren Voraussetzung.
Damit bleibt zu beantworten, wie die Familie diese hochgetriebene interne Resonanzfähigkeit für das Kind organisiert. Bereits in der Kybernetik Heinz von Foersters findet sich der Verdacht, dass Systeme ihren Umweltbezug über Unterscheidungen realisieren. Durch deren rekursive Verwendung erlauben sie, Strukturen auszubilden, die mit diesem Umweltbezug kompatibel sind. Das ist in der Soziologie längst angekommen, nicht nur in Form von binären Codes in der Gesellschaftstheorie Niklas Luhmanns, sondern auch in Studien Andrew Abbotts oder Everett Hughes. Auch Carl Schmitts Differenz von 'Freund und Feind' als Agens des Politischen lässt sich unter Umständen so verstehen. In Anlehnung an den Form-Begriff Spencer Browns wird die These entfaltet, dass die Familie sich über eine Form von ›formierbar/nichtformierbar‹ strukturell für das Kind resonanzfähig hält. Während die Form im Mittelalter noch ›offen‹ gehandhabt wurde – das heißt: man musste wissen, wie das Kind je nach Lebensalter formierbar oder nichtformierbar war –, eröffnet die moderne Familie ein reflexives Formiertwerden. Sie sieht sich selbst als Sozialisationskontext des Kindes und bezieht potentiell alles, womit das Kind in Psyche, Körper und Karriere aufwartet, auf ihre eigene Geschichte. So kann alles, was in ihr geschieht, über das eingeschlossene Kind auf sie zurückfallen – während die Form dabei gleichsam das Instrument ist, um die durch die Dauerreflexion angeregte Irritation verarbeitbar zu machen.
Die Sozialisierbarkeit des Kindes wird an vielen Stellen in der Gesellschaft registriert, nicht nur in der Familie. Aber nur die Familie rechnet sich das Kind vorwiegend als Resultat ihres Geschehens zu. Sie ist das einzige System, in dem die kommunikativen Verhältnisse für eine solche Art von Beobachtung ausreichend konzentriert sind. Hier ist eine absehbare Zahl von Personen über lange Zeiträume einander ausgesetzt, und was man voneinander erwarten kann, ist nicht vorsortiert durch politische, rechtliche, wirtschaftliche oder religiöse Motive. Die mögen dauernd in der Familie eine Rolle spielen, allerdings nur als in erster Linie an Personen gebundene Motive. Nur unter solchen Bedingungen kann die Selbstzurechnung von Sozialisationsgeschehen fortwährend Bestätigung finden. Die moderne Familie – das setzt sie von jedem anderen System ab – inkludiert das Kind als sozialisierbar.



