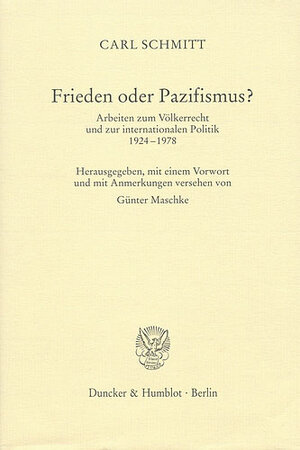
×
![Buchcover ISBN 9783428489404]()
'[…] Obwohl nun die Texte Carl Schmitts, die die Menschenrechts- und Humanitätsrhetorik der westlichen Demokratien mit deren konkretem Verhalten im Versailler Vertrag und danach vergleichen sowie die entsprechende Praxis des Völkerbundes in oftmals wahrlich scharfen Worten geißeln und etwa als ›heuchlerisch‹ bezeichnen, erschöpfen sie sich doch nie in bloßer Anklage, wie sie sonst während der Weimarer Zeit die politische und wissenschaftliche Publizistik in Deutschland prägte. Auch geht es Schmitt nicht um Entlarvung in dem Sinne, dass das Abweichen von den selbstverkündeten Grundsätzen mit dem Ziel angeprangert wird, dass die Verwirklichung dieser demokratischen Grundsätze nun ehrlich angestrebt werden sollte. Seine Absicht ist auf Erkenntnis gerichtet, und als Erkenntnis steht hinter seinen Texten die, dass das 20. Jahrhundert dergestalt in ein nachparlamentarisches Zeitalter eingetreten sei, dass die bewohnte Welt von Imperien beherrscht werde, die freilich ihre Herrschaft auf indirekte Weise ausübten.[…] Ein besonderes Wort muss zur Arbeit des Herausgebers gesagt werden. Nicht nur wegen der Bedeutung der Texte Carl Schmitts selbst, sondern auch wegen der von früher bekannten Aufbereitung durch Günter Maschke hatte ich auf das Erscheinen des Buches gedrängt. Zunächst ist die herkulische Arbeit eines einzelnen Gelehrten zu bewundern, die sonst, ernsthaft und ohne rhetorische Übertreibung gesagt, nur von umfangreichen mit Geld, Stellen und Infrastruktur ausgestatteten Forschungsprojekten geleistet zu werden pflegt. Und selbst dann ist die immense Hilfe, die Maschke durch eine unermeßliche Fülle von Literaturhinweisen, ausführlichen Inhaltsangaben und wörtlichen Zitaten zur Verfügung stellt, in diesem Ausmaß nicht immer das schließliche Ergebnis solcher Projekte. Angemessen gewürdigt werden kann das nur von denen, die auf Grund dieser Angaben weiterarbeiten, und von denen zu hoffen ist, dass es viele sein werden. Aber nicht nur die Fülle der Literaturangaben ist staunenerregend, sondern in noch größerem Ausmaß deren Verarbeitung durch den Herausgeber selbst. Es gibt regelmäßig sowohl einen Anmerkungsteil zum jeweiligen Text selbst als auch anschließend einen Anhang, der ausschließlich dem Herausgeber zur Verfügung steht, aber in beiden Abteilungen kommen in großer Ausführlichkeit Sachfragen zur Sprache, wobei keineswegs immer Carl Schmitts Position unterstützt wird. Gelegentlich geht dem Herausgeber trotz dieser zugleich Kärrner- und Königsarbeit das Temperament durch: Unangenehm fallen – wahrscheinlich durch die Suggestion der zeitgenössischen Quellen hervorgerufene – Zungenschläge auf wie der, den durch die NS-Rassenpolitik außer Landes getriebenen Ernst Fränkel mit abschätzig wirkendem Unterton ›Emigranten‹ zu nennen. Höchst sympathisch dagegen ist es, wenn inmitten des sich über viele Seiten hinziehenden Petitdrucks – zusammen mehr als die Texte Schmitts selbst – Ausrufezeichen erscheinen, gelegentlich sogar in zwei- oder gar dreimaliger Häufung. Hier hat jemand gewirkt, der bei auch kritischer Haltung den Gegenstand seiner Forschung zu seinem eigenen gemacht hat.' Wolfgang Schuller, in: Der Staat, 1/2008'[…] So ist Maschkes Edition gleichzeitig ein Meilenstein der Carl-Schmitt-Forschung wie ein wichtiger Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Damit ist freilich nicht die Frage beantwortet, ob sich, von dem engeren Kreis der Carl-Schmitt-Forscher abgesehen, der ganze Aufwand auch gelohnt hat. Diese Frage kann hier nur gestellt werden. Verdienen die völkerrechtlichen, das heißt eigentlich völkerrechtspolitischen Aufsätze Schmitts (die eben, wie Maschke selbst ausführt, oft hastig geschriebene okkasionelle Arbeiten sind, Antworten auf eine bestimmte ›Lage‹, oder Variationen des Themas ›Der Völkerbund und das Völkerrecht als Werk der Feinde Deutschlands‹) einen editorischen Aufwand, ähnlich dem, den die Germanisten auf die Werke Goethes oder Lessings verwenden? Wie hoch ist ihre Bedeutung für die Rechts- und die Geschichtswissenschaft einerseits, für die Auseinandersetzung mit heutigen Fragen der (Welt-)Politik andererseits veranschlagen? Vermutlich wird man diesbezüglich zwischen den Arbeiten der Periode bis 1933, zwischen 1933 und 1939, der Kriegs- und schließlich der Nachkriegszeit unterscheiden müssen. Es steht außer Frage, daß sich auch in Schmitts völkerrechtlichen Schriften scharfsinnige Beobachtungen, kluge Einfälle und Begriffsbildungen sowie überraschende Assoziationen finden lassen – andererseits aber auch Opportunismus, Propaganda, billige und redundante Polemik sowie Anbiederung an die nationalsozialistischen Machthaber. Jedenfalls hat Maschke die Grundlage dafür geboten, daß sich jeder Leser in Auseinandersetzung mit Schmitts Texten sein eigenes Urteil bilden kann. Zugleich zwingt er jeden, der Schmitt als Juristen und insbesondere als Völkerrechtswissenschaftler beurteilen will, das ganze einschlägige Werk zur Kenntnis zu nehmen und nicht nur ein oder zwei bekannte Schriften.' Bardo Fassbender, in: Die Friedenswarte, 2–3/2007'[.] Es ist nicht der Neuigkeitswert der Texte, sondern deren Auswahl und Kommentierung, die Maschkes Edition über den praktischen Nutzen hinaus wertvoll macht. Die neue Sammlung bietet nicht weniger als zehn Texte, die schon (unkommentiert) in den ›Positionen und Begriffen‹ enthalten waren und lieferbar sind. Dazu kommen partielle Überschneidungen: So brachten die ›Positionen und Begriffe‹ die wichtige Rede über ›Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik‹ sowie die Erstfassung des ›Begriffs des Politischen‹ nur im Teilabdruck. Andere Texte sind kaum bekannte Varianten oder Kompilate, teils Rückübersetzungen. Quantitative Herzstücke der neuen Edition sind ›Die Kernfrage des Völkerbundes‹, die wenig bekannte Programmschrift ›Nationalsozialismus und Völkerrecht‹ von 1934, die Rezensionsabhandlung ›Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff‹ sowie das pseudonym verfasste, weitgehend unbekannte Repetitorium ›Völkerrecht‹. Das halbe Quantum der Texte, die die neue Edition bietet, ist also heute in anderer, von Schmitt selbst autorisierter Form im selben Verlag greifbar. Man kauft nicht zuletzt Maschkes umfangreichen Kommentar und dessen interpretativen Anstoß ein. Eine Alternative wäre gewesen, sich ganz auf Schmitts Texte zu beschränken und den Kommentar getrennt zu veröffentlichen. Dann wäre die Edition aber nicht in der gleichen Weise eine Intervention gewesen. [.] Insgesamt muss man sagen, dass die Sammlung keine sensationelle Erweiterung des bekannten und zugänglichen Textkorpus bietet. Ihr Markstein im Verblüffungsweg der Publikationspolitik ist gerade die Wiederentdeckung des ›alten‹ Schmitt, einer ›manchmal überraschende[n] Stimme in einem ausgedehnten Chor‹ (XIX). Die Schlüsselbedeutung seines ständigen ›Kampfes‹ mit Versailles und Genf rückt jetzt erst angemessen in den Blick der Forschung. Gewiss hätte eine Selbstedition Schmitts etwas andere Akzente gesetzt. Mehr noch als die frühere Sammlung ›Staat, Großraum, Nomos‹, die von den Texten lebte, ist die neue Edition aber eine imponierende Forschungsleistung und Intervention in die laufende Diskussion." Reinhard Mehring, in: Politische Vierteljahresschrift, 2/2006'AGENDA 2005 (Geisteswissenschaften): Begrenzte SouveränitätFür den Moment hat sich die demokratische Interventionspolitik der Vereinigten Staaten durchgesetzt. Welche Rolle werden die Vereinten Nationen künftig spielen, welche Souveränität verbleibt den Nationalstaaten in der Europäischen Union? Wer sich mit diesen Fragen beschäftigt, kommt um ein Buch nicht herum, das im April erscheinen wird. Es heißt ›Frieden oder Pazifismus?‹, und es enthält die gesammelten Aufsätze von Carl Schmitt zum Völkerrecht und zur internationalen Politik – ein Buch, das die Jahre von 1924 bis 1978 umspannt, also von der Ruhrbesetzung bis an die Schwelle der iranischen Revolution. Der Leser darf seine Erwartungen in einen Goethe-Vers fassen: ›Da wird sich manches Rätsel lösen / Doch manches Rätsel knüpft sich auch.‹' Lorenz Jäger, in: FAZ, 31.12.2004
Frieden oder Pazifismus?
Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Hrsg., mit einem Vorwort und mit Anmerkungen versehen von Günter Maschke.
von Carl Schmitt, herausgegeben von Günter MaschkeCarl Schmitt war ein Denker konkreter Situationen. Angesichts der Literatur zu seiner Bedeutung als Kulturkritiker, Geschichtsphilosoph oder homme de lettres wird oft vergessen, daß er in erster Linie der Betrachter der höchst handgreiflichen Politik seiner Zeit und ihrer ideologischen Verschleierungen war. Doch erst in Bonn, wo er 1922–1928 lehrte, wurde Schmitt zum Theoretiker des Politischen, der rasch auf die Ereignisse reagierte. Hier erlebte er die Besetzung der Rheinlande und mußte deren Abtrennung vom Reich befürchten, hier erfuhr er deren Weiterung: die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen im Januar 1923. Diese Maßnahmen erfolgten im Namen von Recht und Legalität, sollten die 'Heiligkeit der Verträge' sichern und basierten auf einem Völkerrecht, das aus deutscher Sicht als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln erschien. Die Juridifizierung der Politik und der gewollte Mangel an Sichtbarkeit des Feindes, zur Verschärfung der Feindschaft führend und im diskriminierenden Kriegsbegriff mündend, wurden von nun an wichtige Themen Schmitts. Angesichts heutiger weltpolitischer Ereignisse, deren Politikziel, Herstellung von freiheitlichen und demokratischen Verhältnissen, vielen nur als Vorwand für eigentlich gemeinte Ziele wie ökonomische Expansion, geostrategische Kontrolle und Strafkrieg erscheint, sind Schmitts damalige Überlegungen von fortdauernder Aktualität.



