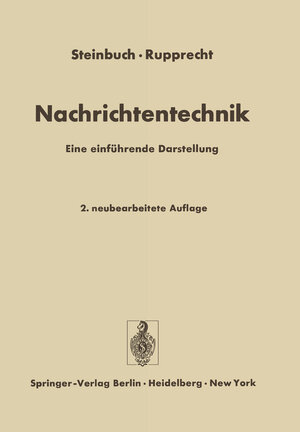
×
![Buchcover ISBN 9783642961342]()
Inhaltsverzeichnis
- 0 Zusammenstellung einiger Hilfsmittel aus der theoretischen Elektrotechnik.
- 0.1 Spannungen, Ströme.
- 0.1.1 Gleichspannung, Gleichstrom.
- 0.1.2 Sinusförmige Wechselspannungen und -ströme.
- 0.1.2.1 Komplexe Darstellung sinusförmiger Wechselspannungen und -ströme.
- 0.1.3 Nichtsinusförmige Spannungen und Ströme.
- 0.1.3.1 Periodische nichtsinusförmige Spannungen, Pulse.
- 0.1.3.1.1 Klirrfaktor.
- 0.1.3.2 Unperiodische nichtsinusförmige Spannungen, Impulse.
- 0.1.3.3 Zufällige Spannungen.
- 0.1.4 Frequenzen, komplexe Frequenz.
- 0.2 Leistung.
- 0.2.1 Leistung bei Gleichstrom.
- 0.2.2 Leistung bei sinusförmigem Wechselstrom.
- 0.2.2.1 Komplexe Leistung.
- 0.2.3 Leistung bei nichtsinusförmigen Strömen.
- 0.2.4 Leistungen bei zufälligen Strömen.
- 0.3 Zweipolige und vierpolige Schaltelemente.
- 0.3.1 Zweipolige Schaltelemente.
- 0.3.2 Yierpolige Schaltelemente.
- 0.4 Analyse von Netzwerken.
- 0.4.1 KmcHHOFFsche Sätze.
- 0.4.2 Schleifen- und Knotenanalyse.
- 0.4.3 Anpassung von Zweipolquellen, Reflexionsfaktor, Echomaß.
- 0.4.3.1 Anpassung.
- 0.4.3.2 Reflexionsfaktor.
- 0.4.3.3 Echomaß.
- 0.5 Lineare Vierpole.
- 0.5.1 Zusammenschaltung mehrerer Vierpole.
- 0.5.2 Wellenparameter eines Vierpols.
- 0.5.2.1 Anpassung von Vierpolen. Reflexionsfaktor.
- 0.5.3 Betriebsparameter eines Übertragungssystems.
- 0.5.4 Spezielle Vierpole.
- 0.5.4.1 Umkehrbare und passive Vierpole.
- 0.5.4.2 Symmetrische Vierpole.
- 0.6 Weitere allgemeine Netzwerkeigenschaften.
- 0.6.1 Verzerrungen.
- 0.6.1.1 Nichtlineare Verzerrungen.
- 0.6.1.2 Lineare Verzerrungen.
- 0.6.2 Darstellungsformen komplexer Netzwerkgrößen.
- 0.6.3 Ergänzende Bemerkungen.
- 0.7 Magnetische Gesetze.
- 0.7.1 Durchflutungs- und Induktionsgesetz.
- 0.7.2 Der magnetische Kreis einer Toroidspule und die Selbstinduktion.
- 0.7.3 Die Permeabilität.
- 0.8 Einiges über Größen und Einheiten.
- Literatur.
- I Elemente der Nachrichtentechnik.
- 1 Reale lineare passive Schaltelemente.
- 1.1 Ohmsche Widerstände.
- 1.1.1 Widerstandsmaterial und technischer Auf bau von Widerständen.
- 1.1.2 Temperaturabhängigkeit, Belastbarkeit und zeitliche Konstanz.
- 1.1.3 Unerwünschte Kapazitäten und Induktivitäten, Verhalten bei Hochfrequenz.
- 1.1.4 Veränderbare Widerstände, ergänzende Bemerkungen.
- 1.2 Kondensatoren.
- 1.2.1 Abhängigkeit der Kapazität von Geometrie und Dielektrikum.
- 1.2.2 Technischer Aufbau und Temperaturabhängigkeit von Kondensatoren.
- 1.2.3 Verlustfaktor und schädliche Induktivitäten.
- 1.2.4 Veränderbare Kondensatoren.
- 1.3 Spulen.
- 1.3.1 Berechnung magnetischer Kreise mit ferromagnetischem Kern.
- 1.3.2 Induktivität bei Kernen mit Luftspalt, Trägheitserscheinungen.
- 1.3.3 Verluste und unerwünschte Kapazitäten der Spulen.
- 1.3.4 Veränderbare Induktivitäten, Temperaturabhängigkeit.
- 1.4 Übertrager.
- 1.4.1 Allgemeine Übertragertheorie.
- 1.4.1.1 Der verlustlose streufreie Übertrager.
- 1.4.1.2 Der ideale Übertrager.
- 1.4.1.3 Der verlustlose Übertrager mit Streuung.
- 1.4.1.4 Vierpoleigenschaften des Übertragers.
- 1.4.2 Der Übertrager in speziellen technischen Anwendungen.
- 1.4.2.1 Übertrager für relativ breite Frequenzbänder und reelle Beschaltung.
- 1.4.2.2 Der Übertrager mit relativ hochohmiger oder vorwiegend kapazitiver Beschaltung.
- 1.4.2.3 Abschließende Bemerkungen über weitere Übertragerarten.
- 1.5 Piezoelektrische und magnetostriktive Schwinger.
- 1.5.1 Der piezoelektrische Effekt.
- 1.5.2 Schwingungsformen und elektrische Ersatzbilder von Schwingkristallen.
- 1.5.3 Der magnetostriktive Effekt.
- 1.5.4 Magnetostriktive Schwinger.
- 2 Lineare passive Netzwerke.
- 2.1 Lineare passive Zweipole.
- 2.1.1 Elektrische Schwingkreise.
- 2.1.1.1 Frequenz verhalten elektrischer Schwingkreise.
- 2.1.1.2 Spannungs- und Stromüberhöhungen in Schwingkreisen.
- 2.1.1.3 Zeitverhalten elektrischer Schwingkreise.
- 2.1.2 Eigenschaften des allgemeinen linearen Zweipols.
- 2.1.3 Reaktanzzweipole.
- 2.2 Duale Netzwerke.
- 2.3 Synthese einfacher Vierpole.
- 2.3.1 Siebschaltungen.
- 2.3.2 Verwirklichung ausgangsseitig beschalteter Polynomfilter.
- 2.3.3 Normierte Potenz- und TSCHEBYSCHEFF-Tiefpässe.
- 2.3.4 Berechnung von Hochpässen und Bandpässen mittels Frequenzachsentransformation.
- 2.3.5 Berechnung von Laufzeitgliedern.
- 2.3.6 Entzerrer.
- 2.3.6.1 Dämpfungsentzerrung.
- 2.3.6.2 Phasen- bzw. Laufzeitentzerrung.
- 2.4 Theorie einfacher Bandfilter.
- 2.4.1 Eigenschaften des induktiv gekoppelten Zweikreisbandfilters.
- 2.4.2 Diskussion der Bandfilterselektion in einfachen Fällen.
- 3 Lineare Verstärker.
- 3.1 Elektronenröhren.
- 3.1.1 Gleichstrom verhalten und Kennlinien der Triode.
- 3.1.2 Die Triode mit ohmschem Arbeits widerstand, Einstellung des Arbeitspunktes.
- 3.1.3 Verstärkung kleiner Wechselspannungen, Röhrenersatzbilder der Triode.
- 3.1.4 Pentoden.
- 3.1.5 Berechnung einzelner einfacher Verstärkerstufen.
- 3.1.6 Untere und obere Grenzfrequenz von Verstärkerstufen.
- 3.1.7 Mehrstufige Verstärker.
- 3.1.8 Grenzdaten.
- 3.2 Transistoren.
- 3.2.1 Grundlagen aus der Halbleiterphysik.
- 3.2.2 Gleichstromverhalten und Kennlinienfelder des Transistors.
- 3.2.3 Der Transistor als Kleinsignalverstärkerelement.
- 3.2.3.1 Arbeitspunkteinstellung und Arbeitspunktstabilisierung.
- 3.2.3.2 Kleinsignal-Vierpolparameter und Ersatzbilder bei niedrigen Frequenzen.
- 3.2.3.3 Kleinsignal-Vierpolparameter und Ersatzbilder bei höheren Frequenzen.
- 3.2.4 Berechnung einzelner Transistorverstärkerstufen.
- 3.2.5 Feldeffekt-Transistoren.
- 3.3 Allgemeine Probleme der Verstärkertechnik.
- 3.3.1 Obere Aussteuerungsgrenze, nichtlineare Verzerrungen.
- 3.3.2 Untere Aussteuerungsgrenze, Störeinflüsse.
- 3.3.3 Gegenkopplung.
- 3.3.3.1 Allgemeine Beschreibung gegengekoppelter Schaltungen.
- 3.3.3.2 Berechnung einfacher GK-Schaltungen.
- 3.3.3.3 Stabilitätsbedingungen insbesondere bei Gegenkopplung.
- 3.4 Operationsverstärker.
- 3.4.1 Eigenschaften des idealen Operationsverstärkers und Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern.
- 3.4.2 Statische Un Vollkommenheiten des realen Operationsverstärkers.
- 3.4.3 Dynamische Un Vollkommenheiten des realen Operationsverstärkers.
- 4 Impulstechnik.
- 4.1 Lineare Impulstechnik.
- 4.1.1 Lineare Formungsvorgänge.
- 4.1.2 Lineare Impulsverstärkung.
- 4.2 Nichtlineare Impulstechnik mit nichtspeichernden Elementen.
- 4.2.1 Nichtspeichernde nichtlineare FormungsVorgänge.
- 4.2.1.1 Scherung nichtlinearer Stromspannungskennlinien.
- 4.2.1.2 Amplitudenfilter.
- 4.2.2 Statische Betrachtung des Transistors im Schalterbetrieb.
- 4.3 Nichtlineare Impulstechnik mit speichernden Elementen.
- 4.3.1 Einfache Beispiele speichernder nichtlinearer Formungsvorgänge.
- 4.3.2 Dynamische Eigenschaften von Halbleiterelementen.
- 4.3.2.1 Dynamische Eigenschaften von Dioden.
- 4.3.2.2 Dynamische Eigenschaften von Transistoren.
- 4.3.3 Stabile Kippschaltungen mit Transistoren.
- 4.3.3.1 Die bistabile Kippschaltung (Flipflop).
- 4.3.3.2 Die monostabile Kippschaltung (Monoflop).
- 4.3.3.3 Der ScHMiTT-Trigger.
- 4.3.4 Der astabile Multivibrator.
- II Nachrichtenübertragung.
- 5 Sprache und Wandler.
- 5.1 Spracherzeugung.
- 5.1.1 Einige Eigenschaften von Sprachsignalen.
- 5.2 Das Gehör.
- 5.2.1 Lautstärke und Hörfläche.
- 5.3 Elektroakustische Wandler.
- 5.3.1 Das Mikrophon.
- 5.3.1.1 Das Kondensatormikrophon und das Kristallmikrophon.
- 5.3.1.2 Das Tauchspulmikrophon und das Bändchenmikrophon.
- 5.3.1.3 Das Kohlemikrophon.
- 5.3.1.4 Anwendung des Kohlemikrophons in der Fernsprechtechnik.
- 5.3.2 Das Telefon (Hörkapsel).
- 5.4 Verständlichkeit.
- 5.4.1 Besistenz des Sprachsignals gegen Veränderungen.
- 5.5 Wichtige technische Einrichtungen zur Sprachübertragung.
- 5.5.1 Die Gabelschaltung.
- 5.5.2 Der Teilnehmerapparat.
- 6 Übertragungswege, Leitungen.
- 6.1 Allgemeines.
- 6.2 Homogene Leitungen.
- 6.2.1 Sonderfälle.
- 6.2.2 Beispiel einer Leitungsberechnung.
- 6.3 Die Leitungsbeläge verschiedener Leitungen.
- 6.3.1 Der Einfluß des Skineffektes auf die Leitungsbeläge.
- 6.3.2 Die Leitungsbeläge von Freileitungen.
- 6.3.3 Die Leitungsbeläge von Koaxialleitungen bei hohen Frequenzen.
- 6.3.4 Einiges über symmetrische Kabel.
- 6.3.4.1 Pupinleitungen.
- 6.3.4.2 Phantomkreisbildung.
- 6.3.4.3 Typische Daten neuerer symmetrischer Kabel.
- 6.4 Wellenausbreitung auf der Leitung.
- 6.4.1 Anschauliche Deutung des Reflexionsfaktors bei Leitungen.
- 6.4.2 Phasen- und Gruppenlaufzeit.
- 6.5 Nebensprechen.
- 7 Modulation und Selektion.
- 7.1 Allgemeines.
- 7.2 Selektionskennzeichen.
- 7.3 Zweck und grundsätzliche Verfahren der Modulation.
- 7.4 Amplitudenmodulation (AM) eines Sinusträgers.
- 7.4.1 Lineare Modulation.
- 7.4.2 Demodulation bei linearer Modulation.
- 7.4.3 Gewöhnliche Zweiseitenband-AM.
- 7.4.4 Demodulation von Zweiseitenband-AM.
- 7.4.5 Einseitenband-, Eestseitenband- und Quadratur-AM.
- 7.4.6 Beeinflussung der AM durch lineare Verzerrungen.
- 7.4.7 Nichtlineare Verzerrungen bei AM.
- 7.4.7.1 Kreuzmodulation.
- 7.4.8 Störbeeinflussung bei AM.
- 7.4.9 Trägerfrequenz (TF)-Systeme für Frequenzselektion.
- 7.5 Winkelmodulation.
- 7.5.1 Frequenzmodulation (FM).
- 7.5.2 Phasenmodulation (PM), Vergleich von Phasen- und Frequenzmodulation.
- 7.5.3 Spektrum der Frequenzmodulation.
- 7.5.4 Verzerrungen bei FM durch Bandbegrenzung.
- 7.5.5 Frequenzmodulatoren.
- 7.5.6 Frequenzdemodulatoren.
- 7.5.7 Störbeeinflussung bei FM und PM.
- 7.6 Pulsmodulation.
- 7.6.1 Das Abtasttheorem.
- 7.6.2 Übertragungsverfahren.
- 7.6.3 Pulsamplitudenmodulation (PAM).
- 7.6.3.1 Die Abtastfunktion.
- 7.6.3.2 Die getastete Sinusschwingung.
- 7.6.3.3 Abtastschaltungen.
- 7.6.3.4 Demodulation von PAM.
- 7.7 Selektion durch unterschiedliche Modulationsverfahren.
- III Nachrichtenverarbeitung und Informationstheorie.
- 8 Codes und Codierung.
- 8.1 Analoge und digitale Darstellung.
- 8.2 Allgemeine Grundbegriffe der Codierung.
- 8.3 Darstellung und Übertragung von Codewörtern.
- 8.4 Codes mit Codewörtern gleicher Länge.
- 8.4.1 Codierung durch polyadische Zahlensysteme.
- 8.4.2 Beispiele spezieller häufig verwendeter Codes.
- 8.4.2.1 Codes für Digitalrechner.
- 8.4.2.2 Codes für Analog-Digital-Umwandlungen.
- 8.4.2.3 Schaltungen zur Analog-Digital-Umwandlung und Digital-Analog-Um- wandlung.
- 8.4.3 Prüfbare und korrigierbare Codes.
- 8.4.3.1 Gleichgewichtige Codes.
- 8.4.3.2 Ein-Fehler-prüfbare Codes mit geradzahligem Gewicht.
- 8.4.3.3 Fehler-Korrigierbarkeit durch Blocksicherung.
- 8.4.3.4 Ein-Fehler-korrigierbare Codes.
- 8.4.3.5 Korrigierbare Gruppencodes höherer Distanz.
- 8.5 Zur Auswahl des günstigsten Codes bei Übertragungssystemen.
- 8.6 Pulscodemodulation.
- 8.6.1 Erzeugung von Pulscodemodulation.
- 8.6.2 Demodulation von PCM-Signalen.
- 8.6.3 Der Einfluß von Störungen auf PCM-Signale.
- 9 Informationstheorie.
- 9.1 Allgemeines.
- 9.2 Diskrete Informationsquellen und Kanäle.
- 9.2.1 Informationsgehalt diskreter Quellen statistisch unabhängiger Zeichen.
- 9.2.1.1 Informationsgehalt gleichwahrscheinlicher Zeichen.
- 9.2.1.2 Informationsgehalt nicht gleichwahrscheinlicher Zeichen.
- 9.2.1.3 Bezogene Größen, Bedundanz, Informationsfluß.
- 9.2.1.4 Redundanzsparende („optimale“) Codes.
- 9.2.2 Informationsgehalt diskreter Quellen statistisch verbundener Zeichen.
- 9.2.2.1 Verbundwahrscheinlichkeit und bedingte Wahrscheinlichkeit.
- 9.2.2.2 Entropie diskreter Quellen statistisch verbundener Zeichen.
- 9.2.3 Informationsübertragung, Kanalkapazität diskreter Kanäle.
- 9.3 Kontinuierliche Informationsquellen und Kanäle.
- 9.3.1 Einiges zur Beschreibung kontinuierlicher statistischer Vorgänge.
- 9.3.2 Entropie kontinuierlicher Quellen.
- 9.3.3 Kanalkapazität gestörter kontinuierlicher Kanäle.
- 9.4 Informationstheoretische Beurteilung einiger Modulationsverfahren.
- 10 Schaltalgebra und logische Schaltungen.
- 10.1 Schaltalgebra.
- 10.1.1 Grundverknüpfungen.
- 10.1.2 Vollständige Beschreibbarkeit, Normalformen.
- 10.1.3 VENN-Diagramme.
- 10.1.4 Anzahl der möglichen Funktionen binärer Variabler.
- 10.1.5 Weitere Verknüpfungsarten, insbesondere NAND und NOR.
- 10.1.6 Schaltzeichen der Schaltalgebra.
- 10.1.7 Die wichtigsten Sätze der Schaltalgebra.
- 10.1.8 Vereinfachung logischer Schaltfunktionen.
- 10.1.8.1 QumEsche Methode zur Auffindung der Primimplikanden.
- 10.1.8.2 Graphische Methode nach KARNAUGH-VEITCH.
- 10.1.9 Abschließende Bemerkungen zur Schaltalgebra.
- 10.2 Logische Schaltungen.
- 10.2.1 Allgemeiner Überblick.
- 10.2.2 Logische Schaltungen mit Beiais.
- 10.2.3 Logische Schaltungen mit Dioden.
- 10.2.4 Logische Schaltungen mit Transistoren.
- 10.2.4.1 Schaltkreistechniken mit Widerstandskopplung.
- 10.2.4.2 Schaltkreistechniken mit Diodenkopplung.
- 10.2.4.3 Schaltkreistechniken mit Transistorkopplung.
- 10.2.4.4 Logische Schaltungen in Stromschaltertechnik.
- 11 Theorie und Struktur digitaler nachrichtenverarbeitender Systeme.
- 11.1 Allgemeine Einführung.
- 11.2 Schaltnetze.
- 11.2.1 Dualzahlenaddiernetz.
- 11.2.2 Codewandler, Codeprüfer, Auswahlschaltungen.
- 11.3 Schaltwerke.
- 11.3.1 Das Zeitproblem bei der digitalen Informationsverarbeitung.
- 11.3.2 Grundzüge der Automatentheorie.
- 11.3.3 Analyse vorgegebener Schaltwerke.
- 11.3.4 Beschreibung und Klassifizierung von Speichergliedern.
- 11.3.5 Synthese einfacher Schaltwerke vom MEDWEDEW-Typ.
- 11.3.5.1 Register.
- 11.3.5.2 Zähler.
- 11.3.6 Synthese einfacher Schaltwerke vom MOORE- und MEALY-Typ.
- 11.4 Nachrichtenverarbeitende Systeme.
- 11.4.1 Funktionseinheiten digitaler Universalrechner.
- 11.4.2 Organisation und Arbeitsablauf im Universalrechner.
- 11.4.2.1 Maschinensprache.
- 11.4.2.2 Informationsfluß innerhalb des Systems.
- 11.4.2.3 Einfache Programmierbeispiele.
- 11.4.3 Wirkungsweise der Funktionseinheiten.
- 11.4.3.1 Rechenwerk.
- 11.4.3.2 Steuerwerk.
- 11.4.3.3 Speicher.
- 11.4.3.4 Ein- und Ausgabe.


