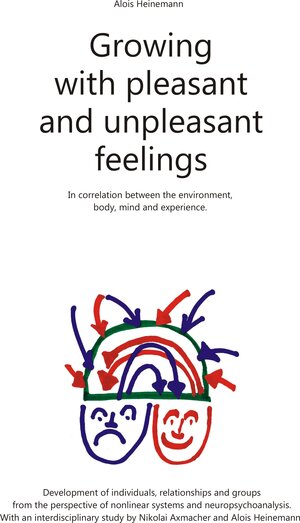
×
![Buchcover ISBN 9783941520066]()
Gute und schlechte Gefühle in der therapeutischen und pädagogischen PraxisIch schreibe diese kurze Buchbesprechung vor allem aus der Perspektive des therapeutischen und pädagogischen Praktikers, der jeden Tag mit Klienten in einer stationären Langzeittherapie lebt und arbeitet. Für mich selbst und die Klienten, die sich mir anvertrauen, ist der Titel des Buches „Wachsen mit guten und schlechten Gefühlen“ gelebter und erlebbarer Alltag. Der Autor schlägt einen weiten Bogen, um zu belegen, dass Theorien, Therapieansätze und auch Entwicklungskonzepte nur einen begrenzten Gültigkeitsbereich haben. Nicht wenige dieser Ansätze und Konzepte unterschätzen die vom Autor als so wichtig eingeschäzten „schlechten“ Gefühle. Dr. Heinemann belegt konsequent, wie wichtig unangenehme, schmerzhafte Gefühle in ihrer Bedeutung und Notwendigkeit zur gesunden Entwicklung und auch zu einer zielführenden Auseinandersetzung des Einzelnen mit seiner Umwelt sind. Sie stehen gleichberechtigt neben „guten“ lustvollen und befriedigenden Gefühlen. Er erteilt alten wie neuen Theorien oder therapeutischen Ansätzen, die sich vor allem auf die positiven, als angenehm erlebten Gefühle beziehen, eine klare Absage. Damit sind naive ressourcenorientierte Ansätze des humanistisch-liberalen Weltbildes, wie sie sich im „Ich bin OK – Du bist OK“ der siebziger und achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts zeigen gemeint, die mit ihrer einseitigen Ausrichtung auf die Stärken und positiven Gefühle bis heute einen prägenden Einfluss in Therapie und sozialer Arbeit haben. Aber auch neue boomende, nicht weniger naive Ansätze, wie die sog. „Positive Psychologie“ eines Martin Seligman, greifen in ihrer Einseitigkeit zu kurz. Die Positive Psychologie knüpft mit ihrer ausschließlich ressourcenorientierten Sichtweise an die Ideen der „Humanistischen Psychologie“ an und viele dieser Aspekte sind bereits in der ressourcenorientierten Psychotherapie zu finden. Dr. Heinemann macht deutlich, dass auch die Grundannahmen und -einstellungen des humanistisch-liberalen Entwicklungskonzeptes nicht allgemein gültig sind. Die Ablehnung von strukturierenden und konditionierenden Eingriffen im humanistischen Konzept (das Ideal des nicht-direktiven Umgangs) ist nicht für alle Menschen in allen Situationen förderlich und manchmal schadet es sogar. Dr. Heinemann fasst wie folgt zusammen: „Wenn verstehendes, nicht-direktives Verhalten die Blockaden (in Entwicklungsprozessen, Anm. d. Verf.) nicht löst, müssen die negativen Emotionen durch konfrontierendes Verhalten der Bezugspersonen aktiviert, ausgelebt und verarbeitet werden“ (S. 45). Er stellt dem humanistisch-liberalen Entwicklungskonzept das dialektisch-kritisch-integrative Entwicklungskonzept entgegen:„Der Mensch und seine Umwelt sind vielseitig, mehrdeutig, wechselhaft und widersprüchlich; in der Auseinandersetzung mit der Umwelt und sich selbst, mit seinen vernünftigen, emotionalen, affektiven und triebhaften Anteilen, mit seinen aktuellen und früheren, seinen bewussten und unbewussten Erfahrungen (seiner Geschichte) muss er sein Verhalten entwickeln“ (S. 61f).“Die Bedingungen für gesunde Entwicklungsprozesse sind im Menschen selbst und in seiner Umwelt zu sehen, d. h. im Prozess der Auseinandersetzung zwischen beiden. Wichtig für diesen Prozess ist die Fähigkeit, mit negativen Gegebenheiten fertig zu werden, mit Widerständen umzugehen und Frustrationen zu ertragen, bis Lösungen gefunden sind. Verhaltens- und Entwicklungsstörungen entstehen aus der Perspektive des dialektisch-kritisch-integrativen Konzeptes durch die mangelnde Beachtung und durch den fehlenden Umgang des Menschen mit negativen äußeren und inneren Reizen, mit unangenehmen Bedürfnissen, Trieben, Emotionen, Gefühlen, Gedanken, Situationen, Erlebnissen, Erfahrungen“ (S. 62). Es geht also darum, den als negativ empfundenen Emotionen, Gefühlen und Affekten Aufmerksamkeit zu schenken und Ausdruck zu verleihen, um sie in annehmbare und/oder gute Emotionen, Gefühle und Affekte zu verwandeln. Wobei ein andauernder Zufriedenheits- oder gar Glückszustand nichts sein kann, was anzustreben ist. Dr. Heinemann schreibt selbst: „Die Auseinandersetzung wird zur Lebensaufgabe und mit ihr wird die Annahme sowie die Bewältigung des nie endenden Wechsels von Frustration und Lust, Freude und Leid, Glück und Unglück zur Grundvoraussetzung einer gesunden Entwicklung“ (S. 67.)Daraus ergibt sich der herausgehobene Stellenwert von Emotionen, Gefühlen und Affekten in allen Erscheinungsformen und Stärken als absolut lebensnotwendige Mechanismen in der notwendigen und gesunden Auseinandersetzung zwischen Individuum und Umwelt. So lässt sich das Credo des Autors am Anfang des Buches verstehen: „Menschlich ist es, unangenehme und schlechte Gefühle zu haben. Unmenschlich ist und macht es, unangenehme und schlechte Gefühle zu unterdrücken und zu verdrängen. Stark und glücklich macht es, unangenehme und schlechte Gefühle teilen zu dürfen.“Er setzt den beschriebenen Entwicklungskonzepten, die in ihrem Kern komplexe, geschlossene Systeme mit linearer Dynamik sind, das von ihm favorisierte dialektisch-kritisch-integrative Entwicklungskonzept, basierend auf dem Konzept komplexer, offener Systeme mit nichtlinearer Dynamik entgegen. Geschlossene lineare Systeme können nur andere geschlossene Systeme beschreiben und erklären. Nur unter Verwendung offener nicht-linearer Konzepte und Sichtweisen lassen sich, seiner Meinung nach, die komplexen und offenen Systeme des Individuums in ständiger Wechselwirkung mit seiner Umwelt sinnvoll beschreiben und erklären. Auch therapeutische und pädagogische Interventionen lassen sich mit dieser Betrachtung sinnvoller entwickeln. Vor diesem Hintergrund beschreibt er die Rolle der (primären und sekundären) Emotionen, Gefühle und Affekte in ihrer Wechselbeziehung zwischen Umwelt und Organismus. So sind die Gefühlsarten in all ihren Ausprägungen und Stärken eben kein „verzichtbarer Luxus“, sondern absolute Notwendigkeit, um äußere und innere Reize sinnvoll, einordnend zu verarbeiten und eine tragfähige Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen zu schaffen und aufrecht zu erhalten:• „Abwehr-, Aggressionsgefühle schützen vor Schmerz - kämpfen werbend um Nähe und Bindung – sind aufs engste verbunden mit dem Erleben von Kraft, Potenz und Stärke, • Unlust-, Schmerzgefühle signalisieren Störungen und Gefahr – entkrampfen durch schmerzliches Weinen, beruhigen und stabilisieren die Beziehung zu sich selbst und zur Umwelt,•
Growing with pleasant and unpleasant feelings - In correlation between the environment body, mind and experience
Development of individuals, relationships and groups from the perspective of nonlinear systems and neuropsychoanalysis.
von Alois HeinemannMain content: To create a development concept and a model for the description of healthy development processes and for the diagnosis and treatment of developmental disorders: which take into account the emotions as a bridge between the environment, body, mind and experience, i. e. the perceptual, judgmental, motivating, and activating function of pleasant and unpleasant feelings, which accept the oscillating dynamics between unpleasant and pleasant, positive and negative feelings as a development-promoting principle in unclear, ambiguous, and contradictory situations, which reveal supporting and destructive affect patterns (i. e., the desirable and undesirable or forbidden feeling types and intensities) of the private and professional attachment figures and groups, the social, cultural, and religious institutions, which call into question, through the analysis of the affect pattern, the contrast between normal and abnormal, healthy and sick, which reveal psychosocially impaired persons, who, under the “guise of normality”, put a burden on, disturb or even destroy the development of individuals, groups, communities, and institutions, (cf. especially the descriptions of the hysterical, paranoid, borderline, and sociopathic personality disorder), which consider, during the analysis of healthy and impaired processes, not only the behaviour patterns and the symptoms (i. e., the detailed complexity), but also the emotional dynamics (i. e. the dynamic complexity), which offer realistic and practice-oriented procedures (tests and questionnaires) to assess the disturbances in the affect patterns and the emotional dynamics of individuals, groups, and institutions, which take into account the influence of the subconscious, i. e., endeavouring to recognise the influence of past emotional experiences and finding solutions for affect inhibitions which cause development disorders.



