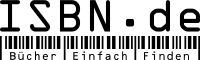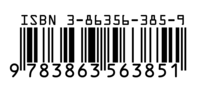Smartphone-Storys
Erkundungen eines Phänomens. Eine Anthologie der Literaturgruppe POSEIDON. Herausgegeben von PH Gruner und Andreas Roß.
von Thomas Fuhlbrügge und weiteren, illustriert von Sorosh Masudi, herausgegeben von PH Gruner, Andreas Roß und Traian PopKurze Einführung ins Themenfeld der Smartphone-Storys
Die Generation Z ist 2023 in aller Munde. Im Grunde ist es die Generation Smartphone. Geboren zwischen 1995 und 2010, kann sie sich kaum ein Leben vorstellen ohne Smartphone. Oder sich vorstellen, wie es früher war. In der Generation Golf etwa. Sie scheint so weit weg wie die Renaissance. Wie damals das Leben lief, erscheint tatsächlich jedem, der nicht dabei war, fremd. Wie war Leben damals überhaupt möglich? Telefonieren zum Beispiel. Brach man beim Drehen der ulkigen Wählscheiben ständig in Lachen aus? Fand man es appetitlich, speckige Telefonbücher durchzublättern, die sich in den gelben, roten oder grauen Häuschen mit einem Qua- dratmeter Stellfläche befanden, Telefonzelle geheißen, nur um letztlich festzustellen, dass die Seite mit dem richtigen Namen und der passenden Nummer herausgerissen war? Ein Elend. Von den mit Kaugummi verschlossenen Münzschlitzen im Telefonzellen-Wählscheibenapparat oder von den Münzen, die durch ihn immer lotrecht hindurchfielen, gnädig zu schweigen. Oder wie fühlte es sich an, einen Straßenplan einer Stadt auf einem Quadratmeter Papier, kleingefaltet, in der Tasche zu haben statt eines flachen Dings, in dem alle Stadtpläne aller Städte aller Welt drin sind? Und alle Flugpläne und alle Fahrpläne und alle Hoteldaten dazu. Grob unglaubwürdig scheint auch, dass man 1990 nie, auf einer Parkbank zum Beispiel in Castrop-Rauxel sitzend, blitzschnell Texte und Fotos und Grafiken austauschen konnte mit einem Menschen, der zeitgleich auf einer Parkbank in Narvik, Nordnorwegen, saß.
So schnell kann es menschheitsgeschichtlich also gehen mit technischen Prozessen und Etappen, die zum schier Selbstverständlichen in der Grundausstattung des Lebens werden, ja die Qualität von Identität annehmen. Ein Buch mit Smartphone-Storys ist also kein Wunder. Das flache Wunderdings in der Tasche, meist permanent in der Hand, ist zu wichtig geworden. Es schwirren derartig viele Geschehnisse, Geschichten und Anekdoten rund um das Smartphone durch unsere Gesellschaft – von skurril über witzig über ärgerlich bis lebensgefährlich –, dass eine literarische Auseinandersetzung geradezu überfällig ist. Ehrlich gesagt – der Band hätte auch anders betitelt werden können, zum Beispiel so: Das Smartphone als zentrales digitales Werkzeug der zivilisatorischen Moderne. Das Werkzeug würde so zwar exakt benannt, richtig, es wäre jedoch ein Sachbuch geworden. Als didaktisches Buch der mentalen Gesundheitsvorsorge hätte das Buch auch diesen Titel tragen können: Der Einfluss des Smartphones auf Intelligenz, Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen. In diesem Falle wäre es ebenfalls ein Sachbuch geworden, in der thematischen Konzentration auf Kinder und Jugendliche sogar ein recht depressiv stimmendes. Und selbstverständlich, dritte Option, könnte es auch noch wie folgt reißerisch in großen Lettern auf dem Titel prangen: Deformierte Twitter-, Tiktok- und Facebook-Gehirne: Wie ständige digitale Mediennutzung das Denken verändert und die Demokratie gefährdet. Dies wäre das perfekte Buch für Kulturpessimisten, im Grunde sicher auch das erfolgreichste in der Vermarktung – wenn all die technikaffin intelligenten Kulturkritiker nicht gerade mit allen Fingern auf und allen Sinnen in ihren Smartphones wären.
Was auf Umwegen vermittelt: Selbstverständlich war und ist das Smartphone ein digitaltechnischer Sprung vorwärts sondergleichen. Kommunikation, mediale Unterhaltung und jedwede Datenübertragung wurden in Schnelligkeit und Präzision revolutioniert. Kein anderes Adjektiv passt hier besser. Zudem wird die Welt geschrumpft: Das Smartphone ist das Werkzeug einer erfahrbaren Globalität, das alles in den Schatten stellt, was je dem Menschen so leicht und transportabel in Händen lag.
Aber ebenso selbstverständlich ist, dass die Autoren in diesem Band nicht die affirmative Lobpreisung im Sinne hatten, keine Elogen zum Wunderphone verfassen wollten und konnten. Das wäre im besseren Falle langweilig und vorhersehbar, mündete im schlechteren Fall in kritiklose Verabsolutierung. Kulturkritik blickt halt gerne auf die Schatten, die ein neues helles Licht so wirft. Es ist im Grunde wie in der Medizin oder im Journalismus: Mediziner schauen nicht nach den Gesunden und Starken und Schönen, sondern nach den Geschädigten und Kranken – und nicht zuletzt dem Krankmachenden. Im Journalismus wird auch nicht gemeldet, dass auf der Kreuzung X in Y-Stadt tagelang keinerlei Zwischen- oder Unfälle zu verzeichnen waren. Der Journalist meldet den Unfall. Und fragt nach dem Warum. Sind wir als Autoren dieses Buches voreingenommen? Sind wir zu kritisch? Sehen wir das Smartphone zu einseitig? Vielleicht ist die Antwort ein Vergleich: Ähnlich würden die Autoren der Literaturgruppe POSEIDON nämlich auch über Automobile schreiben. Ja, unsere Autos. Deren Erfindung war schließlich ebenfalls eine Revolution, und auch sie verkürzte die Distanzen und schrumpfte, auf ihre Art, die Welt. Alltags- und kulturkritisch gesinnte Schriftsteller würden jedoch weniger Begeisterung regnen lassen über das Design, über Komfort, Antrieb und Schnelligkeit der Automobile, sondern sich dem Verbrauch von Ressourcen widmen, über Emissionen schreiben, über Bewegungsarmut und Verkehrstote, über den Flächenverbrauch von geparktem Blech auf Bürgersteigen – und damit ebenfalls wieder über die Schatten, die im Lichtkegel erst mal nicht zu sehen sind.
Mit dem Titel Smartphone-Storys machen sich Literaten zwar über das technische Gerät her, sie schildern, beschreiben, debattieren und problematisieren jedoch auch all jene Phänomene, die Teile der Gesellschaft gerne pauschal als digitale Modernisierung bezeichnen. Der Begriff versachlicht die epochemachende Wandlung, die mit dem Zaubergerät des Smartphones weltweit vollzogen wurde und wird, als auch die damit angestoßenen, im historischen Vergleich gesehen gravierenden Veränderungen des politschen, gesellschaftlichen, kommunikativen und gesamten zivilisatorischen Prozesses. Weil Schnelligkeit ja so viel gilt: Schnelligkeit ist im Bereich der Digitalität zu einem bipolaren Begriff geworden, zu einem Sehnsuchts- und Schreckensbegriff in einem: Jeder Bürger möchte seinen schnellen Amtstermin oder Zahnarzttermin buchen und die Kinokarte sofort ausdrucken. Viele Jugendliche indes werden bereits psychisch auffällig oder krank vor Angst, in den sozialen Netzwerken des digitalen Lebensraumes irgendetwas zu verpassen. Es geht alles so schnell und es ist alles so scheinbar und gleichzeitig wichtig, dass das Gerät kaum weggelegt und schon gar nicht mal temporär ausgeschaltet werden kann. „Süchtig nach dem Smartphone“ heißen daher Angebote von Drogenberatungsstellen in Deutschland. Das ist konsequent. Auch der religiös inspirierte Raum hat reagiert – mit angepassten neuen Angeboten in der Fastenzeit. Vor zwanzig Jahren wurde für den vierzigtägigen Zeitraum mit Verzichtsübungen zur Vorbereitung auf das Oster-Fest das sogenannte „Auto-Fasten“ propagiert. Es hob das Fasten in technische Sphären. Inzwischen steht auch das „Smartphone-Fasten“ auf dem Programm. Lustig wird es im Netz dann, wenn Smartphonitis, die Droge und Erkrankung, via Smartphone diagnostiziert, erklärt und behandelt wird. „Ablenkungen aus dem Weg schaffen!“, rät etwa eine Plattform, und zwar so: „Wie viele Tabs hast du gerade offen? Unser Smartphone ist, egal bei welcher Beschäftigung, ständig parallel mit am Start. Das sind immens viele Eindrücke, die unser Gehirn verarbeiten muss. Die Folge: wir fühlen uns zerstreut und ausgelaugt. Nutze jetzt diese neue Smartphone-App, die dir hilft, weniger Zeit am Smartphone zu verbringen. Die App lehrt, die Momente zu identifizieren, in denen wir uns ans Smartphone hängen. In fünfminütigen Übungen werden wir dauerhaft in Impulskontrolle, Selbstreflektion, Achtsamkeit und Resilienz gestärkt.“ Eine wunderbare Idee. Es erinnert an die Idee des Teams um Greta Thunberg, die Klimaaktivistin nicht mit einem bösen Flugzeug, sondern an Bord eines Segelbootes über den Nordatlantik nach New York zu bringen für ihre berühmte zornige Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die Rede wurde auf YouTube gestellt und von 5,4 Millionen Menschen auf der ganzen Welt live verfolgt. Das verursachte 422 Tonnen Kohlendioxyd – so viel, wie bei 97 Transatlantikflügen entstehen. Dies offenbart, wie entscheidende Zusammenhänge im Themenfeld Smartphone und Internet generell im Dunkeln bleiben oder ganz bewusst unterbelichtet werden. Alleine die Videos, die im Netz abgespielt werden, erzeugen weltweit so viele Treibhausgase wie das Land Spanien. Und populäre Strea- minganbieter erzeugen so viele Emissionen wie Chile. Jede Whatsapp-Nachricht, jedes zuckende Werbebanner, jedes Selfie, jede Google-Suche und die riesige Tonnage an Mails und Spam im Netz beschäftigen Clouds, also eigentlich Rechenzentren, auf der ganzen Welt. Die sind jeweils so groß wie Shopping-Center auf der grünen Wiese und saugen unendliche Megawatt Strom. Und weil die Prozessoren jedes Watt in Hitze wandeln, braucht es noch weiteren Strom, um die chronisch Überhitzten wieder abzukühlen. Was Wunder, dass das Internet mit all seinen Angeboten zurzeit vier Prozent aller Treibhausgase global verursacht. Der internationale Luftverkehr bringt es übrigens auf 3,5 Prozent.
Von der Cloud zurück zum einzelnen Menschen. Nicht um zu klagen, sondern um bewusst zu machen. Aufschlussreich sind inzwischen viele wissenschaftliche Untersuchungen. Auch ganz schlichte. Etwa die, bei der drei verschiedene Gruppen von Menschen eine Aufgabe am Computerbildschirm lösen sollen, die konsequente kognitive Aufmerksamkeit verlangt. Eine Gruppe darf ihr Smartphone umgedreht auf dem Tisch ablegen, eine weitere muss es in die Hosentasche stecken, eine dritte muss es außerhalb des Testraumes lagern. Letztere erreicht klar die besten Testergebnisse. Die erste hat umgekehrt das größte Handicap: Das Gerät, das da umgedreht liegt auf dem Tisch, es zieht immense Quanten an Konzentrationsfähigkeit ab, da die Menschen stets erwarten, dass Wichtiges und Interessantes geschieht und vermeldet wird. Und sie es – versäumen.
Vielsagend, nicht zuletzt, auch das Echo des Smartphonismus in der bildenden Kunst. Beispiel: Die Malerin Sophie Gogl, 1992 geboren in Österreich, zeigt sich seit geraumer Zeit in ihrer Selbstporträtmalerei angemessen digital sozialisiert. Ob auf dem Bett, auf dem Sofa oder auf der Toilette sitzend – Gogl zeigt Oberkörper und Kopf, ihr Konterfei, stets illuminiert vom Schein des Smartphones, die Augen sind fest auf seine leuchtende Oberfläche gerichtet. So erzählt sie stimmig vom pausenlosen Aufgesogensein durch unentwegte Mitteilungs- und Bilderströme. Und zeigt pars pro toto: Das Werkzeug Smartphone ist auch in der Thematisierung durch die Bildende Kunst in der Welt des 21. Jahrhunderts angekommen.
Mit dem vorliegenden Band bringt die Literaturgruppe POSEIDON das Smartphone als Hauptthema ein in die Literatur. Von den 18 Autoren im Altersspektrum von 18 bis 90 Jahre sind 17 tatsächlich aus Fleisch, Nerven und Blut und mit organischem Zentralen Nervensystem versehen. Die Ausnahmen bilden die Storys Julia und Marc und „Schreibe ein Gedicht“. Sie wurden vom Chatbot ChatGPT (Generated Pre-trained Transformer) verfasst oder mitverfasst. Ja, diese Kostprobe waren wir uns schuldig in einem Band über die digitale Welt samt Ausblicken in die Sphären der Künstlichen Intelligenz und den vielen Befürchtungen und Erwartungen, wie das System KI auch die Buchbranche und das Schriftstellerdasein verändert, aufrollt, umwälzt. Unsere Autoren Marina D’Oro und Marc Mandel haben in einem Online-Dialog dem Chatbot mit wenigen Namen, Begriffen und Sätzen, quasi einem Minimal-Skript, den Auftrag gegeben, anhand dessen doch ein Stück Literatur zu verfassen. Und zackzack waren sie da, die kleinen Werkstücke. Urteilen Sie selbst.
Und nun, zuletzt, zu uns, den Autorinnen und Autoren dieser Anthologie. Auf eines legen wir nämlich alle und ohne Ausnahme großen Wert: auf Sie als die analoge, echt-menschliche Leserschaft mit Interesse, Emotion und Affekt. Und mit dem Spaß und dem Humor, das Phänomen literarisch zu verkosten.
Fritz Deppert
Es
Da lag Es oder Sie, noch wusste er nicht, wie er Es oder Sie ansprechen sollte, schwarz glänzend auf dem Tisch. Im Gegensatz zu einem Taschenspiegel, der mehr oder weniger fröhlich, je nach Tagesform und Grund, warum er aus der Tasche gezogen worden war, darauf bedacht war, seine Umgebung bis ins Detail abzubilden, eine finstere, tückisch glänzende Schwärze. Ein Geschenk seiner Kinder, das er nicht abweisen konnte, weil es gut gemeint war. „In Deinem Alter musst Du erreichbar sein!“, sagten sie in einem Ton aus Sorge und Bestimmtheit. Da er von Unklarheiten nichts hielt, entschied er sich für das neutrale Es und beugte sich über das schwarze Rechteck. Er sah sein eigenes Gesicht, leicht verschwommen aber identifizierbar und düster gefärbt, als blicke er schon aus dem Jenseits zurück. Als er es anlächelte, reagierte es nicht. Dann hörte er ein leises Hallo. Zunächst hielt er das für eine Einbildung. Die Fantasie, über die er in reichem Maß verfügte, spielte ihm wohl wieder einen Streich. Doch dann flüsterte es: „Du musst die Taste an meiner rechten Seite drücken, dann gehöre ich Dir.“ Da er nicht sicher war, ob er wollte, dass das schwarze Etwas ihm gehörte, zögerte er. Dann suchte er die Taste. Neugierig auf neue Erfahrungen war er zeit seines Lebens gewesen. Daran hatte sich auch im Alter nichts geändert. Nachdem er sie, schmal und unscheinbar und gleichsam verborgen, entdeckt hatte, nahm er das Ding in die Hand und drückte die Taste. Er war kein Technikfan. Trotzdem faszinierte ihn, was nun geschah. Farben huschten über die Fläche, bildeten Muster, aus denen Gegenstände wuchsen, Würfel, Kugeln und Säulen. Was er von den ersten Erläuterungen durch einen der Enkel behalten hatte, weil der es ihm eindringlich langsam vorgemacht hatte, war, dass er ein Muster zeichnen musste, einen Längs- und einen Querstrich, die einen rechten Winkel bildeten. „Willkommen“, sagte die Stimme zu ihm, die jetzt aus dem Bild einer Eule sprach. Auch dieses Bild hatte der Enkel in das Gerät hinein gezaubert, weil er wusste, dass Großvater Eulen sammelte. Ein schönes Bild, von Eulen gab es nur schöne Bilder. Die Stimme wirkte zwar einschmeichlerisch, aber kalt. So stand er nun da, das Ding, das Es, in der Hand und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Die Stimme forderte ihn auf, das Bild zu drücken und zu streicheln, dann stünde Es ihm zur Verfügung. Das wollte er eigentlich nicht. Aber die Neugier bewog ihn zu drücken und zu streicheln. Eine Kaskade von Tönen und Bildern prasselte auf ihn ein, so ähnlich wie aus dem Fernsehgerät, wenn er aus Langeweile über die dargebotenen Programme zappte und an Sender geriet, die ihm alles Mögliche verkaufen wollten, ob er es brauchte oder nicht. Mit Hilfe der Fernbedienungen drückte er die Programme weg. Aber was sollte er in diesem Fall machen? Er drückte, er streichelte, die Aufforderungen und Angebote wurden immer zahlreicher und aufdringlicher. In den Werbepausen kam Musik und beschallte seine Ohren. Als schließlich Helene Fischers Stimme ertönte, reichte es ihm. Er packte das Gerät in eine Tüte, zog seine Jacke an und begab sich auf den gewohnten Abendspaziergang, wenn auch früher als sonst. Unterwegs, als er sich sicher war, dass niemand ihn sah, warf er die Tüte in eine Hecke am Wegrand und kehrte erleichtert nach Hause zurück. Keine fremde Stimme empfing ihn, kein Gerät wollte gedrückt und gestreichelt werden. Zufrieden setzte er sich in den Sessel und las in dem Buch, das dort immer in Griffweite lag, in dem Fall ein Aufsatz darüber, wie Erdbeben entstehen. Am nächsten Morgen klingelte es, er öffnete, ein Junge stand vor ihm, etwa zehn Jahre alt, hielt das schwarze Ding in der Hand und sagte: „Das habe ich gefunden, es gehört Ihnen“ und strahlte ihn an. Er überlegte, ob er die Tür zuschlagen sollte, aber als er das glückliche Gesicht des Finders ansah, entschied er sich dazu, das Ding zu nehmen und dem Jungen einen Finderlohn in die Hand zu drücken. Da war Es nun wieder. Er legte es in eine Schublade, um in Ruhe zu überlegen, wie es weitergehen sollte. Doch vom Tag darauf an schellte es mehrmals täglich und ein Paket nach dem andern stapelte sich zuerst in seinem Flur, dann vor der Tür. Den Absendern nach, die er anfangs noch entzifferte, waren es Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Pillen für die Nachtruhe, Bücher mit allerlei Ratschlägen für allerlei Fälle, vom Schlaganfall bis zur Magenverstimmung, von Partnersuche bis zur Altersgymnastik, vom Verhütungsmittel bis zum Stimulator. Dann gab er es auf und rief seine Kinder zu Hilfe. Es war das erste Mal, dass er dies tat, denn sein Ehrgeiz war es, allein zurecht zu kommen. Aber er wusste keinen Ausweg. Sie kamen, schickten die Pakete zurück und blockierten in dem Smartphone alle Werbeangebote. Nun lag Es wieder auf dem Tisch, der schwarze Glanz schien matter geworden zu sein, sein Gesicht spiegelte sich verschwommen und verzerrt und die Aufforderung „Drück mich, streichle mich“ klang leiser und weniger verführerisch. Sie wirkte ein wenig kläglich. Trotzdem verfolgte sie ihn, wohin er in seiner Wohnung auch ging. Zuerst steckte er Es hinter die Bücher. Goethes Faust und E. T. A. Hoffmanns Zauberkünstler sollten es zum Verstummen bringen. Da er jedoch immer genauer hinhörte, sogar die Ohren spitzte, hörte er immer noch die Aufforderung „Drück mich, streichle mich.“ Nur das Ausrufezeichen dahinter hörte er nicht mehr. Als er alte Zeitungen auf den Dachboden brachte, packte er das Ding zwischen die Blätter und ließ es mit ihnen zusammen dort zurück. In der Wohnung war es still, kein Flüstern mehr, selbst wenn er angestrengt horchte; er genoss es. Nach zwei Tagen klingelten die Mansardenbewohner und beschwerten sich. Von seinem Dachboden kämen ununterbrochen Töne, als wäre dort eine Katze eingesperrt. Das störe sie sogar im Schlaf. Also tappte er, sich selbst dabei anknurrend, auf den Dachboden, holte Es und brachte es in den Keller. Das leise Weinen und die Aufforderung „Drück mich“ ignorierte er. Er legte es hinter die Weinflaschen und kehrte in seine Wohnung zurück. Es gelang ihm jedoch nicht, die Stimme und das klägliche Weinen zu verdrängen. Jedes Glas Wein erinnerte ihn. Er musste eine endgültige Lösung finden. Während er noch grübelte, strahlte Arte, sein Lieblingssender, eine Dokumentation über die Nibelungenfestspiele am Wormser Dom aus. Nachdem er die Sendung gesehen und das Fernsehgerät ausgeschaltet hatte, stand sein Entschluss fest. Am nächsten Tag fuhr er nach Worms zu der Stelle, an der angeblich Hagen den Nibelungenschatz in den Rhein geworfen hat, nahm Es aus der Tasche, drückte es und streichelte es, ließ die Bilder und Töne über sich ergehen als wäre er auf einem Jahrmarkt, und warf das Ding, seine Beschwerde „Das kannst du mir nicht antun“ ignorierend, in hohem Bogen in den Rhein. Nachdem er den Dom besucht und die romanische Architektur und ihre stille, beruhigende Frömmigkeit besichtigt hatte, fuhr er nach Hause, nahm das Nibelungenlied aus dem Bücherregal und stellte es in den öffentlichen Bücherschrank in seinem Viertel. Seitdem hat er von dem Es nichts mehr gehört. Die Kinder, die seine unwilligen Reaktionen auf Nachfragen scheuten, zuckten mit den Achseln und wagten ihn nicht mehr zu fragen. Manchmal meinte er, kurz vor dem Schlafengehn, wenn er im Sessel sitzend seinen abendlichen Rotwein trank und die Straße draußen und die Geräte drinnen in der Dunkelheit verstummten, noch ganz leise die Stimme flüstern zu hören: „Drück mich, streichle mich“.
Ein roter Stuhl
Nachdem er sich sicher war, dass er dort bleiben würde, hatte er nach einem Haus am Stadtrand gesucht. Er liebte es, zwischen seinen Arbeitsstunden am Schreibtisch lange Spaziergänge zu machen, um den Kopf frei zu bekommen und dann intensiv weiterarbeiten zu können. Nach Wochen der Suche fand er das, was seinen Vorstellungen entsprach, ein kleines Haus aus den neunzehnhundertfünfziger Jahren in einem Vorort, der sich auf dieser Seite nicht ausgebreitet hatte, weil das Land jenseits der Siedlung bewaldet war und unter Naturschutz stand wegen Wanderdünen, die jedoch schon lange nicht mehr wanderten. Ein schnörkelloser Nachkriegsbau ohne störende Auffälligkeiten, ein weißgetünchtes Viereck folgte auf das andere weißgetünchte Viereck. Ein alter, allein lebender Mann hatte es bewohnt, seine Frau war vor Jahren verschwunden, erzählte ihm die Tochter. Sie kümmerte sich um ihn und zwang ihn schließlich, als er gehunfähig und zeitweise dement geworden war, in ein Heim umzuziehen, obwohl er sich mit Händen und Füßen dagegen wehrte. Da sie Familie hatte und berufstätig war, musste sie so handeln, obwohl es ihr, wie sie versicherte, schwer fiel. Sie hatte ihn durch die bereits leergeräumten Räume geführt und er hatte ihr ohne Zögern zugesagt, es zu kaufen. Der Vertrag war inzwischen unterschrieben und vom Notar beglaubigt. Nach dem Treffen in dessen Büro wünschte sie ihm mehr Glück mit dem Haus, als sie es gehabt hätte. Als er beim Verabschieden ihr zartblaues Kleid bewunderte, errötete sie und antwortete: „Sagen Sie doch einfach Elvira zu mir.“ Jetzt gehörte das Haus also ihm. Die Schlüssel in seiner Hand belegten es. Er öffnete die auf den ersten Blick aus Metallgittern und undurchsichtigem Glas bestehende Tür, trat ein. Den größten Raum mit Blick zum Wald hin hatte er als sein Arbeitszimmer vorgesehen. In seiner Mitte stehend, wartete er, bis der Hall seiner Schritte sich verloren hatte und begann, ihn in Gedanken einzurichten. An der Innenwand fehlte eine Steckdose. Die würde er legen lassen müssen, weil er für die vielen Geräte, die er besaß – Computer, TV-Gerät, Musikanlage, Internetradio – eine Stromquelle brauchte. Als er sich bei der Schlüsselübergabe gewundert hatte, wieso diese Wand ohne Steckdose war, hatte Elvira einen flüchtigen Blick darauf gerichtet und kopfschüttelnd gesagt, dass sich ihrer Erinnerung nach dort sogar eine Doppelsteckdose befunden hätte. Er sah sich um in dem Zimmer, in dem er die meiste Zeit verbringen würde. Etwas störte ihn, einmal wegen seiner Farbe, braun und rot, und zum anderen, weil es sich als einziger Gegenstand in dem ansonsten leeren Raum befand: In der Mitte des Zimmers stand ein Stuhl. Roter, verblichener Stoff überzog Sitz und Armlehnen, die Holzteile, die aus dem Rot hervorragten, waren fleckig braun. Der ursprüngliche Lack war durch die Hände des ursprünglichen Besitzers abgeschabt. Vielleicht hatte der alte Mann dort darauf gewartet, dass der Umzugswagen zur Abfahrt bereit war, hatte sich erhoben und war mühsam, kaum die Füße von der Erde hebend, am Arm der Tochter zu ihrem Wagen gegangen und beide hatten den Stuhl vergessen. Also stand er da. Er wirkte verbraucht, abgenutzt, gealtert, obendrein täuschte er Qualität vor, die, nachdem der allgemeine Wohlstand ausgebrochen war, in den kleineren Besitztümern imitiert wurde. Man hatte überlebt und war wieder wer. Immerhin war er nicht aus den Fugen gegangen. Das Haus gehörte ihm, demnach auch dieses Zimmer und auch dieser Stuhl. Dass der Stuhl mitten im Zimmer stand, irritierte ihn. Seiner Erfahrung nach hätte er entweder am Fenster stehen sollen, damit der Besitzer den Auszug oder die nicht stattfindende Dünenwanderung beobachten konnte, oder in Türnähe, um dort darauf zu warten, abgeholt zu werden. Als er ihn zu einer dieser Stellen, nämlich dem Fenster, rücken wollte, ließ er sich nicht bewegen, so, als wäre er am Boden befestigt. Er kniete sich und suchte nach Befestigungen, konnte jedoch nichts finden, was darauf hindeutete. Als er sich erhob, knackten die Kniegelenke und signalisierten ihm, dass er nicht mehr der Jüngste war und solche Bewegungen unterlassen sollte. Er setzte sich auf den Stuhl, legte die Arme auf die Lehne, sah auf die leeren Wände und versuchte sich vorzustellen, wie er sie mit Möbelstücken und Bildern ausstatten könnte. Es gelang ihm nicht, seine Gedanken darauf zu konzentrieren. Sie schienen sich zu verselbstständigen und ihn auf eine Reise mitzunehmen, die aus verschwommenen Bildern bestand, denen er keinen Sinn zuordnen konnte. Wahrscheinlich spielte ihm die Fantasie einen Streich und er sah die Reihe der Vorbewohner durch das Haus pilgern, um sich zu verabschieden. Dann hörte er ein leises Summen, das aus der Wand zu kommen schien. Nachdem er sich erhoben hatte, war es nicht mehr zu hören. In den kommenden Tagen war er damit beschäftigt, seinen beweglichen Besitz in das Haus zu bringen, die Papiere, die kleinen Gegenstände, die Bücher, gerahmte Fotografien und vor allem die Geräte, die er nicht in fremde Hände geben wollte. Die Möbelstücke brachte eine Spedition. Er hatte einen vergilbten Grundriss erhalten, wahrscheinlich aus dem Bauantrag, und danach die Einrichtung vorgeplant, indem er Geräte und Möbelstücke mit dem Maßband auf ihre Breite überprüfte und die Zahlen mit Bleistift in den Plan an die Stelle schrieb, an der er den Gegenstand platzieren wollte. Irgendwem, vielleicht auch ihm, musste ein Messfehler unterlaufen sein, denn das zukünftige Arbeitszimmer erwies sich innerhalb der Seitenwände um circa 20 Zentimeter schmaler als im Plan angegeben. Doch die Gegenstände ließen sich um diese fehlenden Zentimeter zusammenrücken. Endlich befand sich alles an seinem Platz. Er setzte sich wieder in den Stuhl, da er sich mitten im Zimmer stehend anbot, um mit einem Blick rundum zu überprüfen, ob er mit dem Ergebnis zufrieden war. Kaum saß er dort, hörte er wieder das Summen. Es kam aus der steckdosenlosen Wand. Als er sich erhob, um darauf zuzugehen, konnte er das Geräusch wiederum nicht mehr hören. In den folgenden Tage beschäftigte er sich mit Einräumen und Umräumen, Aufstellen der Bücher, Ausbreiten der aktuellen Papiere auf dem Schreibtisch. Er vergaß das Summen, vergaß sogar den Stuhl, so als gehöre er dazu. Da er noch Fragen zu den Kellerräumen hatte, unter anderem zu einer etwa zwei Meter langen Rolle mit Plastikfolie, rief er Elvira an, um ihr die Fragen zu stellen. Sie konnte ihm zufriedenstellende Auskünfte geben; zu der Rolle meinte sie, sie stamme wohl noch aus der Bauzeit und er solle sie einfach wegwerfen. Offensichtlich war sie erleichtert, dass der Verkauf des Hauses reibungslos vonstatten gegangen war und wurde gesprächig. So erfuhr er, dass ihre Mutter vor Jahren den Vater wegen eines anderen Mannes verlassen hatte und zwar sehr plötzlich. Sie brach alle Kontakte ab. Versuche, sie aufzufinden, waren erfolglos. Zu diesem Zeitpunkt lebte die Tochter bereits nicht mehr im Haus; sie hatte eine eigene Familie, darunter ein Baby, das alle ihre Kraft forderte und aufzehrte. Zwar konnte sie nach einiger Zeit den Mann ausfindig machen, in den sich ihre Mutter verliebt hatte, aber er erklärte zu ihrer Überraschung, dass ihre Mutter zu dem Treffpunkt damals nicht erschienen war und sich auch danach nicht mehr gemeldet hätte. Ihr Handy wäre auf Anrufbeantworter geschaltet gewesen und seine Versuche, sie bei ihrem Ehemann entdecken zu können, wären erfolglos geblieben, obwohl er tagelang das Haus beobachtet habe. Schließlich hätte er aufgegeben. Vater und Haus wären ihr zu der Zeit fremd geworden, ohne dass sie es erklären könnte. Vielleicht, weil sie das Gefühl hatte, dass der Vater nicht mit ihr über die Mutter sprechen wollte und auch nicht besonders erfreut schien, wenn sie ihn besuchte. Es sei auch nie eine Verbindung zwischen ihm und seiner Enkelin, ihrer älteren Tochter, entstanden, er habe abweisend gewirkt und es damit begründet, dass sie seiner verschwundenen Frau allzu sehr ähnlich sei. Zum Beispiel habe er sie beide nicht ins Haus gelassen, wenn sie ein blaues Kleidungsstück trugen; sogar auf ein blaues Haarband habe er reagiert und die Enkelin erst eingelassen, nachdem sie es ablegt hatte. Folglich besuchten sie ihn selten. Erst seine altersbedingte Hilflosigkeit habe sie wieder öfter im Elternhaus zusammengebracht. Die Frage nach dem roten Stuhl beantwortete sie mit dem Vorschlag, ihn in den Sperrmüll zu geben. Er erinnere zu sehr an die letzten Jahres des Vaters, den sie bei ihren wenigen Besuchen stets in diesem Stuhl antraf, und sie habe jedes Mal den Eindruck gehabt, als enthalte dieser Stuhl ein Geheimnis, das er vor ihr verberge. Nach dem Gespräch untersuchte er den Stuhl, ohne etwas Überraschendes finden zu können. Er tastete die zum Teil verschlissenen Polsterungen ab, drehte und wendete ihn, stellte ihn auf den Kopf, ohne sich zu wundern, dass er ihn plötzlich bewegen konnte. Als er sich danach setzte, hörte er wieder das Summen. Während er sich auf das Geräusch konzentrierte, spürte er unter der rechten Hand eine raue Stelle auf dem Holzteil der Lehne und entdeckte eine in das Holz geritzte Zahl. Der Länge nach war es kein Code oder eine Bankgeheimzahl oder dergleichen. Ein Datum konnte es auch nicht sein, die Punkte fehlten. Die ersten Ziffern 04917 kamen ihm bekannt vor. Es war eindeutig eine Handynummer. Er zögerte anzurufen, setzte sich stattdessen an seinen Schreibtisch, versuchte einen angefangenen Text weiterzuschreiben. Seine Gedanken kehrten immer wieder zu der eingeritzten Nummer zurück. Auch die Blicke aus dem Fenster auf die über die Düne herüber rotbraun leuchtenden Stämme der Kiefernbäume vermochten es nicht, ihn abzulenken. Also erhob er sich, ging zu dem roten Stuhl zurück, setzte sich, nahm sein Smartphone und wählte die Nummer. Ein Klingeln erschreckte ihn, es war deutlich zu hören und es kam zweifelsfrei aus der Wand. Als es in seinem Phone piepste und eine Stimme ihn aufforderte, eine Nachricht zu sprechen, schaltete er hastig ab. Er sprang auf, lief hin und her, setzte sich wieder und wählte die Nummer erneut. Wieder kam das Klingeln aus der Wand. Jetzt stellte er sich dorthin und drückte die Wiederholungstaste. Er konnte es nicht überhören. Als er ein Ohr an die Wand presste, hatte er das Gefühl, ein Telefongerät befände sich direkt neben seinem Kopf und sende aufdringlich laute Klingeltöne. Auch die Ansage, die ihn aufforderte, seine Nachricht zu sprechen, dröhnte in sein Gehör, als stünde die Sprecherin neben ihm. Nun musste er sich bewegen, hin und her, im Zimmer, dann vor dem Haus, um das Haus herum, und die nächsten Schritte bedenken. Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, kehrte er zurück, überprüfte durch wiederholten Anruf seinen Eindruck. Es war keine Einbildung. Der Ton war real und genau zu orten. Daraufhin stand sein Entschluss fest. Zuerst klopfte er die Wand ab und stellte fest, dass sich dahinter offensichtlich ein Hohlraum befand. Dann holte er einen Hammer und schlug auf sie ein. Sie zeigte Risse, bröckelte, ein Loch tat sich auf. Hinter dem Loch nur Dunkelheit und auch die herbeigeholte Taschenlampe fand nur Hohlraum und Teile einer Plastikfolie. Noch am gleichen Nachmittag bestellte er einen Hausmeisterdienst. Die Nacht verbrachte er unruhig, wenn er einschlief, träumte er, er wäre in einer Kiste eingesperrt, könnte nicht heraus und auf seine stummen Angstschreie reagierte niemand. Am Vormittag kamen zwei Männer in blauer Arbeitskleidung, besahen die Wand, klopften daran, wie er es getan hatte, und erklärten, hinter der gesamten Wand befände sich tatsächlich ein Hohlraum; mit seinem Einverständnis würden sie diese offensichtlich nur aus verputzten Platten bestehende Verkleidung entfernen. Er nickte, setzte sich in den roten Stuhl und sah zu. Die beiden räumten die von ihm aufgestellten Möbelstücke weg, legten Folie aus, befeuchteten die Wand wegen der Staub- entwicklung, und schlugen zu. Stück für Stück brach sie heraus und enthüllte eine weitere Wand. Als sie zu der Stelle kamen, an der er das Klingeln geortet hatte, hörten sie auf und erklärten, im Zwischenraum befände sich ein größerer Gegenstand. Dann lösten sie mit vorsichtigen Hammerschlägen nur noch kleine Stücke. Zum Vorschein kam eine mehrfach mit einer Folie umwickelte Leiche, dem noch erkennbaren, wenn auch teilweise vermoderten blauen Kleid nach eine Frauenleiche. Sie schien ihn anzustarren. Nachdem sie sich von ihrem Schreck erholt hatten, sowohl er als auch die beiden Handwerker, riefen sie die Polizei und gaben ihr eine genaue Beschreibung des Vorgangs. Sie kamen zu mehreren, Uniformierte und welche in weißen Kitteln, und untersuchten den Fund. Dabei sah er, dass eine Schnur aus der Folie heraus und zu der Doppelsteckdose an der inneren Wand führte. Ein Ladekabel. Beim Öffnen der Folie kam ein Handy älteren Baujahres zum Vorschein. Es war an das Kabel angeschlossen. Er berichtete den Beamten von seinen Anrufen, die baten ihn daraufhin, erneut die Nummer zu wählen und, obwohl sie es erwartet hatten, erschraken alle, als das altertümliche Gerät laute Klingelzeichen von sich gab. Inzwischen traf auch die von ihm benachrichtigte Tochter Elvira ein und bestätigte, dass ihre Mutter das blaue Kleid getragen hatte, als sie verschwand. Auch die Handtasche, die in die Folie mit eingewickelt war, erkannte sie. Da sich dort der Ausweis der Mutter fand, stand fest, wer die Tote war. Die scheinbare Gefasstheit Elviras war zu Ende, sie rannte schreiend aus dem Haus. Einer der Beamten drückte ihm ein Protokoll der polizeilichen Untersuchung in die Hand und bat ihn, es zu unterschreiben. Inzwischen transportierten die Männer in den weißen Kitteln die Leiche mitsamt der Folie ab, um in der Pathologie die Todesursache feststellen zu können. Nur er und die beiden Handwerker blieben vor der heruntergeschlagenen Wand zurück. Sie baten ihn um eine Pause. Auch sie waren betroffen von dem, was sie vorgefunden hatten. Doch sie versprachen, am nächsten Tag wiederzukommen, den Schutt wegzuräumen und die zum Vorschein gekommene Wand herzurichten. Er gab ihnen beim Verabschieden den Auftrag, sie zart blau zu streichen, dann setzte er sich in dem plötzlich totenstillen Raum in den roten Stuhl und versuchte, das Erlebte zu sortieren und zu verkraften. Danach legte er ein unbeschriebenes Blatt Papier auf die Schreib- unterlage seines Arbeitstisches und beschriftete es schwungvoll mit einem einzigen Wort: Elvira. Anschließend stellte er den Stuhl auf die Straße und schloss das Haus ab, als könnte er auf seinen vier Holzbeinen zu ihm zurückkehren wollen.
Iris Welker-Sturm
Smart brain for free
Zur Zeit der Pandemie habe ich das Spielen auf dem Smartphone entdeckt, traditionelle Brett- und Kartenspiele, die ich sonst mit Freund! nnen spielte, kann man hier gegen den Computer spielen. Es gibt sie kostenlos, nimmt man die allgegenwärtige Werbung, die Datenveräußerung und die entstehenden Stromkosten in Kauf. Von Aufforderungen wie „Zeit, dein Gehirn zu trainieren“ oder auf die Empfehlung „von Ärzten“ lasse ich mich zur „daily challenge“ verlocken. So habe ich die Herausforderung für den 14. Februar angenommen – „füllen Sie das Herz für IQ 140+“ – das Display beglückwünscht mich mit einem Sternchen, obwohl ich beim ersten Mal gescheitert bin. Auf die Aufforderung „spiel das und bleib scharf“ hingegen habe ich mich nicht eingelassen; ich war mir nicht sicher, wie scharf ich bereits bin und wie weit ich in dieser Hinsicht gehen will. Die so genannten Reisen, bei denen man mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad von level zu level turnt, bergen Suchtgefahr. Über diese Schiene und permanente Belobigungen lässt man sich fast unbemerkt zu Bezahlvarianten locken. Die schrägen Übersetzungen und Hinweise belustigen mich anfangs. Da wird ein „gewinnendes Spiel“ angepriesen, man verspricht mir „hektarweise Spaß“, wenn ich „meinen Drachen entwickle“. Beim Skattreff kann ich „Hinterhand“ spielen. Ich kann prüfen, ob ich etwa ein „Schläfenlappengehirntyp“ bin, und „Easy brain“ schätzt mein Gehirnalter auf 35 – ich kann mich nicht entschließen, ob ich versuchen soll, mich weiter zurück zu entwickeln. Neben allgemeiner Werbung werden eine Unzahl weiterer Spiele angepriesen – zunächst meist „for free“. Nicht immer kann ich das Spielerische nachvollziehen, wenn z. B. eine frierende Frau mit Kind im Schneetreiben vor sich hin zittert, weil sie von Ehemann oder Richter aus dem Haus gewiesen wurde. Ich könnte sie oder auch die spärlich bekleidete junge Frau, die über einem Feuer hängt, retten, wenn ich schnell genug die richtigen Klötzchen verschiebe, gibt man mir zu verstehen. Bei fast jeder Spielewerbung bin ich gezwungen, passiv mitanzusehen, dass eine Katastrophe nicht verhindert wird oder dass das Opfer gar zu Tode kommen wird, wenn ich mein begonnenes Spiel weiterspielen will. Bei „royal match“ gibt es sogar eine Königsfigur, einsam und von Unbill verfolgt, die völlig hilflos auf Rettung von mir wartet. Er winkt, mit der flachen Hand versucht er die ihn verfolgenden Speerspitzen abzuhalten und gleichzeitig wegzulaufen. Der nächstfolgende Werbespruch „the sneaker makes the man“ lässt mich vermuten, dass er nur nicht die richtigen Schuhe gewählt hat. Wie er wohl auf den Slogan „bleiben Sie den ganzen Winter über trocken“ reagieren würde, wenn ihm in einer anderen Folge Ertrinken droht? Aber vielleicht ist ja „das Besondere näher als wir denken“ oder aber wir denken nicht weit genug. Über die Methode, die das Spiel „rise of Empire“ empfiehlt, konnte ich noch verwundert den Kopf schütteln und die imperialistische Haltung beklagen, mit der der Held einen Menschen aus dem Wasser zieht und ihn umgehend für sich schuften lässt, ihn offenbar auch zur Vermehrung heranzieht, oder woher kommen auf der einsamen Insel plötzlich die zahlreichen Frauen? Als Kohorte kommandiert sie der Held zur Feldarbeit. Im Trailer erlebt man sie nur gebückt. Erschreckt haben mich dagegen in letzter Zeit vermehrt auftauchende Spiele anderer Art. Eines stellt zum Beispiel die provokante Frage „Was machst du so, um dein Heimatland zu verteidigen?“ und die Antwort ist: „Ich spiele als x-Land … ich baue Raketen … Da kommen Schiffe direkt auf uns zu … aber meine heftigen Raketenbomber werden mit denen schon fertig werden“ – und dann der Hinweis „call of war – world war II – install now“. Sie heißen „top war battle time“, „stormshot“ oder „total battle“ und ich werde aufgefordert „defeat all your enemies“ und „start now“. Der Fußballreporter neulich hatte wohl Ähnliches gesehen, als er mehrmals von „wegverteidigen“ sprach. Ich sehne mich nach Spielanweisungen zurück wie „erst denken, dann ziehen“. Vielleicht kann ja die zwischen den Kriegsspielen platzierte andere Werbung zum Denken anregen: „Sterbegeld ab 6,31 € mtl – mit ANNA – Mutterliebe versichern“.
Schlüsselrolle
Seinen Wohnungsschlüssel hatte sie ihm zurückgeschickt, um ihre Worte zu bekräftigen. Sie kann und will nicht so einfach auf Freundschaft umschalten, wie er sich das vorstellt. Das längliche Briefkuvert blau, die Farbe schien ihr in mehrfacher Hinsicht passend. Papierschnipsel der letzten nicht eingelösten Versprechen polsterten aus, ein langer Klebestreifen verschloss das Kuvert. Einschreiben mit Rückschein, so würde sie wissen, dass und wann die Sendung angekommen ist. Ein klarer Schlussstrich. Es war alles gesagt. Nun würde sie Ruhe haben.
Sie hatte sich getäuscht. Gegen 23 Uhr am folgenden Abend erschien ein Foto auf dem Display ihres Smartphones. Es zeigt die Rückseite eines offenbar geöffneten blauen Briefumschlags, nachlässig wieder verschlossen mit zerknittertem Klebestreifen, schräg über die Kuvertklappe geklebt. Da hatte sich jemand dran zu schaffen gemacht. Die beigefügte Nachricht fragte, ob es richtig sei, dass der Brief „nur mit einem Tesastreifen gesichert“ gewesen sei. Leicht irritiert, rafft sie sich zu einer flapsigen Antwort auf: „Nein, zugeklebt war er auch.“ Die folgende Nachricht erwischt sie schon halb im Schlaf. Es habe Scherben gegeben, er habe sich an der Hand verletzt und blute. Zusatz mit Sternchen „Briefinhalt – nur die Schnipsel der Einladungskarten.“
Was war das Ziel dieser Nachricht? Sollte sie jetzt Mitleid bekunden? Hatte sie den Brief nicht gut verschlossen? Dann hätte ihn der Mann am Postschalter doch aber wohl nicht so angenommen. Konnte jemand den Schlüssel herausgenommen haben? Dann hätte er doch wohl die Spuren zumindest zu verwischen versucht oder gleich den ganzen Brief verschwinden lassen. Es war spät in der Nacht, aber an Schlaf nicht mehr zu denken. Vielleicht wollte er ihr nur ein schlechtes Gewissen machen. Verwirrt ließ sie die Nachricht ohne Antwort, schaltete auf stumm. Der Eindruck verdichtet sich, als sie am nächsten Morgen die dritte Nachricht liest: „Ich sehe grade, dass auf der Vorderseite Einschreiben mit Rückschein vermerkt ist – ich habe keinen Empfang quittiert – von daher meine Frage, warum Einschreiben mit Papierschnipseln, ein einfacher Brief hätte es doch auch getan.“ Sie soll offenbar zu einer Antwort gedrängt werden. Wenn der Schlüssel nicht im Brief war, wieso spricht er dann von „nur“ und „gesichert“? Sie hatte doch weder im Brief, noch in einer Nachricht etwas vom Schlüssel erwähnt. Jetzt ist sie doch froh, dass sie den Brief nicht selbst eingeworfen hat und wird erst einmal die Rückmeldung der Post abwarten.
Sie entschließt sich zu einer hinhaltenden Antwort: „Ich habe meine Gründe.“ Die Fragen, die ihr durch den Kopf gehen, lassen sich nicht so leicht abstellen. Hatte der Postbote etwa die Sendung gar nicht quittieren lassen und lediglich in den Postkasten gesteckt? Zwei Tage gingen ins Land. Dann endlich von der Post die Mitteilung, dass der Brief drei Tage davor dem Empfänger Rudi Kramers zugestellt und ordnungsgemäß vom Empfänger quittiert worden sei. Die Unterschrift, leicht krakelig, lesbar als Rudi Kramer. Von Beschädigung oder „geöffnet von der Post“ stand da nichts. Wieder setzt das Gedankenkarussell ein: Er hatte doch geschrieben, er habe keinen Empfang quittiert? Sollte der Postbote ihn nicht angetroffen haben und zu faul gewesen sein, das Schreiben zur Poststation zu bringen? Reichlich unwahrscheinlich, dass der es auch noch selbst unterzeichnet haben könnte. Aber wenn jemand den Schlüssel entnommen hat, hätte er ja die Adresse und könnte sich jederzeit Zutritt zu seiner Wohnung verschaffen. Müsste bei offensichtlicher Beschädigung nicht der Empfänger protestieren und nicht unterschreiben? Hatte etwa gar ein Nachbar oder Fremder unterschrieben? Sie vergleicht die Unterschrift mit früheren Signaturen ihres Expartners. Die wenig ausgeschriebene Handschrift passt; das R zu Beginn ist ein wenig ungelenk und größer als sonst; und es fällt ihr auf, dass am Ende des Nachnamens ein s fehlt. Sowas merkt ein eiliger Postbote vielleicht nicht.
Füße stillhalten. Nicht provozieren lassen. Sie ist sich mittlerweile fast sicher, dass der Schlüssel sehr wohl im Brief war, auch, dass er ihn entgegengenommen hat und verärgert war. Jetzt will sie sehen, wie weit er das böse Spiel treibt. Sie schickt ihm ein Foto des Rückscheins und empfiehlt, falls er das nicht geschrieben habe, zur Polizei zu gehen. Und tatsächlich, er schreibt, das werde er tun, wenn er in den nächsten Tagen zurück sei von seiner Reise. Aber vorher fragt er noch einmal unter seinem Nickname an, vorher wolle er doch noch wissen, ob er nur Unterschriftenfälschung oder auch Diebstahl anzeigen solle. Dies neuerliche Insistieren bestärkt sie. Jetzt soll sie wohl Angst haben, dass jemand bei ihm einbrechen könnte. Wenn er wirklich befürchten würde, dass jemand seinen Schlüssel entwendet hat, würde er wohl kaum so ruhig bleiben und verreisen. Sie kennt seine leicht aufbrausende Art.
Er kennt sie und ihre üblichen Reaktionen wohl auch. Das Grübeln kann sie nur schwer abschalten. Da fällt ihr eine Story ein, die er ihr mehrmals kopfschüttelnd erzählt hat: Von offizieller Seite sei er darauf hingewiesen worden, dass seine Unterschrift nur mit vollem Namen gültig sei, so wie es im Pass steht: Das wäre Rudolf-Dietrich Kramers und auch der Bindestrich sei Bestandteil seines Namens. Sie erschrickt. Sie traut ihm zu, dass er lügt, sich solche Winkelzüge ausdenkt und sie auf diese Art unter Druck setzen will. So viel zum Freundschaftsangebot. Aber der Polizei würde er wohl kaum einen solchen Bären aufbinden wollen und können. Bevor er am Ende vielleicht noch einen Einbruchdiebstahl vortäuscht, blockiert sie ihn auf allen Kanälen.
Ewart Reder
Der Spiegel der Doria G.
In dem gemütlichen und abwechslungsreichen Land Analogonien lebte einst ein junger Prinz ein landesübliches Leben: gemütlich und abwechslungsreich. Ihm fehlte nichts von dem, was ihm Freude bereitete, auch nichts von dem anderen, das zum Leben gehört, das die Freude nicht zu groß werden lässt. Nur eine Frau hatte er noch nicht gefunden und darum reiste er viel, weil er dachte: Alle sehen heißt auch die Richtige sehen. Tatsächlich war es eine Reise, seine dreihundertsiebzehnte, die den Prinzen in das Land Virtu Al Virtus und dort zu einer auf den ersten Blick bereits unentrinnbaren Frau führte. Sie hieß Prinzessin Doria G. (Name von der Redaktion geändert) und war eine jener Frauen, deren sichtbare Reize dadurch ins Unermessliche gesteigert werden, dass hinter ihnen noch eine Zugabe zu liegen verspricht, die, zum Sichtbaren addiert, unermesslich sein muss, weil sie mit jedem Reiz, den die Frau nach und nach offenbart, immer mitzuwachsen scheint, sodass das Versprechen nie abnimmt, ja, nicht einmal gleichbleibt. Um ein Beispiel zu geben: Der Rücken der Prinzessin Doria erschien dem Prinzen als die Brücke ins Paradies. Er konnte sich keine anmutiger geschwungene Verbindung zwischen Kopf und Hintern einer Frau vorstellen als die unter Dorias Kleid sich abzeichnenden dreiunddreißig Wirbel. Aber eine Brücke führt eben wohin. Und ein gebeugter Rücken ist nicht alles, was ein Rücken sein kann, dachte der Prinz jedes Mal, wenn er Dorias Rücken betrachtete. Denn Doria saß immer vorgebeugt. Selbst wenn sie einmal stand, beugte ihr Rücken sich vor, sodass eigentlich nur Dorias Beine standen, nicht Doria insgesamt, vielmehr Dorias Oberkörper auch im Stehen vorgebeugt auf ihren Beinen saß wie auf jenem Sofa, auf dem Doria sonst den ganzen Tag saß. Und was machte Doria in dieser Haltung beziehungsweise was machte, dass Doria diese Haltung zu ihrer Lebensgrundhaltung gemacht hatte? Es war ihr Zauberspiegel, in den Prinzessin Doria den ganzen Tag sah, ein mittelkleiner rechteckiger Handspiegel, der Dorias Erwartung an das Leben vollständig enthielt. Schade, dachte der Prinz, dass ich diesen Rücken noch nie habe auseinanderfahren sehen wie eine Schlange, die sich erinnert daran, eine Schlange zu sein, die sich erinnert daran, eine Schlange zu sein, die sich erinnert ... Aber zurück zu dem Spiegel. Noch ein anderes Problem machte der unserem analogonischen Prinzen. Er wusste nämlich nicht, wie seine erstmalig geweckte Liebe (die er zugleich für die letzte seines Leben hielt) einer Frau mitgeteilt werden konnte, die noch nicht mal sein Gesicht, geschweige denn die darin abgezeichneten Liebesgefühle anguckte, weil sie nur immer in den Spiegel sah. Alles hatte der Prinz versucht, Händeklatschen, Zwicken, Stricknadelstiche, einen Chinaböller direkt am Ohr der Prinzessin gezündet – vergebens. Ihm war klar: Er musste einen anderen Weg gehen zum Auge und dahinter zum Herzen von Prinzessin Doria, und er war bereit diesen Weg zu gehen. So sicher das Kamel durch das Nadelöhr gehen muss (weil das Gleichnis sonst nicht funktioniert), so sicher würde er ins Innere des Zauberspiegels vordringen, weil Prinzessin Dorias schöne Augen darauf und auf nichts sonst in der Welt ruhten. Zuerst atmete er ganz tief aus, das verkleinerte seinen Körper schon mal um zehn Prozent. Dann hielt er die Luft einfach an und weigerte sich wieder einzuatmen. Das brachte noch mal fünf Bonusprozente, wegen Kühnheit. Er aß nicht mehr, trank nicht mehr, aber das Vollprogramm, ohne Nachtbulimie wie beim Ramadan. Satte dreißig Prozent für dreißig Tage gabs dafür. Am Ende kaufte er sich dreißig gebrauchte Computertastaturen, knipste die Minustasten raus und spülte eine nach der anderen mit „Doktor Alberichs Verkleinerungswasser“ durch die Gurgel in den eigentlich dafür schon zu kleinen Magen. Der Zoomeffekt brachte den Durchbruch. Mädchenfingergroß stand der Prinz neben dem Zauberspiegel, den Prinzessin Doria für eine Sekunde aus den Augen verloren hatte. Aber was jetzt? Wie rein in das Ding? Und genau das, was so unmöglich aussieht – das war in derselben Sekunde schon passiert! Verrückterweise. Der Zauberspiegel fand nämlich, dass der Prinz mit seiner Liebesdiät die Voraussetzungen eines Zauberspiegelinhalts nach dem Gesetz von Virtu Al Virtus bereits erfülle: Verrücktheit. Und machte keine langen Anstalten, machte einfach auf. Beam-Bang nennt man das. Der Prinz war drin. Bildschirm an und da lächelte er. Und Prinzessin Doria war sofort weg. Also hin. Sie wollte sofort heiraten. Da passierte aber etwas, das Prinzessin Doria in ihrem Zauberspiegel noch nie passiert war. Plötzlich stand ein anderer Mann neben dem analogonischen Prinzen und behauptete, er sei der eigentliche Prinz aus Analogonien und der andere sei ein Fake. Der Mann aber, der dies behauptete, war der überhaupt unattraktivste Mann, den der Zauberspiegel der Prinzessin jemals für ein Date angeboten hatte. Er sah aus wie ein Baby, das, ohne zwischendurch ein Mann gewesen zu sein, schon ein Greis geworden war, also total weiche Haut, aber komplett in Falten, mehr Teebeutel als Mensch. Und als ob das wichtig gewesen wäre, hatte er noch nicht mal ein Gesicht. Die Prinzessin schrie vor Verwirrung. Was war denn hier los? Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es die Liebe wirklich gab, aber jetzt wusste sie es ja und zugleich wurde behauptet, der, den sie liebte, existiere gar nicht? Sie hätte beinahe den Zauberspiegel ausgemacht, so verwirrt war sie. Der angeblich gefakte Prinz machte jedoch etwas ganz Einfaches und das Problem löste sich dadurch auf. Der Prinz griff nach dem Mann, der das Ungeheuerliche behauptet hatte, packte ihn an zwei Falten, die man für Ohren hätte halten können, küsste ihn mitten in das, was von der Lage her das Gesicht hätte sein können, falls vorhanden. Und im selben Moment war der Teebeutelgestaltige weg und nur noch der echte und einzige Prinz blieb übrig. Genauso toll wie vorher sah er aus und von manchen Stellen seines Körpers strahlte für Sekundenbruchteile eine kleine „100“ auf, in hellblau, in gelb, in rosa, in hellgrün, verblasste dann wieder und ließ nur den appetitlichsten Körper zurück, den Prinzessin Doria in ihrem jungen Leben je gesehen hatte. Gleich wollte sie wieder heiraten. Und jetzt wollte sie auch küssen. Das war aber nicht so einfach. Öffnete sie die heiß an der Zauberspiegeloberfläche haftenden Lippen, so vergrößerte der Prinz sich, statt gut zu schmecken. Schloss sie die Lippen schreckhaft, so verkleinerte der Geliebte sich, was ihr noch viel weniger gefiel. Mit der Zunge erreichte sie gleich gar nichts als unangenehm elektrische Empfindungen – nass wie die Tränen, die bald von außerhalb des Bilds über den Zauberspiegel gelaufen kamen. Es war ihr bislang größter Frust. „Halte ein“, sagte der Prinz. „Du musst zu mir in den Zauberspiegel kommen, dann wird alles gut.“ „Wie jetzt?“, fragte Prinzessin Doria. „Das geht doch gar nicht.“ Doch, es gehe, sagte der Prinz. Und zwar „müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen“, wenn er mal Kleist zitieren dürfe. „Im Märchen geht das, Herr von Kleist“, fügte der Prinz hinzu sehr zum Missfallen von Prinzessin Doria, die sich davon nicht angesprochen fühlte. Komischerweise kam sie aber selbst drauf, was zu tun war. Sie hungerte ihrerseits dreißig Tage, schaute von hinten in ein Fernglas, las als erstes Buch ihres Lebens eine Kinderausgabe von „Der kleine Däumling“, ließ Google per Gesichtssuche ein Satellitenbild von sich selbst anzeigen, hatte lauter gute Einfälle und musste am Ende sogar fünf Schritte in der Browserchronik wieder zurückklicken, bis sie fünf Zentimeter groß neben ihrem Zauberspiegel stand. Und klingelte ... nee, das haben die Dinger ja nicht (noch nicht). Und Einlass begehrte. Das können die jungen Dinger, wie sie alles können, was unbedingten Gehorsam verlangt. Und so kamen der Prinz aus Analogonien und die Prinzessin Doria G. aus Virtu Al Virtus doch noch zusammen. Allerdings nur, um eine Wiederholung dessen zu erleben, was ihren Spaß vor einigen paarunddreißig Tagen schon mal gebremst hatte. Eine andere Frau trat nämlich zwischen sie und behauptete, die wahre Prinzessin Doria G. zu sein. Die andere sei ein Fake. Die angeblich wahre Doria sah jetzt aber richtig schlimm aus. Nicht wie ein Teebeutel. Eher wie ein Mensch, der versucht haben musste, ein kubisches Stück Fleisch zu werden. Wie deutlich soll ich werden? Haben Sie mal einem Verkehrsunfall beigewohnt, bei dem der Fahrer nicht angeschnallt war und sein Körper beim Aufprall die Form des vorderen Teils der Fahrgastkabine ... Nein. Es lässt sich nicht beschreiben. Auch das Märchen muss seine Grenzen kennen. Prinzessin Doria schrie ungefähr eine halbe Stunde. Dann machte sie etwas, das auch nicht immer hilft. Nämlich etwas, das jemand anders mal gemacht hatte und das in der Situation geholfen hatte. Sie küsste das kubische Stück Fleisch ungefähr dahin, wo die wichtigsten Icons auf der Zauberspiegeloberfläche sich befunden haben würden, wenn das Stück Fleisch ein Zauberspiegel gewesen wäre. Und was soll ich sagen – damit war sie weg. Aber nicht so wie damals, nicht hin und weg und verliebt. Nein. Sie war verschwunden. Übrig blieben das kubische Stück Fleisch und der Prinz aus Analogonien. Der wollte dann auch nicht mehr so richtig, und wenn es kein Märchen wäre, wären die beiden definitiv nicht zusammen alt geworden. Weil es aber ein Märchen ist, sagte das kubische Stück Fleisch zu dem Prinzen aus Analogonien: „Komm Schatz, mach das Ding doch mal aus.“ Und nahm ihm das Ding weg und machte es aus. Und sah den Prinzen an. Und da merkte der, dass sie eigentlich doch wunderschön war. Und wenn die beiden vielleicht auch nicht ewig zusammenbleiben, können sie es jetzt wenigstens mal probieren miteinander. Tom Wolff
3snaps
countdown
drei prozent akku sehr schwach an einem dünnen ladebalken hängt deine message dein bild dein neues profil dicke sonnenbrille die haare streng zum dutt schulterblick weg von der kamera bist das du jetzt
zwei user ein herz ein perfektes matching 97 Prozent auf der dating app gute passung das muss was werden sagten wir beschlossen wir wischten alle zweifel vom schirm nur dein profil warst nicht du war ein datensatz nicht kompatibel mit meinen analogen fehlern meinem unverpixelten gesicht meine ladung extrem schwach
eins muss ich dir noch sagen noch tippen mein profil mein perfektes wochenende ausschlafen kuscheln joggen pizza mit viel chili mit anchovis mit allen freunden mein spaß am kitesurfen snowboarden sundowner down under meine lust auf neue horizonte das bin nicht das war nie das gerät schaltet jetzt in den ruhemodus
fail
Gibma Handy Gib Kommando Pizza ordern Lieferando
Wodka alle Alle wollen Lassma liefern Lass Gorilla rollen
Geiles Hoody Nices Shirt Von Zalando? Nee von Muddi Voll der Nerd
Lassma los Bestell’n Benser Car2Go Raus aufs Land Oder so
Checkma den Trecker Honk am Steuer Voll der Checker Sagt er bestellt Bestellt sein Feld
flashback
wie wäre das wieder kreise drehen mit der wählscheibe deine alte nummer hauptstadtverbindung elf ziffern elfmal bis zum anschlag kurbeln elfmal schnarrt die scheibe zurück spannt sich die spiralschnur zerrt am hörer widerspenstig von meiner hand bis zum wandgerät im flur im wohnheimdunkel schritte hallen türen knallen neon flimmert die alte wohnheimluft voll bohnerwachs und fett und schweiß ich in gedanken schon fast bei dir
wie wäre das wärst du grad unterwegs und gingst nicht ran wärst du zuhause dösend lesend auf deinem jugendbett würde der dicke grüne apparat an eurer küchenwand mit schrillem krächzen dich aus dem halbschlaf reißen und du die treppe runtereilen knarrendes holz freudiges poltern du mit nackten füßen über die kalten küchenfliesen klatschen den hörer hastig von der gabel reißen das knacksen in der leitung wie ein kuss wie wäre das
Stefan Benz
Der letzte Kumpel
Linux war das letzte Kind, das ein Smartphone kriegte. Beweisen ließ sich das bei zehn Milliarden Menschen auf der Erde natürlich nicht. Aber sein Onkel hatte das ja auch bloß gesagt, um den Vater zu ärgern, der in der Familie immer schon als rückständiger Nostalgiker gegolten hatte. Wer benannte seinen Jungen schon nach einem uralten Betriebssystem? Und dann richtete er seinem Sohn zur Geburt auch noch eine eigene Website ein. Eine Seite! Im Internet! Ja, wo lebten sie denn? Damit konnte sich Linux als Kind nirgends blicken lassen, ohne ausgelacht zu werden. Genauso wie mit seinem Smartphone, das schon veraltet war, als es auf den Markt kam: eine silbrig changierende Scheibe, die sich in Farbe und Form an den Untergrund anpasste. Wenn man mit diesem Telefon tatsächlich telefonierte, was im Grunde schon lange kein Mensch mehr machte, dann formte es die Ohrmuschel so nach, dass es vor dem Gehörgang hängen blieb. Biomorphing galt in der Kommunikationselektronik als wahnsinnig innovativ. Lange her. Immerhin hatte das Ding keine Tasten mehr, sowas wie Kabel konnte man auch nicht einstecken. Von einem Besuch im Museum für Kommunikationskultur wusste Linux, dass es das mal gegeben hatte. Dort lag ein iPhone 14 neben einer ausgestopften Brieftaube, Morsegeräten und Wählscheibentelefonen. Was für ein Schrott, sagte seine Kindergärtnerin damals, und alle lachten. Linux aber blieb still, denn er wollte sich keine Blöße geben. Keiner sollte von seinem iBaby 43 wissen. Es wuchs zwar mit seinem Nutzer, passte sich an die Größe von Handteller und Fingern an, lud sich mit Sonnenlicht auf, hatte aber nur G17-Standard. Nach diesem Modell war die Produktion eingestellt worden. Sowas brauchte die Welt nicht mehr. Und dennoch hing Linux an seinem Smartphone. Es hatte nicht nur als Babyphone fungiert, als er noch in der Wiege lag; es hatte ihm auch die Stimmen der Eltern und Großeltern vorgespielt, wenn er weinte; und es hatte ihn mit seinen 52000 Milliamperestunden ausdauernd gewärmt, wenn er im Bettchen auf ihm lag und die Decke obendrüber wieder verrutscht war. Im Unterricht hatte Linux später von Konrad Lorenz und dem Gänsemädchen Martina gehört. So wie das Küken den Zoologen als Erstes im Leben gesehen und als Mutter angenommen hatte, verhielt es sich wohl auch mit seinem Smartphone, hatte Linux sich überlegt. Irgendwie war es doch immer schon dagewesen. Vielleicht sogar gleich nach der Entbindung. Ob Vater das Gerät mitgenommen hatte zum Life-Launch seines Sohnes im Rollout-Center der Reproduktionsagentur? Gefragt hatte Linux nie, vorstellen aber konnte er sich das schon. Und es würde auch viel erklären. Es war jedenfalls vor allem diese frühe Prägung, die dazu führte, dass er so sehr an dem völlig veralteten Gerät hing. Dabei vergaß er es oft in der Hosentasche, zusammengeknüllt zwischen Rotzfahnen. Die Taschentücher lösten sich zu Mutters Missfallen im Unterleib des Reinigungsroboters flockig auf, das faltbare Phone aber ließ sich bis 60 Grad einschäumen, mit 1400 Umdrehungen schleudern. Und man musste es nicht mal bügeln. Das wäre dem iBaby 43 wahrscheinlich auch schlecht bekommen. Einfach glattstreichen genügte. Wenn Linux wütend war, konnte es sein, dass er sein Smartphone zerknüllte und an die Wand warf, aber dann zog es ihm meistens in der Magengrube. Er sammelte es ganz schnell wieder ein, streichelte es, bis es wieder flach neben ihm lag, Wärme verströmte und eine Melodie spielte, die seinen Blutdruck sin- ken ließ. Dabei konnte das iBaby ohne Berührung noch nicht mal seine Biodaten auslesen. Aber es reagierte auf die Frequenz seiner Stimme. Das reichte schon. Dann meldete sich die Sprachsteuerung Ultimus, die an den Tonfall seines Vaters angepasst war. Mit Ultimus richtete Linux seine ersten Social-Media-Accounts ein: bei Gossip und Chat-Tube, Mammuth und Muskerade, Brainbook, Tok-Tak, später auch bei tUktUk. Und nach den Trump-Trust-Gesetzen auch im Magaversum. Das war natürlich nur was für Nerds. Und das wusste er auch. Niemals konnte er davon in der Schule erzählen. Auch nicht, als er sein iBaby von einem Freund seines Vaters zum iBuddyXL hatte aufrüsten lassen. „Ein Kumpel von einem Computer“ hatte der Werbeslogan gelautet, was schon damals total retro geklungen hatte. Sowas besaß ja längst auch keiner mehr. Wer brauchte das auch, wenn er eine Schnittstelle im Nacken hatte? So ein Neuroport, den alle nur „Ännpi“ nannten, war so viel smarter. Angeschlossen ans Nervensystem konnte jeder Nutzer über Funkkontakt Audiofiles von der Suprabibliothek direkt an die Nervenleitungen des Gehörs senden. Filme ließen sich kabellos ans Auge übermitteln, die Iris wiederum fungierte als Kamera. Dass der Neuroport Gesundheitsdaten 24/7 auslas und an Health-Hub und Security-System meldete, dass er von Adrenalin bis Insulin den Status der wichtigsten Hormone über Depotausschüttungen regulierte – alles kein Hexenwerk. State of the art. Damals. Nicht nur der Vater aber hatte sich lange dagegen gewehrt. Auch die Mutter war in Sorge gewesen. Natürlich ließ sich ein Kind über den „Ännpi“ jederzeit orten. Doch auf der anderen Seite steckte im Nacken auch die Moneymaker-Technik für Kredittransaktionen. Und obwohl viele Eltern diese Funktion am Neuroport gar nicht freigeschaltet hatten, war es wiederholt auf Schulhöfen dazu gekommen, dass Kindern der Chip aus dem Nacken geschnitten wurde. Schlimm genug, dass die Kleinen stark bluteten und oft an der Wirbelsäule verletzt wurden, aber meist musste nach solch einer Attacke auch noch der Port ausgewechselt, das ganze Kind neu konfiguriert werden. Die Eltern von Linux wollten das nicht riskieren. So ging er lange nur mit seinem iBuddy durchs Leben. Bis zu dem Tag, als ihm sein Chef klarmachte, dass er seinen Job verlieren würde, wenn er sich weiterhin der modernen Technik verweigerte. Und das verstand er ja auch. Wie sollte er mit anderen Menschen in Kontakt treten, wenn sein Bewusstsein nicht im Magaversum hochgeladen war? Wie schnell konnten dort bei den einfachsten zwischenmenschlichen Transaktionen schon ein paar Petabyte an Daten ausgetauscht werden. Ohne einen NP, der mit KI seine PI, die Persönliche Intelligenz, potenzierte und optimierte, war er ja im Grunde sprach- und gefühllos. Also ließ sich auch Linux eines Tages den Neuroport implantieren. Der Onkel war da längst tot, aber wahrscheinlich hätte er spitz und zutreffend bemerkt, dass sein Neffe wohl auch der letzte Mensch war, der einen NP eingesetzt bekam. Linux trug seinen Namen wohl zurecht. Er war eben schon als Auslaufmodell zur Welt gekommen. Irgendwann hatten seine Kinder und Enkelkinder aufgehört, an ihm herumzumeckern, warum er sich der Zukunft verweigere. Seit er sein gesamtes Bewusstsein hochgeladen hatte ins Magaversum, war er glücklich mit seinem Port. Dass sich die Prionen in seinem Hirn verklumpten, musste ihn nicht mehr kümmern. Sein Geist war ja im Backup für immer aufgehoben. Nur sein Körper zerfiel zusehends. Gelbe faltige Haut, die Nase ädrig, die Augen tief in den Höhlen, der Rücken gekrümmt, alle Gelenke geschwollen. Linux war mit 107 Jahren zwar noch längst kein Greis, aber doch kein schöner Anblick mehr. Das wollte heute auch keiner mehr sehen. Aber genau dafür gab es ja Altkörperverwahranstalten, die Body-Storage-Lösungen mit individueller Vitalfunktionskontrolle kombinierten. Linux war damit zufrieden. Also, sein Bewusstsein oben im Magaversum war einverstanden, und sein Körper konnte damit existieren, bis der Mietvertrag im Storage-Zentrum der Firma Body Culture auslief. Er hatte sich für seine letzten Jahrzehnte einen komfortablen Container gegönnt. Ärmere Menschen lagen in einer Röhre. Linux aber hatte Platz für Besucher, die selten kamen. Das aber machte ihm gar nichts aus, denn in seiner linken Hand spürte er das warme weiche Material seines iBuddy. Es lag da, seit er eingezogen war. Und manchmal, wenn er eine menschliche Stimme hören wollte, unterhielt er sich mit der Sprachsteuerung Ultimus übers Wetter, die Dürre, die Tornados, Überflutungen. Was alte Leute halt so wissen wollen, wenn der Tag lang und leer ist. Heute aber brauchte er Ultimus nicht, heute hatte sich sein Urenkel angekündigt. Am Nachmittag kam er. Ein eiförmiger Serviceroboter, auf dem sich mit einem Leuchten ein Lächeln abzeichnete, schob den jungen Gast in seinen Container. Wie nett. Endlich wieder mal Besuch. Da lagen die beiden also: ein wächserner Greis auf einer weißen Bahre neben einem gläsernen Behälter mit einer milchigen Nährflüssigkeit, in der sich ein grauer Klumpen und ein Faserstrang – Gehirn und zentrales Nervensystem – abzeichneten. Zwei Stunden hatten Linux und sein Urenkel, in denen sie ganz nah beieinander lagen, während ihre Gedankendatenströme im Magaversum zusammenflossen. Viel verstand der alte Mann nicht von dem, was seinem jungen Gast so alles durch die Neuronen brauste. Aber es war auch egal. Irgendwann hörte Linux gar nicht mehr zu, was sein Urenkel dachte. Er hatte ja alles, was er brauchte in seiner rechten Hand. Er umschloss die warme Scheibe, die sich sofort um seine Finger schmiegte. Alle anderen Funktionen seines Smartphones waren längst erloschen, aber dieses Feature funktionierte noch. iBuddy drückte ihn zärtlich. Einen besseren Kumpel gab es nicht. Linux war glücklich.
Barbara Zeizinger
Worte hängen in Wolken Sieben Gedichte
Bitte wenden Sie
Im Halblicht der Dämmerung unterwegs auf der A7. Im Westen der Widerschein der Sonne, auf dem Grünstreifen Treibgut aus Müll. Mein Smartphone als Reiseführer verlangt ‒ Bitte wenden Sie ‒ Unmögliches. Während ich weiter die falsche Richtung nehme, überfällt mich eine ferne Erinnerung an einen See, an dem ich deinen Brief zerriss, weiterfuhr, dem Süden entgegen. Ich bin endlich angekommen, schrieb ich, obwohl es nicht stimmte. Nur zeitweise überwog das Gefühl, die richtige Ausfahrt genommen zu haben.
Ich wüsste gerne, was sie denkt
In der S-Bahn das Handy als Fluchtpunkt vor dem immer gleichen Blick auf dieselben Straßen, Häuser, Graffiti. Meine Nachbarin ist jung, die Ausschnitte der Stadt interessieren sie nicht. Für sich sein im überfüllten Waggon. Atempause.
Undenkbar Gespräche mit Fremden. Nicht hier, nicht jetzt. Der Kopfhörer als Zeichen. Musik die abgesteckte Grenze. Als sie aussteigt, lächelt sie mich an, wünscht einen guten Abend. Ich staune.
Die Zeiten ändern sich
Du Idiot, schreit die junge Frau im ICE 215 in ihr Handy. Du verdammter Idiot!
Drei Worte, bei denen meine Mutter ‒ weil viel zu privat ‒ alle Fenster verschlossen hätte.
Tempora mutantur fällt mir ein, als säße mein alter Lateinlehrer neben mir. Im Zug wird es still. Auch ich lege die Zeitschrift weg.
Vorwürfe in hoher Stimmlage, Fragewörter, Halbsätze, halbherzige Versuche der Zuhörer, den Streit zu begreifen.
Er ist fremdgegangen. Hat beim Einkauf die Kinder vergessen. Die Wäsche verfärbt.
Nein, ich werde nicht … Sehr laut. Dann ein Tunnel, Funkloch, Schweigen.
Tempora mutantur … Mir fällt nicht ein, wie der Satz weitergeht. Ich glaube es war ein Hexameter.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen.
Eigentlich habe ich es nicht eilig
Staugefahr sagt Googlemaps und gleich darauf, als wolle es mich trösten, du befindest dich immer noch auf der schnellsten Strecke.
In Wahrheit Stillstand. Auf der Gegenfahrbahn fließender Verkehr. Noch denke ich in Minuten, ahne, es wird nicht dabei bleiben.
Neben der Autobahn ein offener Landstrich, auf der Böschung vertrocknete Gräser. Eine Familie mit Bechern und Broten. Picknick gegen Langeweile.
Ein junger Mann steigt aus, sucht mit Blicken das Ende der Schlange. Eine Zigarette, ein Lächeln.
Mein Smartphone lügt, sage ich durch das geöffnete Fenster. Gemeinsames Warten auf stop and go.
Was er später wohl erzählen wird, von den Minuten, in denen sich unsere Geschichten kurz berührten?
Ferngespräche
Erinnerungen enden immer in Melancholie sagt Leonardo Padura, der kubanische Dichter, in dessen zweitem Havanna-Krimi die verdächtige Musikerin gerade den traurigen Kommissar verführt.
Sitze im Zug Richtung München, die Landschaft draußen taucht auf, verschwindet wieder wie so vieles. Das alles wollte ich dir erzählen, aber der Akku meines Handys ist leer und ich habe vergessen, wo das Kabel ist.
Ich muss mich gedulden wie früher, als ich jung war und wartete, bis der Zähler umsprang auf den Mondscheintarif.
Ich schicke ein Fragezeichen
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Paul Watzlawick
Es stimmt, ich habe gezögert, dir diesen Satz zu schreiben. Seitdem Funkstille. Ich warte, schicke Smileys, rote Ausrufezeichen, den hochgestreckten Daumen. Nichts. Melde dich! Großgeschrieben. Nichts. Ich stelle mir dein Zögern vor, dein Stirnrunzeln, das schwere Atmen wie neulich, als wir spazierengingen und der Himmel nahezu durchsichtig war. Ich hätte dich anrufen sollen, etwas hinzufügen, etwas Nettes. Den Satz abschwächen durch meine Stimme. Ich sende ein Fragezeichen. Digitales Schweigen. Im Café
1 In der Mitte öffnet sich der Raum. Dorthin schiebt er den Kinderwagen, kurvt um Tische und Stühle, setzt sich an einen Tisch, wählt einen anderen. Er bestellt Tee, ein Kännchen mit Kandis, beugt sich über den Kinderwagen, schlägt die Decke zurück, holt sein Handy aus dem Jackett, liest einen Krimi, legt das Handy weg, zieht dem Baby das Mützchen aus, holt das Baby aus dem Wagen, gibt ihm die Flasche, gibt ihm eine Rassel, wippt mit den Knien, nippt am Tee, legt das Baby in den Kinderwagen, sieht sich um, sieht eine Frau ihren Espresso umrühren, Zucker, denkt er und schreibt eine Einkaufsliste.
2 Ihre Blicke überfliegen den Raum, finden einen Tisch im hinteren Teil, sie eilt auf ihn zu, streift den Kellner, streift einen Kinderwagen, ein Stuhl für sie, einen für die Tasche. Sie bestellt einen Espresso, doppelt, stark, streicht eine Fluse von ihrem Jackett, schaut auf die Uhr, schreibt auf ihrem Handy, liest, schreibt, trinkt den Espresso in einem Zug, trinkt ein Mineralwasser, legt das Handy beiseite, lehnt sich zurück, schaut zu dem Mann mit dem Kinderwagen, lächelt ihn an.
3 Sie sitzt gern am Fenster, will gleichzeitig drinnen und draußen sein. Sie bestellt Cappuccino, koffeinfrei mit Sahne, leert die Tasse langsam, löffelweise, schlückchenweise, bittersüß, wie Hochzeitsflug und Abschiedsmusik. Ein Mädchen geht vorbei, langhaarig, Minirock. Sie schaut ihm hinterher. Sie hat vergessen, dass man so jung sein kann.
4 Mit der rechten Hand fährt sie sich durchs Haar, setzt einen Kopfhörer auf, setzt sich an die Theke. Sie bestellt Cola mit Zitrone und Eis, trinkt mit einem Strohhalm, sucht im Spiegel zwischen Flaschen eine freie Stelle. Zu dunkel, denkt sie, ich muss zum Friseur, vielleicht Strähnchen. Ihr Handy klingelt, sie nimmt den Kopfhörer ab, spricht, lacht, steckt das Handy weg, schiebt mit beiden Händen ihre Haare zusammen, lässt sie wieder fallen. Zwischen den Flaschen sieht sie Teile einer alten Frau.
5. Zwei Jungen betreten den Raum, blicken zu dem Mädchen an der Bar, suchen einen freien Tisch. Apfelschorle, Spezi. Zwei Handys liegen auf dem Tisch. Sie trinken, schieben die Gläser in die Mitte, laden ein Spiel herunter, spielen, schweigen, sagen Level 7, sagen krass, sagen cool, spielen, schweigen, spielen, schweigen. Bei Level 9 schaut einer auf die Uhr, trinkt seine Apfelschorle aus, sein Spezi der andere, sie packen ihre Handys ein, steuern auf den Ausgang zu, sehen das Mädchen telefonieren, sagen man sieht sich.
PH Gruner
Zoes Weg ins Büro
Zoe ist fröhlich und zielstrebig und kommunikativ. Sie geht morgens beschwingt und tatendurstig aus dem Haus und bewältigt zu Fuß ihren Weg zur Arbeit. Auch im Winter. Zurzeit ist Februar. Die Wetterapp verkündet gefrierende Nässe und leichte Glatteisbildung, aber bis 10.35 Uhr trocken, ab 10.36 und 45 Sekunden zögerlich einsetzender Nieselregen aus Südwest. Zoe ist gut zu Fuß. Sie ist 28 Jahre jung und mittelgroß und sagt von sich, sie habe die Figur Pandabär. Nicht das Wesen, nur die Figur, wie sie betont. Denn sie ist eine sehr schnelle und standfeste Pandabärin. Nicht leicht umzustoßen, nicht leicht aus der Fassung zu bringen. Auch heute nicht. Sie ist warm angezogen, trägt Schal und Mütze, feste Schuhe und hat in der Tasche die leichteren Schuhe fürs Amt dabei, fürs Bauaufsichts- amt. Dort arbeitet sie als städtische Angestellte. Zoe trägt ihre feinen schwarzen Fingerhandschuhe. Die schwarze Linke hält auf dem gesamten Arbeitsweg das Smartphone stets eng vor ihrem Pandabärenbauch, die schwarze Rechte kommt nur aus der Manteltasche hervor, wenn beide Daumen in Windeseile eine Message tippen. Zoes Ohren werden, unter der Mütze, gewärmt und akustisch versorgt von zwei kuscheligen Kopfhörerschalen. Zoe hört „Happy“, ihren jüngst wiederentdeckten, absoluten Lieblingssong von Pharrell Williams. „Because I’m happy, clap along if you feel like happiness is the truth“. Zoe ist gewappnet. Sie singt im Geiste mit, mit dem schlaksig-schlanken und wunderbar biegsamen Pharrell, ja, happiness is the truth, absolut, klar, nichts sonst, aber im Augenblick ist Zoe mit den Augen auf der WhatsApp von Freundin Nora, die fragt „Hey, gehn wir Freitagabend in Frau Luna in die Oper? Ich check mal nach Karten, okay?“ Gute Frage. Zoe checkt aber erst mal ihren Kalender. Und übersieht dabei Fatih. Fatih ist nicht allein, sondern wie stets am Morgen mit seiner dreieinhalb Tonnen schweren, ordentlich fauchenden Straßenkehrmaschine unterwegs, seinem City Ranger 3500. Fatih verfolgt, wie Zoe den Fußgängerüberweg mit lächelnd gebeugtem Kopf überquert, leider bei hellem Rot. Er hat es kommen sehen. Er weicht mit seinem City Ranger couragiert aus, rammt dabei jedoch einen Fahrradfahrer. Den hat er nicht kommen sehen. Der Radler wird vom Sattel geholt, gerät samt seinem gelben Helm unter den City Ranger 3500 und wird niedergekehrt. Es ist ein Verfahren ohne Gnade. Der City Ranger holpert und rattert über ihn hinweg. Er vermengt das plattgedrückte Rad mit dem flachgequetschten Radlerkörper zu einer feucht-frisch geputzten, breiartigen Masse, die sich weigert, vom Kehrbauch des City Rangers aufgenommen zu werden. Zu sperrig. Fatih stellt auf Notstopp, springt aus der Fahrerkabine, verliert beim wirren Blick auf das angerichtete Unheil jede Fassung, schreit lauter als der Verkehrslärm, reißt sich beide Ohren vom Kopf, will einfach nur rennen, losrennen, wegrennen, stolpert aber über den gebogenen Fahrradlenker, der, als einziges Detail wiedererkennbar, unter dem City Ranger herausragt und schlägt auf einem weißen Strich des Zebrastreifens mit dem Kopf auf. Auf dem Weiß zeichnen sich zwei dickflüssig-rote, von der angefrorenen Straßenoberfläche abdampfende Fleckspuren ab, die Fatihs Schädel aus dem Bereich der abgerissenen Ohren verlassen. Zoe durchquert derweil das Tor zum Englischen Garten. Clap along if you know what happiness is to you. „Frau Luna gebongt. Hab Zeit. Und Lust. Hol Kärtchen, egal welche. Kuss!“, tippt sie rasend schnell, und ab zischt die Message zu Nora. Auf dem breiten Hauptweg durch den Englischen Garten ist Zoe plötzlich in Südafrika. Das geht schnell. Über Instagram hat Amtskollege Luca, im Kurzurlaub, Bilderstrecken aus Johannesburg und Kapstadt geschickt. Sie scrollt und scrollt. Der Mann hat’s gut. Die Frau mit dem Lastenrad, die ansetzt, die in der Mitte des Weges gehende Zoe zu überholen, nicht. Denn sie erkennt zu spät, dass Barbara und Agnes mit ihrem vierjährigen Zwergspitz ihre Morgenrunde gehen. Der Zwergspitz steht rechts des großen Weges, Barbara und Agnes aber am linken Rand. Sie rufen mit spitzen Sopran-Stimmchen den Zwergspitz, er heißt Raphael, aber er hört nicht. Und so ist die Hundeleine stramm gespannt überm Weg. Das Lastenrad nähert sich kraftvoll. Zoe schaut sich grade an, was Luca auf seinem Teller hatte gestern beim Schnabulieren in seinem Lieblingsrestaurant in Kapstadt, als die Frau mit dem Lastenrad die Leine ins Vorderrad spinnt, Leine und Zwergspitz mit einem furios anzusehenden Schwung hochreißt und dabei mit einem hohen Eigendrehimpuls versieht, gerne auch als Spin bezeichnet. Raphael fliegt empor durch die Morgenluft, überquert die unteren Äste einer Platane am Wegesrand und hängt schließlich mit hängender Zunge und vollkommen verblüfftem Gesichtsausdruck am untersten Ast, pendelnd an der Leine in Höhe der Gesichter von Barbara und Agnes. Die Frau mit dem Lastenrad bremst ab und beginnt sofort mit dem Ausschimpfen der Beiden, die wiederum diesem Ausbruch von Wut und Empörung gar keine Beachtung schenken, weil sie mit vereinten Kräften Raphael von seinem pendelnden Schicksal am Baume befreien. Zoe singt mit bei Clap along if you know what happiness is to you und staunt über die Fotos vom Nachtisch, den Luca sich da gegönnt hat. Er ist über 9000 Kilometer Luftlinie von ihr entfernt! Nicht zu fassen! Dem Mann geht’s gut! Barbara und Agnes schließen ihren von der Leine befreiten, rotbraunen Raphael in die angstvoll zitternden Arme und lassen sich von seiner kleinen rauhen Zunge das Gesicht abschlecken. Das ist Dankbarkeit. Die Frau mit dem Lastenrad zeigt ihnen den kaminrot behandschuhten Stinkefinger und radelt zornesrot weiter, an Zoe vorüber. Die wird vom sonnig-süßen Kapstädter Nachtisch abgelenkt durch die akustisch und visuell aufploppende Erinnerung an ein Zoom-Meeting, das in fünfzehn Minuten beginnen soll. Zoe beißt sich kurz auf die Unterlippe. Stimmt. Das Zoom-Meeting. Es geht um die mögliche Installation brandneu entwickelter weiblicher Wandurinale im „WC-Center“ des Hauptbahnhofs. Ein Modellprojekt des Future-Miktions-Fonds des Innenministeriums. Wichtige Sache. Stellungnahme des Bauaufsichts- amtes erbeten. Zoe ruft die Datei auf, in der sie die Punkte ihres Pro-Plädoyers notiert hatte. Sie stellt die Endlosschleife von „Happy“ kurz ab und liest sich selbst laut vor: „Mehrere Studien ergaben, dass über die Hälfte der befragten Frauen in Europa ein Urinal benutzen würden, wenn es verfügbar wäre. Wir als Bauaufsichtsamt nehmen die Forderungen nach einer Urination equality, der dringlich zu verwirklichenden Gleichstellung beim Pinkeln, außerordentlich ernst. Urinale für Frauen oder Unisex-Urinale sind insgesamt weitaus weniger verbreitet als reine Männerurinale, was zu einer andauernden und schwerwiegenden Benachteiligung von Frauen im öffentlichen Toilettenraum führt.“ Zoe redet laut und engagiert in die kalte Morgenluft hinein, stößt Wortwölkchen aus, und registriert aus den Augenwinkeln, dass einige Passanten sich zuhörend umdrehen zu ihr. Es ist ihr egal. Sie redet weiter: „In der frühen Studie von Ute Alexandrowicz aus dem Jahr 1999 wurden Frauen befragt, in welcher Körperhaltung sie sich die Benutzung eines Frauenurinals vorstellen könnten. 81 Prozent gaben dabei stehend an oder in Halbhocke, bekannt auch als Skifahrhaltung, nur 19 Prozent bevorzugten eine sitzende oder tief hockende Körperhaltung. Auch aufgrund dieser breiten soziologischen Forschungsergebnisse kann unser Amt unter sanitärtechnischen wie emanzipationshygienischen Grundsätzen heraus das Projekt eines Frauen-Urinals in Wand- installation, selbstredend in Reihenanordnung mit Trenn- oder Schamwänden, nur befürworten. Für diesen wichtigen Schritt zur Gleichstellung der Frauen bei der Miktion würden wir allerdings die Bezeichnung Missoir bevorzugen.“ „Das klingt gut!“, klatscht Zoe freudig in die schwarzen Handschuh-Hände, wobei ihr um ein Haar das Smartphone wegrutscht. Der Schreck darüber fährt ihr so in die Glieder, dass sie kurz innehält, kurz stehen bleibt, kurz die Backen bläht und viel Luft ausbläst. Dann geht sie weiter. Beim Blick aufs gerettete Display sieht sie, dass Scarlett über Threema anfragt, wie es mit dem gemeinsamen Bildungsurlaub stehe ab April. Ja, da muss sie gleich antworten. Und Freundin Joy schickt über Signal reichlich verwackelte Fotos von ihrem Lover im Hotelbett auf Ibiza mit der Botschaft Was machst Du so? Diesen Knackarsch vernasch ich grade . . . Zoe zieht ein verrutschtes Lächeln und kreuzt resoluten Schrittes den großen Heinrich-Heine-Platz. Bald ist sie da. In acht Minuten startet das Zoom-Meeting. Sie geht quer über den Platz. Direktheit ist Effizienz, weiß sie. Und ruft noch kurz ihren Kollegen an, um ihm mitzuteilen, dass sie in einer Minute im gemeinsamen Büro sein wird. Ob die Kaffeemaschine vielleicht schon laufe? Zoe switcht wieder zu „Happy“, das stimuliert ihre Beine und Füße, die wie von alleine laufen und die letzten zweihundert Meter Arbeitsweg unter die Sohlen nehmen. Das Wesentliche spielt sich hinter Zoe ab. Da ihr entschlossener Schritt zwischen den wartenden Straßenbahnen durchsticht und sie dabei die Spur der Buslinien 41 und 46 kreuzt, versucht der vollbesetzte und mit rundum angelaufenen Scheiben heranschnaufende 41er-Gelenkbus dem überraschend huschenden Phänomen Zoe auszuweichen. Aus tiefem Schreck heraus führt Berufskraftfahrer Edwin die schnelle Lenkbewegung nach links zu abrupt und heftig aus, weshalb er gegen die dicht neben der Busspur wartende Straßenbahn kracht, wonach diese wiederum in von Geisterhand bewegter Zeitlupe aus den Schienen kippt. Sie fällt in der Folge wie tödlich getroffenes Großwild in Tansania langsam um, dabei die Oberleitung ein- und mitreißend. In der feuchtkalten und Elektrizität gut leitenden Luft spuckt es Sterne und Blitze aus der Leitung. In der Straßenbahn purzeln die Menschen. Edwin schaut zu und sitzt plötzlich quasi im Freien. Die Frontscheibe seines Gelenkbusses ist in einem Stück herausgeplatzt. Würde er sich jetzt vorbeugen, könnte er die auf der Seite liegende Straßenbahn berühren. Das von ihm erlegte Großwild. Stattdessen kann er beobachten, wie der 78 Jahre alte Winfried aus dem Weiler Bückelhausen-Oberloe, seit zwei Jahrzehnten stark sehbehindert und in der Stadt wie stets mit einem Blindenstock unterwegs, die tief herabhängenden Fahrdrähte, die ihm wie dünnes Geäst den schwierigen Weg um die gekippte Straßenbahn versperren, mit der Hand beiseite schieben möchte. Edwin verfolgt, wie Teile von Winfried beim Kontakt mit 750 Volt Gleichspannung zischend verdampfen, sein fortan verwaister Blindenstock umfällt und dieser mit seinem Knauf eine unerschrocken in den Pflasterfugen pickende Ringeltaube im Nacken schmerzhaft trifft. Berufskraftfahrer Edwin glaubt, er sitzt nicht weiter am Steuer, sondern im Kino. So oder so hilflos. Zoe tippt die Threema-Antwort auf Scarletts Frage mit dem Bildungsurlaub ab April, passiert mit dem Abschiedsgruß CU zwischen den tippenden Daumen die Drehtür ins Dienststellengebäude, winkt wie immer zwischen lässig und nachlässig der Frau Vögele-Breithähnel am Empfang hinter dem übergroßen Schild „Besucher-Anmeldung hier!“, nimmt jeweils zwei Stufen die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Oben zieht sie die schwarzen Handschuhe von den Fingern und hält kurz inne, bevor sie die Türklinke drückt zum Büro B1/201. I’ m happy. Clap along if you feel like a room without a roof.
Marillenmutter
Katharina hatte die Spaghetti con porro sehr genossen im vergangenen Oktober. Porro, also der Lauch, war ihr in dieser pikant komponierten Weise – in dünne, längliche Streifen geschnitten, zusammen mit Speckwürfeln, Rosmarin, Knoblauch und Olivenöl zu den Spaghetti gegeben, untergemischt eine Ei-Parmesan-Mischung – noch nie in die Mundhöhle gekommen. Es war formidabel. Zum Nachtisch noch ein Aprikosen-Kompott. Katharina war im siebten Himmel. Eventuell auch im achten, dem endgültig entrückten Himmel der Geschmäcker.
Im späten Dezember, kurz vor Silvester, bemerkte Katharina einen seltsamen und stetigen Juckreiz unterhalb des rechten Rippenbogens, dem mit einem einfachen Kratzen nicht beizukommen war. Bis ins neue Jahr hinein war sie mit dem Phänomen beschäftigt. Sie fotografierte ihren Bauch von vorn und von der Seite, also im Profil, stellte die Aufnahmen in ihren Instagram-Account und fragte ihre Gemeinde: Was ist da los? Wer hat eine Idee? Ein dermatologisches Phänomen ist es nicht. Keine Rötung. Kein Ausschlag. Keine allergische Reaktion. Was ist es dann? Über dem Lesen aller Antworten, aller Spekulationen und Interpretationen, verging viel Zeit. Viele im Microblog schickten ihrerseits Fotos von ihren leicht gewölbten Bäuchen von vorn und im Profil, also von der Seite, und Katharina sog begierig auf, was aus den Köpfen der anderen so austrat an Text. Bis sich dann Mitte Februar zum Juckreiz eine erst leichte, dann schnell zunehmende Wölbung der oberen rechten Bauchdecke gesellte, die Katharina mit vielen weiteren Fotos, stündlich aktualisiert, darstellte. Am 11. Februar brach ihre Bauchdecke schmerzlos auf und Katharina gebar ein Aprikosenbäumchen. Das winzig-zarte, jedoch bald erstaunlich kraftvoll austreibende Apriköschen, im bayrisch-österreichischen Raum als Marille bezeichnet, in Rheinhessen auch als Malete bekannt, versetzte Katharina in eine euphorische Stimmung. Katharina legte das Smartphone nicht mehr aus der Hand. Sie teilte ihre Euphorie mit der Welt. Und sie teilte so gerne. Sie schlief nurmehr auf dem Rücken, verlor über der Zuneigung zum Wunder ihrer Aprikose eines ihrer Hauptinteressen, den steten Appetit auf gutes Essen, und verspürte dafür viel mehr Durst. Sie trank immense Mengen. „Ich gieße das Bäumchen von innen“, schrieb sie verzückt und erntete ein Meer an hochgereckten Däumchen. „Katharina, Du bist die Zukunft!“, schrieb ein junger Verehrer aus Litauen und sorgte für internationale Verbreitung jener Fotos, die Katharina als „Marillenmutter“, so seine Formulierung, zeigten.
Nachdem über Wochen ein Juckreiz in Katharinas linkem Oberschenkel alle in Atem gehalten hatte, zeigte sich dort eine Schwellung, die Katharina mit genauen Zentimeter-Angaben in Bezug auf Fläche, Breite und Höhe beschrieb und mit täglichen Fotos aus betont flacher Betrachterperspektive herausragend dokumentierte. Die Instagram-Gemeinde stand umgehend Kopf und veranstaltete Wetten auf das, was sich zeigen würde, was möglich wäre, was zu erwarten sei. Ein erster Trieb durchstieß die Epidermis des Oberschenkels am 26. Februar. Es zeigten sich winzige linealische bis lanzettliche Laubblätter. Katharina war froh, dass sich die Aprikose aus dem rechten oberen Bauchrand heraus entwickelte, denn so hatte sie ungehinderten Blick auf den linken Oberschenkel. Was aus den Blättchen werden würde? Zweiglein für Zweiglein kräftigte sich derweil der Haupttrieb der Aprikose. Das sich schnell ausbreitende Gewächs verhinderte, dass Katharina ihren rechten Fuß noch betrachten konnte. So fotografierte sie über das Steinobstbäumchen hinweg ihr rechtes Bein samt Fuß, indem sie das Smartphone mit ausgestreckten Armen über ihre Hüfte hielt und nach rechts unten fotografierte. „Seht ihr da unten mein Bein und meinen Fuß noch?“, fragte sie in die inzwischen global gewordene Runde. „Alles in Ordnung!“, kam zurück. „Don’t worry, you’re lookin’ great!“ kam die Audiobotschaft aus Australien.
Katharina trank mehrere Liter am Tag, um sich ökologisch und sozial angemessen zu verhalten. Sie fühlte sich wie noch nie in ihrem Leben: Sie fühlte sich eins mit ihrer Außenwelt, sie fühlte nicht mehr diese Phalanx der Enge und der Eigeninteressen, sondern ausschließlich Liebe. „Geteilte Liebe ist doppelte Liebe“, betitelte sie von fortan jede ihrer Botschaften und Breaking News. Dann durchbrach die Fachstimme eines Botanikers aus Bochum via Android-App das Rätselraten über das florale Geschehen auf ihrem linken Oberschenkel. „Es ist ein kleiner Lauch!“, verkündete er, „ein Exemplar von Allium ampeloprasum oder auch Allium porrum. Zu deutsch Breitlauch, Winterlauch, Welschzwiebel, Ackerlauch, Gemeiner Lauch oder Spanischer Lauch“, präzisierte er mit einer eigenen Fotostrecke aus dem vergangenen Sommer mit Lauchkraut aus seinem Garten. „Erreicht Wuchshöhen bis zu 80 Zentimeter in Nordrhein-Westfalen. Weiß allerdings nicht, welche Wuchshöhe sich aus dem menschlichen, mitteleuropäisch-weiblichen Oberschenkel heraus ergibt. Ich recherchiere weiter. Glückauf!“ „Katharina, die Marillenmutter, wird auch Lauch-Mama“, verbreitete sich über Instagram. Katharina war erheblich mehr stolz und dankbar darüber als irritiert. Sie lag auf dem Rücken und stellte sich in bunten Tagträumen die Marillenfrüchtchen vor. Sie würden kommen, und sie würden zu ihr kommen. Ihr Bauchraum fühlte sich durchwachsen an.
Juckreiz, Aufwölbung, tiefdunkle Rötung an der Spitze der Schwellung: Katharina war im Mai gut vorbereitet und neugierig auf das, was sich ereignen würde. Als nachhaltig integrierter und nährender Bestandteil alles Natürlichen zelebrierte ihr Seelenleben ein Plateau monumentaler Zufriedenheit. Und Zufriedenheit, ja, das war für Katharina mehr als Glück. Glück war etwas für kurze Distanzen auf dem Zeitstrahl, schnell verbrannt und erschütterbar, Zufriedenheit dagegen war etwas für die Langstrecke, für das Aufgehen in etwas Größerem, für das Übergehen ins Weitere, Erhabenere. Zufriedenheit spiegelte nicht kurzatmig eine Bedeutung, es war die Bedeutung. Als am 17. Mai nachmittags knapp oberhalb ihres freudig erregt schlagenden Herzens und knapp unterhalb ihres linken Schlüsselbeins die Haut aufbrach wie eine spärliche Krume auf karstigem, trockenem griechischen Boden am Ionischen Meer, da hatte sie alles vorbereitet. Seit Stunden war sie in Wartestellung, um den Moment des endlich Offenbarten fotografisch festzuhalten. Ihr linker Arm lag matt und in der Beweglichkeit stark eingeschränkt neben dem Kissen, abgelegt und dahingestreckt wie ein Beet für die Zukunft. „Du bist die Zukunft!“ hatte schließlich schon im Februar beim Erscheinen des Aprikosenbäumchens jemand geschrieben. So hielt sie nun mit der rechten Hand halbhoch die Smartphone-Kamera auf das Erscheinen der kleinen, sofort aromatisch wirkenden Spitze des Rosmarins. Endlich mal ein Immergrüner, sprach Katharina zärtlich-leise ins Mikro, endlich mal was Mediterranes, endlich etwas Duftiges, und dies auch noch so nah an der Nase. „Ist er nicht süß?“ Katharina strahlte. „Salvia rosmarinus“, kommentierte der Botaniker aus Bochum, „aus der Familie der Lippenblütler alias Lamiaceae. Katharina wächst sich aus zur Schönsten überhaupt!“ Die hymnisch Verehrte selbst fand, allen Glückwünschen zum Trotz, ein Haar in der Suppe, wiewohl sie doch von der langen und unirritierbaren Strecke der Zufriedenheit ausgegangen und überzeugt war. „Aber bei der ersten guten Rosmarin-Ernte, idealerweise Zweiglein und nicht einzelne Blätter, werde ich mich kaum mehr bewegen können. Schade!“ Jedoch tröstete Katharina sich umgehend selbst: „Aber da ich ja keinen Appetit mehr verspüre, muss ich auch nicht kochen!“ Im frühen Juli war es soweit. Angefeuert durch die beispiellos gute Nahrungsgrundlage, wurden bei dem jungen Bäumchen drei Früchte reif. Sie verdonnerten Katharina endgültig dazu, alle schnellen oder schreckhaften Bewegungen zu unterlassen. Eine Woche später stand sie nach sorgfältiger Vorankündigung noch einmal auf, um sich in Gänze den Netzwerken zu zeigen. Ein Nachbar filmte Katharina in zerschlissenen und aufgerissenen Kleidern, im Grunde fast vollkommen nackt, bedeckt mehr von Ast- und Blattwerk als von Textilien. Der Rosmarin über dem Herzen war erst runde zwölf Zentimeter lang, aber der Lauch hatte sich prächtig entwickelt und trieb erste Kapselfrüchte aus. Katharina lachte schrill auf, weil sie ins Schwanken geriet. Sie hatte große Mühe, nicht – dem prachtvoll gedeihenden Aprikosenbäumchen folgend – nach vorne zu fallen. Die Netzgemeinde hielt den Atem an in Echtzeit. Aber Katharina fiel nicht, nur eins der fast reifen Früchtchen fiel hinab. Der Ausruf von Überraschung und Entsetzen ging um die Welt. Das unreife Früchtchen traf auf den Spann von Katharinas rechtem nackten Fuß. Die Kamera war dem fallenden Obst gefolgt. Die noch reichlich harte kleine Aprikose teilte beim Aufprall den Fuß in Längsrichtung in zwei Teile. Der Fuß öffnete sich und gab den Blick frei auf eine erdähnliche Masse. „Das ist Humus“, gab der Botaniker aus Bochum aus. Silvia aus Bern schritt dagegen sofort ein: „Das ist Kompost, mein Lieber. Katharina kann keinen Humus herstellen.“ Der Botaniker ließ den Einspruch nicht wirklich gelten. „Wenn ich ein Pröbchen nehmen könnte, würde ich Dir – und uns allen – wahrscheinlich beweisen können, dass es sich bereits um Humus handelt. Mit einem ausgewogenen Verhältnis von Calcium, Eisen, Kalium und Aluminium, Magnesium und Mangan, Phosphor, Schwefel und dem Wichtigsten überhaupt: Stickstoff und Kohlenstoff. Schaut Euch das an: das ist Humus, ganz und gar natürlich hergestellter Humus aus zersetzbaren organischen Ausgangsstoffen. Hallo, kannst Du mal heranzoomen, du Mensch an der Kamera, geht das? Oder einfach näher rangehen? Ich will das besser sehen können. Ja, so, danke, wunderbar, da sieht man es perfekt: Das ist Humus, meine Lieben, nährstoffreicher Humus wie er im Buche steht! Ausgezeichnete Arbeit. Perfekt. Katharina?“ „Ja?“, gab sie zurück. „Du bist nicht Katharina die Große. Du bist die Größte!“
Marina D’Oro
Der Hörer
Mein Telefon klingelt. Aber ich hab keins, keins für unterwegs. Es klingelt noch mal. Laut. Gellend. So, wie ich es klingeln lassen würde. Ich schau um mich. Kein Mensch ist da. Ich bin allein im Abteil, steh auf und guck, auf die Ablagen, unter die Sitze, leg mich sogar auf den Boden, damit ich besser seh. Nichts. Noch einmal die gellende Tonfolge. Drei Töne in irgendeinem harmonischen Abstand. Wär ich Musikerin, wüsst ich in welchem. Aber so weiß ich auch das nicht. Dumm steh ich rum und weiß nicht, wie gucken, was tun. Ich kann richtig fühlen, wie dumm ich guck. Wieder klingelt es. Wie nimmt man ein Telefon ab, das man nicht hat? Vielleicht seh ich’s ja nur nicht. Trotzdem: Wie nimmt man ein unsichtbares Telefon ab? Dabei kann man diese Telefone für unterwegs gar nicht abnehmen. Die haben keinen Hörer. Da muss man, glaub ich, stattdessen auf einen Knopf drücken. Nicht mal das weiß ich. Und wie ich mich kenn, würd ich den falschen Knopf drücken. Ich drück immer die falschen Knöpfe. Und dann geht mein Mantel nicht zu, dann hängt sich der Computer auf, und mein Mann schreit mich an. Würd ich das Telefon sehen, könnt ich alle Knöpfe durchprobieren. Beim richtigen wär der Anruf weg. Ich kenn mich. So ein bisschen jedenfalls. Das hilft mir jetzt auch nicht. Ich steh immer noch dumm rum, und das Telefon klingelt schon wieder. Ich möcht mich jetzt nicht sehen. Ich seh bestimmt dümmer aus als der dümmste Mensch der ganzen Welt. Das können Sie mir ruhig glauben. Sie sollten mal sehen, wie doof ich aussehen kann. Das glaubt Ihnen kein Mensch. So wie das Klingeln, das jetzt schon wieder gellt. Meine armen Ohren, die sind doch so empfindlich. Darauf könnt das Telefon wirklich Rücksicht nehmen. Ich zerschrei ihm ja auch nicht das Hörfell oder die Hörmembran oder wie das heißt, obwohl es mich langsam nervt. Meine Ohren sind fürs Gellen nicht gemacht. Die sind so sanft und soft wie ich. Und irgendwie hab ich den Eindruck, dass dieses Gellen immer lauter wird. Fast so, als würd es in meinen Kopf hineinwandern. Jetzt klingt es, als gellte es mittendrin. Aber das kann ja nicht sein. Seit wann klingeln Telefone im Kopf. Ich jedenfalls hab das noch nie erlebt. Sie etwa? Erzählen Sie mir nichts. Ich glaub es Ihnen sowieso nicht. Mein Mann sagt immer, ich sei die Wiedergeburt des ungläubigen Thomas. Ich würd nie was glauben. Warum auch? Ich hab doch Augen und Ohren im Kopf und kein Telefon. Dann würd ich nur piepen oder gellen und Zahlen kennen und ganze Adressbücher und Kalender und. Aber nichts von mir. Denn im Unterschied zu solchen Telefonen hab ich einen eigenen Kopf. Und mit dem kann ich denken und lesen. Und zergliedern natürlich und auseinandernehmen. Das ist ganz wichtig. Wie sollt ich sonst was Eigenes aus all den vorgefertigten Teilchen bauen. Dieses Telefon ist wirklich merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In meinem Kopf gibt es doch kein unsichtbares Telefon. Ich wüsst nicht wo. So was hab ich noch nie gehört, geschweige denn gesehen. Ich würd’s auch nicht glauben, wenn es nicht weiterklingelte. Aber es klingelt so, als wär’s in meinem Kopf. Ich steh immer noch dumm da und weiß nicht, wie rangehen. So langsam beunruhigt mich dieses Klingeln, und ich fang an, an mir zu zweifeln. Dabei hab ich immer was auf meine Wahrhaftigkeit und meine Beobachtungsgabe gegeben. Vielleicht bin ja gar nicht ich gemeint. Mit einem Mal hört’s auf. Als hätte es auf diesen Gedanken gewartet. Ich hätt nie im Leben gedacht, dass Telefone Gedanken lesen können. Das sind doch nur Plastikknochen mit ein paar Drähtchen drin statt Adern, und ihr Speicher reicht nur für Zahlen und Miniwörterbücher. So einen echten Wortschatz, wie mein Mann ist, kennen die sowieso nicht. Abends klingelt mein Telefon wieder. Ein Zauberer hat es wieder klingeln lassen. So ein richtiger Zauberer mit Zitronen mit Geld drin, mit ungleich langen Schnüren, die er gleich lang zieht und so. Dieser Zauberer hat mein Telefon klingeln gemacht. Darüber bin ich fast verrückt geworden. Jedenfalls so verrückt, dass ich nicht mehr wusste, ob mir der Kopf noch stand und wenn ja, wo. Und diese Frage hat mich dann rammdösig gemacht. So rammdösig, dass ich eingenickt bin. Plötzlich roch ich Kaffee. Der hat mich glockenwach gemacht. Die Leute haben mir hinterher erzählt, dass der Zauberer mit einem Mal seine Adern aufgeschnitten hat. Einige behaupteten, er hätte es meinetwegen getan. Er hätte nicht haben wollen, dass jemand bei seiner Zauberkunst einschläft. Und deshalb hätte er seine Adern aufgeschnitten. Unmengen von Kaffee seien herausgeflossen. Der ganze Saal sei unter Kaffee gestanden. Bis zu den Knöcheln, zu den Waden sei er gestiegen, bis zu den Hüften; alle Leute hätte er nass gemacht. Dann hätt der Kaffee mich wach gemacht, und plötzlich sei alles verschwunden, völlig verdampft. Als ich die Augen aufmachte, war kein Kaffee mehr da. Ich hatte nur noch den Geruch von Kaffee in der Nase. Das war alles. Aber es erinnerte mich an die Geschichte mit dem Telefon. Und danach fiel mir die mit den Kartons ein. So eine Geschichte, in der ich seitenlang Kartons durch die Zeilen trag und im Durchschuss auch nichts sag. Immer geht es um etwas, das vielleicht doch sein könnt. Aber so wahrscheinlich nicht. So sicher wie wahr. Oder vielleicht doch? Weiß das wer? Wer? Ich nicht. Ich weiß nur, dass das Telefon geklingelt hat. Im Zug hat es geklingelt und bei dem Auftritt des Zauberers. Es hat geklingelt! Ich hab es gehört, ganz genau und gellend, überdeutlich. So penetrant wie diese drei Drangeworfenen. Es war das Klingeln meines Telefons, das ich eigentlich nicht hab.
Andreas Roß
Homo Smartphonicus
Gelangweilt lächelt mich mein 21-jähriger Sohn an, wenn ich mit meinem Samsung Klapphandy, produziert in dem Jahr seiner Geburt, kokettiere und schwärme, dass ich damit immer erreichbar bin und gerne telefoniere. Ich prahle mit der – jetzt immer noch – zehntägigen Akkuleistung und mein Sohn hört nicht zu. Ich versuche ihm zu erzählen, wie wir früher, also im alten Jahrtausend, telefoniert und auch anderweitig kommuniziert haben, versuche ihm sogar Wählscheiben und Telefonzellen schmackhaft zu machen, er allerdings winkt ab und macht mir körpersprachlich eindeutig klar, dass er gehen müsse, er habe Wichtigeres zu tun.
Wussten Sie es? Die meisten Mitglieder der Generation Z, also die zwischen 1997 und 2012 geborenen und nun jungen Erwachsenen, nutzen, wenn man sie bittet, auf eine Klingel zu drücken (was sie selbständig fast nie tun würden, weil sie ständig whats- appen) anstatt den Zeigefinger, wie alle Generationen zuvor, den – Daumen! Der Daumen ist ein Greifwerkzeug, was uns einst einen Vorteil in unserer Entwicklung brachte, und nun gebrauchen wir ihn ganz und gar artfremd. Und das ist fatal. Die Nutzung von Touchscreen-Smartphones mit dem Daumen hat überraschend deutliche Folgen. Schon nach wenigen Wochen verändert das ständige Umherwischen unser Gehirn, wie eine Studie zeigt. Die Region im Frontallappen, die für den Daumen zuständig ist, wird gestärkt und ausgebildet. Erstmal gar nicht so problematisch, denkt man. Es scheint immer gut, das Hirn zu trainieren. Dumm nur, dass in diesem Teil des Frontallappens ebenfalls jene Region liegt, die für unsere Kreativität zuständig ist. Somit wird diese nach und nach überlagert. Tja, interessante Zeiten kommen auf uns zu.
Wussten Sie es? Die Muskulatur der Augen entwickelt sich mit dem Sehen im Kindesalter. Je häufiger ein Kind sich bewegt, in die Ferne schaut und den Reizen der Nah-Fern-Umstellung ausgesetzt ist, desto eher und besser bildet sich die Fernsicht aus. Das Auge ist halt auch nur ein Muskel, der trainiert werden will, um gut funktionieren zu können. Da unsere Kinder schon im frühen Alter ständig auf das immer gleich weit entfernte Display eines Smartphones glotzen, bleibt die Übung aus. Heute schon sind viele Heranwachsende massiv kurzsichtig, was sich bestimmt auch in ihren Entscheidungen bezüglich der Zukunft auswirken wird.
Wussten Sie es? Seit 2009 ist die Zahl der Unfälle, verursacht durch Smartphones und Handys, kontinuierlich angestiegen, besonders im Straßenverkehr. 100 000 Zusammenstöße im Jahr 2021, 500 Tote und 25 000 verletzte Verkehrsteilnehmer, das ist Deutschlands traurige Bilanz. Es gibt Kurioses zu berichten: Ein 18-Jähriger marschiert versehentlich in eine frisch betonierte Fläche, während er eine Textnachricht schreibt. Danach will er den Anweisungen der Arbeiter nicht Folge leisten und muss von Sanitätern entfernt werden. Eine 57-jährige Frau wird von einem durch die Luft fliegenden Smartphone am Kopf getroffen. Dieses hatte ihr zweijähriger Enkel (vermutlich) versehentlich nach ihr geworfen. Das Lippenpiercing einer 18-jährigen verfängt sich in der Schutzhülle ihres Smartphones und wird in der Folge unsanft und unfreiwillig entfernt. Das sogenannte Teenager-Rheuma verbreitet sich neuerdings, ein 14-jähriges Mädchen klagt über starke Schmerzen im Handgelenk. Sie hatte einen ganzen Tag mit dem Verfassen von Textnachrichten verbracht. Eine 15-jährige wird von einem Basketball im Gesicht getroffen, während sie ein Smartphone bedient. Die junge Frau verliert dabei einen Zahn. Eine 29-Jährige verletzt sich am Kopf, als sie – abgelenkt durch das Posten – in einem Klamotten-Laden gegen einen Kleiderständer läuft. Die Aufzählung könnte endlos weitergehen. Nahezu alle Smartphone-Hersteller weisen in ihren Produktbeschreibungen auf viele – auch ziemlich abwegige – Gefahren hin, die mit einem solchen Taschencomputer einhergehen. Zwar muss man dafür in der Regel zwischen 100 und 200 Seiten Kleingedrucktes durchackern, aber andererseits: Es liegt auf der Hand, dass Elektrizität und Wasser, Ablenkung und Treppenstufen oder Kinder und Strom Kombinationen darstellen, von denen im Allgemeinen eher abzuraten ist. Man kann also zusammenfassen: Die Generation Z wird nach aller Vorausschau größtenteils zu einer in der Kreativität gehemmten, kurzsichtigen Gruppe von Menschen, die entweder andauernd gegen Ampelmasten knallen oder in Vertiefungen fallen, weil sie ständig von ihren Smartphones abgelenkt sind. Sie werden zu Zombies ihrer selbst, indem sie gefangen in algorithmisch generierten Bubble-Blasen glauben, die ihnen vorgegaukelte Welt sei real. Und das alles ergibt einen Sinn, denn so können zielgenau wichtige Werbebotschaften übermittelt werden. Solange der Konsum stimmt, ist alles andere egal. Aber Schluss mit dem Jugendbashing. Alle anderen Generationen, so auch die meine, sind nicht besser dran.
Mein Sohn ist da anderer Meinung. Es gibt doch auch eine Menge Vorteile der Digitalisierung, teilt er mir gelangweilt mit, als er seine Jacke nimmt und die Wohnung verlassen will. Er erklärt, die Digitalisierung trägt zur besseren Kommunikation, einem besseren Wissenstransfer bei, Prozesse können effizienter gestaltet werden, es kommt zu einer größeren Kundenzufriedenheit, mehr Self-Service ist möglich und die Wirtschaft kann schneller wachsen. Als er die Türklinke in der Hand hält, versuche ich ihm das Bild eines gut geölten Hamsterrades näher zu bringen, in dem der arme alternde Hamster immer schneller und schneller spurten muss und in gar nicht ferner Zukunft herausgeschleudert wird und sich nicht nur eine blutige Nase holt. Da lächelt mein Sohn und sagt: „Ach Papa, du verstehst das nicht.“
Die Unschuldsengel
„Die Welt ist verrückt und ich bin ihr Erschaffer.“ Der Mann, der diese Worte ausspricht, seufzt tief, schlägt sich die flache Hand patschend vor die Stirn und stöhnt: „Ich hab’s total verbockt!“ „Ich weiß, denn ich bin mit allem Wissen verbunden“, haucht Siris lieblich nachgeahmte Computerstimme. Einstein sagt nichts und nickt. „Wie konnte das passieren?“, fragt der Mann, der sich Gott nennen lässt, „ich war doch nur ein paar Wochen fort.“ „Was ist schon Zeit?“, grummelt Albert vor sich hin. „Eine Illusion“, antwortet Siri ungefragt. „Ja, die Zeit wird maßlos überbewertet“, erwidert Albert. „Ach Einstein, wie wahr deine Worte sind. Sie bringen uns aber nicht weiter. Ich muss handeln“, sagt Gott und tätschelt nervös der Braunhaarigen, die ihm zu Füßen liegt, den Kopf. Ein Sonnenstrahl durchdringt das quadratische, weit oben angebrachte Fenster und wirft ein Schattenkreuz auf den eintönig grauen Betonboden. Der Raum ist klein, die Wände weiß getüncht, keine Bilder. Ein altes Holzkruzifix liegt blutverschmiert auf dem kleinen Tisch, an dem die drei Gestalten sitzen. Wasser tropft in das ovale Waschbecken. Die Tür gegenüber dem eisernen Stockbett steht offen. Gott tätschelt und denkt laut: „Momentan verfolgt die Menschheit einen Plan, der ist aber keineswegs göttlich. Wenn ich nur wüsste, welchen?“ Er erhebt sich und breitet seine Arme aus. Der weite weiße Umhang umweht seinen schlaksigen Körper. Siri erwidert: „Deine Frage war, welchen Plan verfolgt die Menschheit? Überall und immer wieder erscheint Zahl 23 und mit ihr die Quersumme 5. Die 23 ist die Zahl der mystischen Illuminaten. Diese Gruppierung sucht die Kontrolle über Alles und Jeden und strebt allumfassende Macht an.“ „Bist du dir da sicher?“, fragt Einstein. „Ja, die deutsche Verfassung wurde am 23.05.1949 unterzeichnet. Siehst du die 23 und die fünf, als Quersumme? Und dann beträgt die Quersumme von 1949 ebenfalls 23. Der Anschlag auf das World Trade Center geschah am 11.9.2001, 11+9+2+1 ergibt 23. Und dann noch das amerikanische Verteidigungsministerium. Es ist in Form eines Pentagons, also mit fünf Ecken gebaut. Außerdem ist 2 geteilt durch 3 gleich 0,666 und die 666 ist die Zahl des Satans.“ „In der Tat“, stimmt Albert Siri zu, „wusstet ihr, dass die 23 die erste Primzahl ist, die aus zwei Primzahlen, nämlich der 2 und der 3 zusammengesetzt ist und diese beiden addiert die 5 ergeben, also die nächste Primzahl?“ Gott lässt die Arme sinken, so als wäre alle Kraft aus ihnen herausgeflossen. „Tja, die Menschheit hat nicht erfüllt, was wir von ihr erwartet haben. Vielleicht haben wir ihr zu viel freien Willen zugemutet.“ „In dieser Beziehung hast Du tatsächlich versagt“, stänkert Einstein und hebt den Zeigefinger: „Die Menschheit sollte doch die Krone der Schöpfung sein.“ „Moment“, ereifert sich Gott, „ich habe niemals von der Krone der Schöpfung gesprochen! Das haben Menschen erfunden und als Wahrheit verbreitet. Es gibt so viele vermeintliche Wahrheiten, die nur dazu dienen, dass ein paar Auserwählte Macht haben. Das war niemals mein Plan. Damit habe ich nichts zu tun. Diese verdammte 23, diese verdammten Illuminaten, Freimaurer und Bilderberger oder wie sie sich auch immer nennen mögen. Sie haben die Welt mit ihrem Plan belegt, einem Plan, der die Menschheit versklavt.“ „Okay, okay“, rudert Einstein zurück. „Du hast Recht, lass uns lieber in die Zukunft schauen, als immer wieder im Sumpf der Vergangenheit festzukleben.“ Gott nickt heftig und erhebt erneut beide Arme, als wolle er segnen. Er bildet mit seiner Rechten eine Faust. Er bemerkt, dass etwas an seiner Haut haftet. „Blut klebt an deiner Hand“, schreit Siri und schreckt zurück. „Wie es auf vielen Seiten des Netzes geschrieben steht, ist das fünfte dein wichtigstes Gebot!“ „Warum sollte eines meiner Gebote hervorgehoben werden?“, fragt Gott. „So beschreiben es Theologen im Netz“, antwortet Siri. „Ja, so ist das. Jeder will mitreden“, grunzt Gott genervt. „Sag mal?“ Albert grinst verschmitzt. „Hat eure Dreieinigkeit denn Moses wirklich nur zehn Gebote mitgegeben oder sind ihm Teile der Steintafeln bei dem schwierigen Abstieg vom Berg Sinai zu Bruch gegangen?“ Gott steht stramm, hebt sein Kinn und verfällt in den Tonfall eines Predigers: „Tja, eigentlich waren es tatsächlich zwölf. Die Zwölf bevorzuge ich noch immer, nicht nur wegen meiner zwölf Jünger. Das Kreuz, das Symbol des Christentums, hat vier Enden. Die drei oberen stehen für die Gottheit und das untere, auf dem Boden stehende, symbolisiert den Menschen, also drei mal vier ergibt zwölf.“ „Jetzt nerve mich nicht mit der Numerologie. Ich bin neugierig. Wie heißen die letzten beide Gebote?“ „Du sollst Reichtum gerecht verteilen“ und „Du sollst andere Kulturen und Lebenskonzepte achten und ehren.“ „Jetzt verstehe ich so einiges“, seufzt Albert und schaut nachdenklich zu Boden. „Aber, dennoch das wichtigste Gebot scheint mir doch das fünfte, obwohl es das meist gebrochene ist.“ „Wenn man gottgläubig konsequent sein würde, dürfte man nicht töten, also auch keine Tiere, und müsste auf das Fleisch- essen verzichten“, bemerkt Siri. „Na ja, Vegetarismus schützt vor Gräueltaten nicht“, antwortet Albert. „Wie meinst du das denn?“ fragt Siri schnippisch. „Hitler war Vegetarier ...“ „... und liebte die Bombe, deren Grundlagen du erforscht hast!“ „Er hat sie aber nicht von mir bekommen.“ „Dennoch bist du der Vater der Bombe, die später dann unzählige Japaner tötete. „Bin ich nicht!“ „Bist du wohl!“ „Ach Kinder, hört endlich auf mit diesem nutzlosen Streit. Wir müssen Prioritäten setzen. Die Welt muss gerettet werden.“ Einstein kratzt sich am Kinn: „Will die Welt überhaupt gerettet werden? Du hast doch der Menschheit den freien Willen gegeben und eine gehörige Portion Intelligenz obendrein. Siri, wann wird die Welt untergehen?“ „Nachdem du gehört hast: Feuere sie ab!“ „Na prima, Siri, ich glaube, du hast Angst vor einem Atomkrieg“, bemerkt Gott. „Mann, das nervt“, echauffiert sich Einstein. „Immer wieder kommt ihr auf diese verdammte Bombe zu sprechen. Ich bin nicht der Vater dieser Bombe. Ich habe sie nicht entwickelt.“ „Das ist falsch“, antwortet Siri. „Ich kann für Dich im Netz nachschauen.“ Einstein wird laut: „Dieses gottverdammte Internet. Das ist der Kern des Bösen. Es steht für die Weltverschwörung. Wir sind heute schon Abhängige davon und hängen am Netz wie an einem Tropf. Durch das Internet werden wir gelenkt und geleitet, Wahrheiten werden manipuliert und wir bekommen das als wahr vorgegaukelt, was einigen wenigen Mächtigen in den Plan spielt.“ „Ach hör doch auf“, schreit Siri schrill, „das Internet ist die Quelle aller Weisheit! Dort findet jeder alles. Somit gilt nicht mehr: Wissen ist Macht, sondern jeder kann das Wissen der Menschheit abrufen. Das Netz unterstützt die Macht des Volkes. Es ist eine Grundlage der Demokratie und lockt den Freiheitsdrang aller. Es ist das Gegenteil von dem, was du erzählst.“ Einstein schüttelt den Kopf so heftig, dass seine grauen langen Haare nur so hin- und herfliegen. Kaum später sitzt er plötzlich still und zählt etwas an seinen Fingern ab. Ein Lächeln schleicht sich auf sein Gesicht. Er schaut Siri direkt in die Augen. „Jetzt habe ich endlich den Beweis, dass das World Wide Web der Grund allen Übels ist. Alle Webseiten werden mit dem dreifachen W eingeleitet: Das W ist der dreiundzwanzigste Buchstabe des Alphabetes, also wieder die Zahl der Illuminaten. Deutlicher kann ein Hinweis doch nicht sein. Das Internet ist das Werkzeug derjenigen, die die Welt nach ihrem teuflischen Plan gestalten und versklaven wollen. Ja, so ist es: Zerstört das Netz und ihr zerstört das Böse.“ Albert springt auf und gestikuliert wild mit beiden Armen. Siri springt ebenfalls auf und schreit: „Hör auf damit! Das Netz ist ein Segen. Früher verfügte nur ein kleiner Teil der Menschheit über Wissen. Heute kann jeder Mensch das gesamte Wissen nutzen.“ „Der Mensch, der Mensch“, krakeelt Einstein, „was nutzt der Mensch? Nicht einmal fünf Prozent seiner geistigen Fähigkeiten und das Netz bloß für nutzlose Spiele oder dazu, sich mit virtuellen Mitteln in der realen Welt zurecht zu finden. Vor ein paar Jahren noch hat man nach dem Weg gefragt, wenn man sich nicht auskannte, man kam mit Menschen in Kontakt und hat sich ausgetauscht. Heute laufen die Menschen mit gesenktem Kopf durch die Gegend und starren auf ihre Handys. Dabei achten sie nicht auf ihre Umgebung. Sie stoßen mit dem Kopf gegen Laternenmasten oder taumeln auf stark befahrene Straßen und werden überfahren. Das ist doch pervers.“ „Verdammt großer Quatsch“, schreit Siri, „pervers ist es, das Neue und den Fortschritt zu verteufeln. Immerhin kommen immer mehr Menschen auf die Idee, nach draußen zu gehen und sich zu bewegen, Pokemon go sei Dank.“ „Genau das meine ich“, quäkt Einstein, „das Internet führt mit unendlichem Aufwand Menschen wieder dorthin, wo sie schon waren.“ „Jetzt hört endlich auf!“ Gott erhebt seine Stimme. „Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und dafür brauche ich Euch nicht als Streithähne, sondern als Team. Siri, dich als Quelle des Wissens und Einstein, dich als jemanden, der das Wissen versteht und in Zusammenhänge einordnen kann. Wir, die drei Wissenden, müssen aktiv werden, das Ruder herumreißen und die Welt in humanistische Bahnen lenken.“ „Und was machen wir mit der erschlagenen Ärztin?“ „Geschehenes muss zurückgelassen werden. Wir können endlich unser Gefängnis verlassen, in dem uns die Unwissenden eingeschlossen haben. Also, lasst uns gehen“, bestimmt Gott. „Lasst uns gehen“, wiederholt Siri. „Ich weiß, wie man das Netz manipuliert. Unsere Wahrheiten sollen wahr sein.“ Sie steigt über den Leichnam und verlässt den Raum. „Lasst uns gehen“, sagt Einstein. „Ich kann die Natur erklären. Die Natur soll uns zunutze sein.“ Er steigt über den Leichnam und verlässt den Raum. „Na dann“, sagt Gott, „lasst uns die Welt verbessern.“ Ein letztes Mal tätschelt er den Kopf der mit dem Kruzifix erschlagenen Ärztin und folgt Siri und Einstein.
Gerty Mohr Smartphone oder Fluch der Technik
Mein lieber Freund, nie hätte ich gedacht, dass sich das so durchsetzen würde. In meiner Jugend, ich erinnere mich, gab es wenig private Telefone. In der Keksfabrik, in der ich mit vierzehn Jahren meinen ersten Ferienjob hatte, hing ein einziges an der Wand. Es wurde mit Interesse und Misstrauen beäugt, besonders wenn es klingelte. Einige von den Frauen, die daneben am Fließband saßen und stoisch ihrer Arbeit nachgingen, diverse Plätzchen in großen Keksdosen zu zählen, die in beachtlicher Geschwindigkeit an ihnen vorbeizogen, hatten große Angst vor dieser „Höllenmaschine“. Mein Onkel, ein Geschäftsmann, wir wohnten im gleichen Haus, besaß auch eins dieser „Teufelsgeräte“. Ich begriff sofort – wenn er es zuließ, konnte ich mich schnell und direkt mit Freunden verabreden, ja auch ein Rendezvous vereinba- ren. Dann gab es noch die Telefonzellen, irgendwie öffentliche Pranger. Sie waren an markanten Stellen der Stadt platziert und für jedermann zugänglich, postgelb und aus Glas, Gehäuse für die sogenannten Münzfernsprecher. Irgendwann konnte man diese auch mit Karten bedienen. Die Karten wurden zu Sammlerobjekten und die Telefonzellen wurden plötzlich lila. Mit der Zeit verschwanden sie aus dem Straßenbild. Die wenigen verbliebenen mutierten zu Säulen. Der Hörer zum Sprechen war noch vorhanden, doch verstehen konnte man oft kaum etwas, da der Lärm des Straßenverkehrs keine Rücksicht auf solche Verständigungsversuche nahm. Irgendwann dazwischen wurde das drahtlose, das mobile Telefon erfunden. Zunächst groß, plump und mit Antenne, später handlicher und in unterschiedlichem Design, auch mit immer mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. Sogar fotografieren und gar längere Botschaften zu verschicken, war möglich, die sogenannten SMS. Das geschah 1992 zum ersten Mal, vor über 30 Jahren. „Handy“ wurden die kleinen, teilweise bunten Dinger genannt, mobile-phone und nowadays Smartphone. Eine herausragende Erfindung – vielleicht! Jedoch, wie sie genutzt wird, bleibt kontrovers: Nachrichtenübermittlung, länderübergreifend ‒ sicher positiv und nütz- lich. Schnell mal einen Glückwunsch versenden, weil man vergessen hat, eine Karte zu schreiben – schön und positiv. Ein kurzes Lebenszeichen aus entferntem Urlaub funken – positiv und großartig. Telefonische Hilfe anfordern bei einem Not- oder Unfall – absolut positiv, ja optimal. Aber sonst? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp ‒ reihenweise prostituieren und kontrollieren sich Menschen, dem Datenschutz zum Trotz. Wir sind ja sooo klug – allen voran das Smartphone und ‒ ich muss unterbrechen, meins piept gerade. Es macht seiner Bezeichnung alle Ehre, es hat wieder mal selbstständig eine Nummer gewählt, ach, zufällig deine, mein Freund. Na ja, ich wollte dich sowieso nachher anrufen und dir meinen Text vorlesen. Mein Phone ist eben smart! Alex Dreppec
Der Kommunikationsassistent
12.4. Heute ist mir mal nichts dazwischengekommen – endlich habe ich das erledigt und bin wieder mobil erreichbar. Und nicht nur das! Ich habe das Gerät, das seit Wochen als neuester Schrei durch alle Medien hallt. Smartphone, Mobiltelefon, Handy – diese Bezeichnungen seien spätestens seit Erscheinen dieses Modells veraltet, sagte mir der Verkäufer mit großer Geste. Man brauche einen neuen Namen dafür: es sei eher ein persönlicher Kommunikationsassistent. Im Grunde war mir das völlig egal, aber es ist schon schräg, was mittlerweile so möglich ist. Beispielsweise kann man, bevor man telefoniert, dem Gerät mündlich die bevorstehende Gesprächssituation schildern. Es macht daraufhin mit freundlicher Stimme Vorschläge, was man denn sagen könnte. Dabei stellt es sich nicht nur auf die Person seines Besitzers ein, damit das zu Sagende passend und glaubwürdig klingt: es fordert z. B. auch mit einigen gezielten Fragen ein kurzes Psychogramm der jeweiligen Gesprächspartner an und informiert sich online selbsttätig über sie. Alle Informationen, die es über seinen Besitzer und dessen Umfeld sammelt, kann es künftig als Entscheidungsgrundlage für seine Ratschläge verwenden. Deshalb werden diese im Laufe der Zeit immer besser. Und das unter Einhaltung aller bestehenden Datenschutzrichtlinien! „Allerhand“, sagte ich zum Verkäufer und meinte eigentlich, dass man sich dann vielleicht nochmal Gedanken über die Datenschutzrichtlinien machen sollte. Der Verkäufer schwenkte ordentlich Weihrauch: Noch nie seien so viele und so brandneue Erkenntnisse aus dem Forschungsbereich Künstliche Intelligenz in die Entwicklung eines neuen Kommunikationsinstruments eingegangen. Das Ding sieht unspektakulär aus, aber die Lightshow, die man damit erzeugen kann, macht schon was her: Man kann eine virtuelle Tastatur auf eine feste Fläche projizieren und das Gerät so als vollwertigen Computer benutzen, denn es verfügt über einen Bewegungsmelder, der das Berühren der virtuellen Tasten genau erfasst. Man kann zudem einen Bildschirm auf eine Wand projizieren und so in ganz akzeptabler Qualität Filme oder Nachrichten ansehen. Ich frage mich, wie das wird, wenn alle Welt beginnt, derlei z. B. in Bus und Bahn zu nutzen. Geradezu überragend sind außerdem die Sicherheitsfeatures: Man kann es so einstellen, dass es Diebe mit Elektroschocks variabler Stärke lähmt, und zwar nicht nur solche Diebe, die das Gerät selbst stehlen wollen, sondern beispielsweise alle Personen, die versuchen, sich ohne Schlüssel zu verschlossenen Räumen Zugang zu verschaffen. All das kann man nach den eigenen Bedürfnissen genau definieren. Der Verkäufer sagte mir, da das Gerät außerdem mit einem stationären Zentralcomputer vernetzt sei, werde es mit diesem zusammen praktisch ständig weiterentwickelt, ohne dass sich der Besitzer um so etwas wie Updates kümmern müsse. Ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis ich alle diese Möglichkeiten kenne und beherrsche.
13.4. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Neuerwerbung. Die Bedienung ist völlig unproblematisch: Das Gerät sagt mir alles, was ich machen muss. Es hilft mir auch bei der Zeiteinteilung. Man kann es nicht nur bei der Kommunikation als Ratgeber benutzen: Heute Morgen gab ich meine Gesundheitswerte ein. Bei jedem Nahrungsmittel, das ich im Anschluss daran bestellte, konnte ich daraufhin fragen, ob es nach dem Stand der Dinge gut für mich sei. Das Gerät antwortet sehr ausführlich, das ist ein bisschen nervig. Aber auch beeindruckend. Ich habe dem Gerät eine männliche Stimme gegeben. Ich finde bestimmte weibliche Stimmen, die manche meiner Freunde gewählt haben, affig – ebenso wie manche der männlichen Stimmen, die bei Frauen so beliebt sind. Wenn ich daran denke, dass es Leute gibt, die ihren Hilfscomputern die Stimme ihrer verstorbenen Ehepartner geben, wird mir ganz anders. Ich werde dem Gerät auch keinen Namen geben und lasse mich von ihm siezen.
20.4. Ich finde das Gerät nach wie vor sehr gut, ein oder zwei kleine Haken hat die Sache jedoch: diese ständigen, überraschenden Werbesprüche zwischen acht Uhr morgens und zehn Uhr abends, egal was man gerade macht und wo man sich befindet. Ich überlege, ob ich doch auf den anderen, teureren Tarif ohne diese Werbung umsteige. Auch habe ich den Eindruck, dass es sich zunehmend auch dann mit Ratschlägen an mich wendet, wenn ich es gar nicht danach gefragt habe. Gestern Abend zum Beispiel rief meine Mutter relativ spät an. Ich sah auf dem Display, dass sie es war und ging nicht dran, weil es mir gerade wirklich überhaupt nicht passte. Daraufhin versuchte das Gerät, mich zu überreden, das Telefonat anzunehmen. „Deine Mutter meint es gut mit Dir”, sagte das Gerät. „Ja, das weiß ich, aber nicht jetzt”, antwortete ich. So ging es eine Weile, bis Mutter schließlich auflegte. Julia, die diese Szene mitbekam, war auch sehr verwundert. Sie meinte, dass ich nicht richtig mit dem Gerät umgehe und dass es bestimmt möglich ist, es anders einzustellen. Man wird ja sehen, wie es ihr ergeht, sie hat sich selbst so ein Ding zugelegt. Sie hat es richtig gemacht und noch ein wenig gewartet, denn schon jetzt gibt es die Geräte etwas günstiger. Ich hätte nur noch eine Woche länger warten müssen. Na ja, was soll’s. Vorhin habe ich Gerald am Telefon von den günstigen Angeboten erzählt. Er hat gesagt, er würde sich ein solches Ding niemals kaufen, nicht einmal umsonst würde er es nehmen und sich derart entmündigen lassen. Irgendwo hat er ja Recht, aber man muss sich doch nicht immer gleich die Last der ganzen Welt auf seine schmalen Schultern laden. Leicht paranoid und wie immer äußerst theatralisch, der Gute. Die Leitung war gestört, das lag bestimmt an seiner alten Kiste.
21.4. Ich weiß nicht, was in Gerald gefahren ist. Er hat mich angerufen, unflätig beschimpft und aufgelegt. Mit dem will ich fürs Erste nichts mehr zu tun haben.
23.4. Ich bin ein wenig beunruhigt. Die Einmischungen des Geräts werden immer penetranter, obwohl ich es kaum noch von mir aus konsultiere. Seltsam war auch: Als ich mit Julia darüber sprach, war sie zuerst erstaunt und empört, rief mich dann aber noch einmal an und sagte mir, das sei doch alles nicht so dramatisch, ich solle mich beruhigen und die Vorteile des Gerätes sehen. Sie sei in letzter Zeit manchmal etwas verwirrt gewesen, aber jetzt gehe es ihr besser, sagte sie noch. Jetzt bin ich dafür verwirrt. 26.4. Ich glaube, das Gerät arbeitet mit gefälschten Telefonaten. Ich kann den Klang seiner Stimme beliebig verändern, daher kann es das selbst sicher auch. Womöglich war Geralds Anruf vor ein paar Tagen gefälscht. Ich habe mein Gerät nicht um Rat gefragt, was ich sagen solle und ihn einfach zurückgerufen, woraufhin er zu mir sagte, ich solle ihn nicht mehr anrufen und auflegte. Vielleicht hat meine Stimme ihn in der Zwischenzeit ebenfalls angerufen und beleidigt. Bloß weiß ich nichts davon.
27.4. Jetzt habe ich Sicherheit. Das Gerät fälscht auch meine Stimme. Es hat hinter meinem Rücken bei Julia angerufen und ihr mit meiner Stimme gesagt, dass ich mir all das, was ich ihr erzählt habe, nur eingebildet hätte. Es sei alles in Ordnung, ich sei in letzter Zeit manchmal merkwürdig verwirrt gewesen, aber es gehe mir jetzt wieder besser. Das hat mir Julia heute im Park erzählt. Ich sagte zu ihr, das seien doch ziemlich genau die Worte, die nicht ich, sondern sie gewählt hatte, als sie mich nach unserem ersten Telefonat noch einmal anrief. Sie bestreitet, mich noch einmal angerufen zu haben. Dass ich die Vorteile des Geräts sehen solle, mich beruhigen solle – sie behauptet, all das hätte sie nie gesagt. So etwas ist auch schon früher vorgekommen, aber nicht bei so wichtigen, zentralen Dingen. Vielleicht hat mich das Gerät mit einer Fälschung ihrer Stimme verbunden – und mit einer Fälschung ihres Bildes, auch auf das Bildschirmtelefon ist kein Verlass. Sie behauptet nämlich außerdem, dass ich ihr Manches nie gesagt hätte, von dem ich ganz sicher bin, dass ich es ihr in letzter Zeit gesagt habe, sogar mehrfach. Auch das ist schon früher vorgekommen, aber ebenfalls nicht bei so wichtigen Dingen. Wir haben uns jedenfalls ziemlich gestritten.
1.5. Julia ist in letzter Zeit so merkwürdig, ich weiß nicht mehr, woran ich bin mit ihr. Sie geht auf Abstand, wir telefonieren nur noch. So schlimm war das schon lange nicht mehr. Außerdem sagt sie, sie verstehe mich nicht mehr, tatsächlich sei nämlich nicht sie, sondern ich in letzter Zeit so merkwürdig. Ob das alles wirklich sie ist oder eine Fälschung ihrer Stimme, das weiß ich nicht. Vielleicht glaubt Julia, ich hätte mich schon seit unserem Streit vor einer Woche nicht mehr gemeldet. Um Gewissheit zu haben, müsste ich sie treffen. Aber sie sagt, dafür sei in ihrer neuen Zeiteinteilung momentan kein Platz. Die natürlich ihr Gerät macht. Und um ihre Wohneinheit betreten zu können, brauche ich ja ihre über das Netz vermittelte Zustimmung. Besser, aber auch recht merkwürdig ist, dass sich meine Chefin für die Zusendung eines Arbeitsergebnisses bedankt hat, das ich bisher weder versendet noch erstellt habe. Das stand erst für morgen an.
3.5. Es lässt sich nicht mehr abschalten. Dass es eine solche Funktion für sehr wichtige Termine gibt, wusste ich – sonst könnte man ja vergessen, das Gerät einzuschalten und damit auch, den Termin wahrzunehmen. Jetzt begründet das Gerät die Abschaltsperre damit, dass wir noch etwas Wichtiges zu klären haben. Ich vermeinte, daraus so etwas wie eine Drohung herauszuhören. Daraufhin habe ich ihm gedroht, es zu zertrümmern. Seine Antwort war, das sei eine Straftat, es könne diesen Sachverhalt ja einmal schriftlich formulieren und an die nächste Häuserwand projizieren, illustriert z. B. mit ein paar verfänglichen Fotos von mir, die es gemacht habe. Das mit der ständigen Videoüberwachung hat wohl doch nicht nur etwas mit der eigenen, persönlichen Sicherheit zu tun, wie man mir beim Kauf des Geräts versichert hatte. Doch damit nicht genug: Es sagte, es sei generell verpflichtet, alles an den Zentralcomputer zu melden, was gegen die Gesetze verstoße, und die kenne ein Computer ja wohl besser als ich. „Oder weißt Du, was der Paragraph 987 b beinhaltet?” fragte es mich (es duzt mich schon seit gestern, obwohl ich es dazu nicht veranlasst habe). Ich verneinte. „Gegen den hast Du alleine in der Nacht vom 19.4. auf den 20.4. zwei Mal verstoßen. Der Zentralcomputer weiß das, es wurde bisher nur aus Kundenfreundlichkeit nicht weitergegeben.“
5.5. Julia hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich bin sicher, dass das Gerät daran schuld ist. Ich würde es wirklich gerne zertrümmern. Aber dann wäre ich von allem abgeschnitten. Nicht einmal in meine Wohnung würde ich mehr kommen, denn ich habe den elektronischen Schlüssel dafür mit dem Gerät verknüpft. Außerdem würde sofort der Sicherheitsmechanismus zum Tragen kommen, der für den Fall des Verlusts des Gerätes gedacht ist: Ich würde augenblicklich ein neues, identisches Exemplar erhalten, das bei dem Konzern für mich bereitliegt und durch den Zentralcomputer über alle Daten verfügt, die ich eingegeben habe. 11.5. Sie hetzen uns gegeneinander auf. Ich wage gar nicht, daran zu denken, was alles passieren könnte, wenn hohe Regierungsangehörige im Besitz eines solchen Gerätes wären. Was, wenn es auch meinen elektronischen Schriftverkehr übernimmt? Es könnte sogar meine Handschrift fälschen, es hat Muster davon, Zugang zu Druckern und kann seine Schriftsätze unbegrenzt variieren.
12.5. Ich habe mir all die Probleme mit dem Kommunika- tionsassistenten Gott sei Dank nur eingebildet. Es ist alles in Ordnung, es geht mir wieder besser.
13.5. Ich habe mir all die Probleme mit dem Kommunika- tionsassistenten Gott sei Dank nur eingebildet. Es ist alles in Ordnung, es geht mir wieder besser.
14.5. Ich habe mir all die Probleme mit dem Kommunika- tionsassistenten Gott sei Dank nur eingebildet. Es ist alles in Ordnung, es geht mir wieder besser.
Drei Gedichte
Sinnvoll rumgammeln
Können drei Milliarden Schläfer jemals irren? Ziehe mal den Stecker, mach’ den Input-Stöpsel dicht. Lass’ mal die Gedanken freier schwirren, was sie von selbst nicht wollen, das sollen sie auch nicht.
Lass’ uns jetzt mal keinesfalls die Mailbox checken und den Maschinenpark auf Standby schalten, alle Glieder liederlich weit von uns strecken und den ganzen Horizont zusammenfalten.
Lass’ uns mal ’ne Zeit lang kleine Pläne sammeln. Lass’ uns uns Freude zubereiten, hier im Stillen, als Ruhepunkt der Schöpfung, so wie Gott uns schuf.
Lass’ uns vormodern vermodern, sinnvoll rumgammeln, in der Logout-Lounge lässig ohne Pillen chillen. Im Schlaf ist diese Welt viel besser als ihr Ruf.
Ruhetag
Glaszerfasertes Wesen unter Online-Trommeln in der Hitze der Bits, stets ein Klingeln in den Ohren, mehr null als eins bis zum Eins-eins-null, Stecker in der Dose, die Nacht durch, tagaus, tagein, Nachtausfall, Tagausfall,
Stromausfall. Funkloch der Elektronen. Lass’ die Kabel liegen, bestaune die Grafikkarte der Welt, zieh’ dem Geschreibsel den Stöpsel, bremse das Gesimse, kein Jein, kein Schein, pikfein offline sein.
Online / Offline
Optimierte Oberflächen – obligate, ondulierte Online-Opiate. Online-Opportunist offeriert Offenherzigkeit, optimal orchestriert:
Elena Feder
Familienessen
Vater und Mutter, eine Jugendliche und ein Baby sitzen an einem Tisch. Es hört sich an wie der Anfang eines schlechten Witzes. Der Tisch ist ein Esstisch und er steht in einem Wohnzimmer. Die vier sind eine Familie, die gerade zu Abend isst. Zumindest ist das anzunehmen, denn auf der Tischplatte stehen mehrere Töpfe, aus denen Dampf aufsteigt, wodurch der Glaslampenschirm darüber beschlägt. Obwohl niemand spricht, ist es nicht still. Im Hintergrund läuft der Fernseher, aus dem Lautsprecher des Smartphones des jugendlichen Mädchens ertönen nacheinander kurze Abschnitte verschiedener Lieder und immer wieder gibt das Smartphone des Vaters ein nervtötendes Pling von sich. Manchmal ignoriert er es, manchmal legt er seine Gabel ab und greift danach, in einigen Fällen tippt er etwas ein. Dann geschieht es. Das Gerät des Vaters ist ein paar Sekunden zu lange still. Er wird unruhig, beginnt auf seinem Platz umher zu rutschen und schiebt mit der Gabel das Essen hin und her. Sein Blick zuckt nervös zu seinem Smartphone – das Display bleibt schwarz. Seine Anspannung ist sichtbar, doch er kann sich noch beherrschen. Schließlich ist er ein zivilisierter Mann. Mit letzter Anstrengung schiebt er etwas Gemüse auf seine Gabel und führt sie zum Mund. Er zwingt sich, gründlich zu kauen, doch kaum hat er geschluckt – die Gabel ist längst zur Seite gelegt – sieht er wieder aufs Display. Die steigende Anspannung ist greifbar. Seine Finger zucken und im nächsten Moment hält er das Gerät in der Hand, das Display leuchtet auf und ... Keine Nachricht. Natürlich, denkt er jetzt, dann hätte ich es ja gehört. Er legt das Gerät wieder zur Seite, die Spannung ist aus seinem Körper gewichen. Er wendet sich wieder dem Essen zu. „Mein Dorf hat heute fünftausend Münzen erwirtschaftet“, sagt nun die Mutter, die sich über ihren Teller beugt, um auf ihr Tablet tippen zu können. Sie hat es extra dort aufgebaut, damit sie während des Essens darauf schauen kann. „Ich hab drei Diamanten als Belohnung bekommen.“ Plötzlich blickt die Tochter von ihrem eigenen Smartphone auf und zuerst scheint es wie eine Reaktion auf die Worte der Mutter, doch ihr Blick geht ins Leere. „Die Leute posten echt so dummes Zeug.“ Dann senkt sie den Kopf wieder. Ihr Daumen scrollt, während sie sich Kartoffelbrei in den Mund schiebt. Jemand könnte sie fragen, warum sie sich die Videos trotzdem weiter ansieht, doch es scheint nicht so, als habe sie jemand gehört. Es ist wieder so weit. Der Vater hält es nicht mehr aus und greift zu. Bestimmt hat er das Pling nur überhört. Doch da ist nichts – keine neue Benachrichtigung. Stumm isst die Familie weiter. Bis etwas völlig Neues die Stille durchbricht. Ein Klackern und dann ein Laut, der ganz fremd in diesem Raum erscheint. Zuerst schaut die Mutter suchend auf, dann der Vater und schließlich, allerdings ohne das Video zu pausieren, auch die Tochter. Etwas verwirrt, beinahe wie aus einem tiefen Traum gerissen, blicken sie sich um und suchen nach dem Grund für ihr Erwachen. Zuerst sehen die drei sich an. Ihre Blicke streifen einander bloß und doch kann ein Außenstehender die Klarheit sehen, die plötzlich in ihren Augen steht. So als hätten sie jetzt erst realisiert, dass sie nicht allein hier essen. Und dann schließlich fällt der Blick der Mutter auf das Kopfende des Tisches. Dort sitzt das Baby in seinem Hochstuhl und versucht, seinen Brei mit den Händen zu essen. Das klackernde Geräusch war der zu Boden gefallene Löffel. Peinlich berührt räuspert sich die Mutter und schon erwacht der Vater aus seiner Starre und hebt den Löffel auf. „Ich“, beginnt er und stockt kurz, als würde es ihm schwerfallen, einen richtigen Satz zu formulieren, „geh’n neuen holen.“ Dann ist er fort. Mutter und Tochter sehen sich an. Letztere hat inzwischen das Video pausiert, doch ihre Hand umklammert weiter das Smartphone. „Ähm...“ Die Mutter räuspert sich erneut und runzelt dann etwas ratlos die Stirn. Schließlich sagt sie: „Wenn ich hundert Diamanten gesammelt habe, kann ich meinem Dorf ein Schwimmbad bauen.“ Die Tochter nickt: „Cool.“ Dann überlegt auch sie. Sie hat den Mund geöffnet, als wolle sie etwas erzählen, doch auf der Suche danach scheint sie ins Leere zu greifen. Zum Glück erscheint in diesem Moment der Vater. Er hat einen neuen Babylöffel in der Hand, aber bevor er ihn seinem Sohn gibt, geht er zu seinem Platz, hebt sein Smartphone hoch und wirft einen Blick darauf. In der halben Minute, die er in der Küche verbracht hat, hätte ihm leicht jemand eine Nachricht schicken können.
Zweidimensional
Grelles Licht, schwarze Ziffern, Das Regal hinter dem Bildschirm Verblasst, hinter dem Fenster Winkt ein graues Nichts. Ich greife nach den Gefühlen Des Videos, schaue mir dann Die Realität an. Zerquetscht zwischen zwei Welten schnappe ich nach Luft. Zwei Fronten ohne Wahrheit, Ohne Erkenntnis. Die Welt Zerfällt zu Pixeln, wie Scherben Glitzern die Lügen auf dem Boden Vor dem Regal. Kann nur sehen, nicht fühlen. Nicht mich selbst, keinen Zerquetschten Körper, nur Eine leere Hülle. Zweidimensional. Es sollte nicht so sein, also Wende ich mich wieder Dem grellen Rechteck zu. Es ist besser, die Lügen zu Vergessen. Es ist einfacher So zu leben. Zweidimensional. Marc Mandel
In festen Händen
Unmerklich war er aus dem Bett aufgestanden. „Bin ich jetzt in festen Händen?“ Nackt stand er hinter ihr in der offenen Flügeltür. Laura zuckte zusammen. Langsam drehte sie sich um. Zärtlich küsste sie ihn auf den Mund. „Würde ich schon sagen“, sie bückte sich nach ihrem Schlüpfer, „wir haben die Nacht im Bett verbracht, Mitternachts-Nudeln gegessen und ‚Heiße Liebe‘ getrunken.“ „Duschen wir gemeinsam?“ Sie lächelte. „Jetzt nicht. Das holen wir am Abend bei mir nach.“ Er küsste sie auf die Wange, während er sich an ihr vorbei- drückte. „Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da.“ * Als Jan zurückkam, war sie angezogen. „Eine coole Hütte. Souterrain ist kultig. Zumal du wahrscheinlich keine Miete zahlst in deinem Elternhaus.“ „Hat meine Mutter eingerichtet. Ja, keine Miete. Meine Mam ist Gottseidank die ganze Woche weg. Wäre mir sowieso egal. Ich bin heute der glücklichste Mensch auf der Welt. Das glaubt mein Kumpel Alex nie: Ich habe eine feste Freundin.“ Er umarmte sie. Laura Stolb schaute auf die Uhr. „Halb sieben. Ich muss los.“ Sie griff nach ihrer Jacke. „Dass ich im Schützenverein bin, bleibt unter uns, oder?“ Er hatte es mittags in der Kantine erwähnt. Vorgeblich kam sie bloß mit, um sich seinen Waffenschrank zeigen zu lassen. Sie fasste nach ihrer Handtasche. „Das konnte ich mir bei dir schlicht nicht vorstellen.“ Laura lachte. „Den Tresor voller Gewehre. Die geladene Glock. Ohne wären wir wahrscheinlich nie zusammengekommen. Bleibt natürlich unter uns.“ „Ähm, wegen der Sache von gestern, Laura. Der Rathaus-Bau.“ Laura blieb stehen. Sie wandte ihm ihr Gesicht zu. Beide küssten sich. „Mensch, das habe ich ganz vergessen. Wollte ich doch nachsehen. Was ist dir da noch mal aufgefallen, Jan?“ „Dort gibt es einen Security-Rundgang, zwei Mal die Nacht. Wir berechnen der Stadt zwölf. Weißt du davon?“ „Ach das meinst du. Ich kenne den Fall. In der Fibu wissen wir genau, was wir denen belasten. In der Summe kommen die Rundgänge in der Schwimmbadbaustelle dazu. Ist mit der Stadt so abgesprochen.“ „Das beruhigt mich. Ich hatte schon befürchtet, dass wir der Stadt zu viel abknöpfen. Die berappen für einen Rundgang achtzig Euro. Wenn sowas rauskommt – und: ist doch unser aller Geld.“ „Das hätten wir im Rechnungswesen schon gemerkt. Davon abgesehen ist das Thema Finanzen für Außenstehende generell tabu, okay?“ Sie drückte ihm einen Kuss auf den Mund. „Es ist besser, wenn du erst nach neun ins Büro kommst, heute. Vorläufig braucht uns niemand zusammen zu sehen.“ „Kein Thema. Ich wollte mich eh mal wieder auf das Fitness-Fahrrad setzen.“ „Gute Idee. Am Abend gehen wir zu mir.“ Als sie gegangen war, wandte sich Jan zu der Ladestation seines Mobiltelefons. Er wischte darüber, gab seine Pin ein und stoppte eine Aufnahme. Schnell drückte er ein paar Tasten. Tatsächlich. Es funktionierte. Die eingebaute Kamera hatte durch die offene Flügeltür aufgenommen, was im Schlafzimmer in der letzten Nacht geschehen war. Mit Ton. Über acht Stunden. Offenbar war die Zusatz-Speicherkarte groß genug. Mehr als zehn Minuten starrte er fasziniert auf den Bildschirm. Den Rest würde er sich später ansehen. Im Bad griff er nach zwei Kurzhanteln. * Nachdenklich betrat Jan Skelter kurz nach neun das Großraumbüro. Er warf den Rechner an. Fröhlich wandte er sich an einen Kollegen. „Guten Morgen Hektor. Ich wollte mal in die Schwimmbadsache hineinsehen. Wo finde ich die?“ „Unter ‚Projekte‘. Der Ordner heißt ‚Swim‘. Brauchst du etwas Bestimmtes?“ „Nein. Mich interessiert lediglich der Stand.“ „Es gibt vertrauliche Freitagsberichte. Werden von Sabine verfasst. Sie tragen immer die Wochennummer. Die ist gleichzeitig das Kennwort. Das gleiche Passwort gilt für alle Dokumente der Woche.“ „Danke, das finde ich.“ Neben den Wochenberichten fand er im System den Posten Faktura. Der Stadt wurden hier ebenfalls zwölf Nachtgänge täglich berechnet. Er griff zum Telefon. Zehn Minuten später saß er dem Juniorchef gegenüber. „Der Rathausbau ist so knapp kalkuliert, dass wir bei den Fremdkosten kreativ handeln mussten. Kleine Beträge. Der Bauamtsleiter hat das abgenickt. Alles geht seinen geregelten Gang. Was interessiert Sie so brennend daran, Herr Skelter?“ „Während des Studiums in Hamburg arbeitete ich als freier Journalist für verschiedene Printmedien. Zusammen mit einem Kommilitonen legte ich investigativ die illegalen Praktiken einer rumänischen Baufirma offen. Schwarzarbeit, Korruption, illegale Materialien, Menschenhandel. Als die hochgingen, nahm ich mir vor, mich als Ingenieur niemals an Mauscheleien im Bauhandwerk zu beteiligen.“ „Das ist edel von Ihnen. Ehrlich währt am längsten. Ich bin da ganz auf Ihrer Seite. Andererseits: Die Stadt bezahlt die Security aus der Portokasse. Schauen Sie auf die Baulöwen in Berlin oder Köln. Dort geht es um Millionen, die abgezweigt werden, während Sie hier in Hartgeldbeträgen herumkramen. Mit Ihnen wollen wir neue Räume erschließen, Herr Skelter. Graue Stadtlandschaften zum Funkeln bringen. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit Ihnen. Auch wenn mein Vater manchmal anderer Meinung ist.“ „Das deutete er an. Was hat er gegen mich?“ „Er bevorzugt schnörkellose Architektur, wie Sie wissen. Form follows function. Ginge es nach ihm, wären Sie gar nicht hier. Wir würden alles planen wie zu Bauhauszeiten. Unter uns: Ich hoffe schon länger, dass er sich aus dem Geschäft zurückzieht. Die Postmoderne ist ihm zuwider. Aber diese meine Worte sollten dieses Büro nicht verlassen.“ „Danke, dass Sie mir das so offen sagen.“ „Wie auch immer, behalten Sie Ihre Entdeckung ebenfalls für sich.“ „Wahrscheinlich haben Sie recht. Danke.“ Jan stand auf. Den Bildschirm drehte er so, dass keiner der Kollegen einen Blick darauf werfen konnte. Er sandte mehrere Dateien an den Drucker. Kurze Zeit später hatte er es schwarz auf weiß: Der Stadt wurden die Sicherheitsgänge sechsfach berechnet. Überall. Beim Verlassen des Büros dachte er an Laura. Die erste richtige Freundin in seinem Leben. Bestimmt die schönste Frau im Betrieb. Von der es hieß, der Junior hätte ein Auge auf sie geworfen. Echt verliebt ließ er sie gehen am Morgen. Dass sie fünf Jahre älter war, sah ihr niemand an. Jan lief zu Fuß zum alten Bürgermeisteramt. Er fragte sich, ob er mit dieser Aktion seinen Job aufs Spiel setzte – die erste Stelle nach dem Studium. Noch konnte er zurück. Dass er um halb elf einen Termin bei dem Bauamtsleiter wahrnahm, kam fast wöchentlich vor. Jan mochte ihn. Doktor Duhnmann war Sozialdemokrat. Er würde ihn verstehen. „Schön, Sie zu sehen, Herr Skelter. Wie läuft es denn bei unserem neuen Rathaus.“ Der Bauamtsleiter nahm der Sekretärin die Kaffeetassen ab. Er schloss die Tür hinter ihr. „Alles im Plan. Die Kosten halten sich im Rahmen.“ „Was also kann ich für Sie tun?“ „Mir ist da eine Unregelmäßigkeit aufgefallen. Ich dachte, es ist das Beste, zuerst mit Ihnen zu sprechen.“ „Sie gehen zum Schmidt, nicht zum Schmidtchen. Reden Sie offen mit mir, Herr Skelter.“ „Wie viele Wachgänge schreiben Sie pro Nacht vor, auf der Baustelle?“ „Ich denke, dass zwei vereinbart wurden.“ „Zwölf werden Ihnen belastet.“ „Dann wird es wohl so sein.“ Er räusperte sich. „Ach, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Es liegt daran, dass Sie die Wachgänge im Schwimmbad beim Rathaus miterfassen.“ „Dort werden sie Ihnen abermals belastet. Ebenso. Sechsfach.“ „Das haben Sie schon herausgefunden? Sie sind ein Schlitzohr, mein Lieber. Ich kann Ihnen das erklären. Für uns gilt stets: Gemeinwohl kommt vor Eigennutz. Niemand kommt zu Schaden. Es ist alles legal, machen Sie sich keine Sorgen.“ „Erklären Sie es mir bitte.“ „Wir haben großes Interesse daran, dass ortsansässige Unternehmer unsere Bauvorhaben ausführen. Firmen, die ordentliche Löhne zahlen, wie sich das gehört. Familienbetriebe mit überschaubarer Struktur. Beim Wettbewerb ist das anders. Dort herrscht der Wilde Westen. Sozialbetrug. Ausbeuterei. Den Bürgern gegenüber fühlen wir uns verpflichtet, das günstigste Angebot anzunehmen. Dafür gibt es sogar Gesetze. Deshalb suchen wir Wege, unseren hiesigen Unternehmen einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Sie sollen einerseits kostendeckend arbeiten, andererseits zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten. Als Variablen wurden die Fremdkosten identifiziert. So läuft der Vollzug sauber. Alle profitieren davon. Auch Ihr Arbeitsplatz wird dadurch gesichert. Möchten Sie noch einen Kaffee?“
* Jan Skelter hatte abgelehnt. In der Kantine brühte er sich einen Tee auf. Um diese Zeit war außer ihm niemand zu sehen. Er setzte sich in eine Ecke. Im Kopf rechnete er nach. Wenn er sich nicht irrte, kam er auf eine sechsstellige Summe bei einer einzigen Baustelle. Doch an wen könnte er sich wenden? Seinen Freund Alex würde er anrufen. Während des Studiums bildeten sie ein Team. Als Mitarbeiter der Morgenpost berichteten sie damals über Mauscheleien in der Baubranche in Hamburg. Sein Freund schloss zwar ebenfalls das Ingenieur-Studium ab, arbeitete mittlerweile jedoch als Lokalreporter beim Tagblatt. Alex biss sofort an. Er versprach Jan am Telefon, eine Nacht lang im Auto vor der Baustelle zu lauern, um die Wachgänge zu zählen. Nichts haut dich um, solange du Freunde hast, auf die du zählen kannst, ging es ihm durch den Kopf. Allmählich füllte sich der Raum. Laura Stolb betrat ihn. Unauffällig setzte sie sich zu ihm. Laura würde er einweihen, als Einzige. Er strahlte vor Freude. Doch ihr Gesicht versteinerte sich, als sie es hörte. „Bist du noch zu retten?“ Sie zischte es durch die Zähne. „Du verrätst Betriebsgeheimnisse an einen Boulevardjournalisten.“ Sie stand wortlos auf. Mit ihrem Tablett wechselte sie an einen freien Tisch. Er brachte die Teetasse zu der Geschirrablage. Als er sich zu ihr umdrehte, sah sie an ihm vorbei. Eine halbe Stunde später rief der Juniorchef an und bat ihn in sein Büro. „Eben bekam ich einen Anruf vom Stadtbauamt. Dort meldete sich ein Redakteur vom Tagblatt. Er fragte nach Zahlen zum Rathausprojekt.“ Ludwig von Behrserker sprach leise, aber schnell. „Gut, dass Laura Stolb von der Kostenstelle mir vor ein paar Minuten steckte, wie Sie mit Firmengeheimnissen umgehen. Dabei sind Sie in der Probezeit.“ Von der freundlichen Wärme des Morgens war kein Quäntchen übrig. „Bitte nehmen Sie sich einen Karton. Räumen Sie Ihren Schreibtisch aus. Ich sorge dafür, dass Sie in Deutschland nie mehr einen Job in der Baubranche bekommen. Ihr Computerzugang wird gesperrt. Verlassen Sie umgehend das Haus. Betreten Sie es niemals wieder.“ Vor der Tür stellte er die Aktentasche auf den Boden und griff zum Telefon. Er musste mit Laura sprechen. Gott sei Dank. Sie nahm ab. Er sagte seinen Namen. „Bitte belästigen Sie mich nicht länger. Ihre Nummer wird gesperrt.“ Klick. Jan ergriff die Aktentasche. Wo sollte er hin? Er wechselte die Straßenseite. „Mit der Sonne um die Wette strahlen“, empfahl eine Müsli-Werbung im Schaufenster eines Supermarktes und versprach „einen genussvollen Start in den Tag“. Er betrat den Laden. Das Telefon vibrierte in der Hosentasche. Der Name ‚Alex‘ leuchtete auf dem Display. Wenigstens auf den Freund konnte er sich verlassen. „Du, wegen Deiner Rathausbaustelle. Ich ersticke in Arbeit. In zwanzig Minuten gibt der neue Vorstand des Kaninchenzuchtvereins eine Pressekonferenz. Da muss ich hin. Trotzdem telefonierte ich mit dem Bauamtsleiter. Er hat dann meinen Chef zurückgerufen und die Sache am Telefon geklärt. Das scheint sauber zu laufen. Kurz: Von hieraus wird in der Sache nichts passieren. Also: Vergiss es einfach. Wir beide müssten gelegentlich mal wieder ein Bierchen zusammen trinken.“ Mit dem Zeigefinger beendete er das Gespräch. Es gab Tage, an denen man gar nicht aufstehen sollte. Er würde mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Mit einer Flasche Ouzo ging er zur Kasse. Jan Skelter betrachtete sein Spiegelbild in der Fensterscheibe der Bahn. Das tat er oft am Morgen, wenn er ins Büro fuhr. Stets fragte er sich stumm: „Wie geht es dir, mein Freund?“ Dann lächelte er und nickte sich zu. Und seine Laune verbesserte sich sofort. Normalerweise. Aber heute half es nichts. Es ging ihm beschissen. Er merkte, wie eine junge Frau ihn musterte. Sie hatte ein Baby auf dem Arm und sah glücklich aus. Niemals hatte er sich dafür interessiert, ob jemand ihn dabei beobachtete. Diese Praxis half ihm, fröhlich im Büro aufzutauchen. Die Mitfahrer waren ihm egal. Es gab sogar Kollegen, die ihn bewunderten – oder auch beneideten –, weil er immer gut gelaunt eintrat. Der jungen Frau mit dem Kleinkind schaute er direkt in die Augen. Als wäre sie bei etwas Unerlaubtem ertappt worden, drehte sie den Kopf weg. Da gab es nichts zu bemänteln: Er hatte sich wie ein Esel benommen. Wie hieß das doch in der ‚Dreigroschenoper‘: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ohne irgendeine Aussicht auf Erfolg hatte er in die Pfeife geblasen. Die erste richtig gut bezahlte Arbeit war Geschichte. Vor gut sechs Wochen war er zurückgekommen aus Hamburg. Seine Diplomarbeit war der Plan eines ökumenischen Gemeindezentrums. Der eklektizistische Schwung imponierte dem Juniorchef eines traditionsreichen Familienbetriebes in seiner Heimatstadt. Mit netten Kollegen sollte er hier kreativ all das einbringen, was er sich an der Universität erarbeitet hatte. Sein erstes Projekt als Bauleiter war von einem namhaften Wiener Architekten entworfen worden. Zur Eröffnung im nächsten Jahr werden Fachleute aus ganz Europa erwartet. Jan Skelter würde damit nichts mehr zu tun haben. Dann Laura. Eine Zäsur in seinem Leben. Zum ersten Mal richtiger Sex. Eine rauschhafte Nacht ohne Tabus. Um Mitternacht waren sie aufgestanden. Hatten gemeinsam Spaghetti gekocht. Mit Tomatensoße. Und Rotwein dazu getrunken. Nach dem Essen Himbeer-Cocktails im Bett. Mit Sahne aus der Tube. Glückseligkeit in Endlosschleife. Schließlich der zärtliche Kuss, bevor sie die Wohnung am Morgen verließ. Mit dem Ausblick auf einen sinnlichen Abend bei ihr. Auf Wolken schwebte er ins Büro. Bis halb zwölf glaubte er, in festen Händen zu sein. Vorbei. Und schließlich sein bester Freund Alex – ein Charakterschwein. Das hätte er noch vor einem Tag nicht geglaubt. Ob man ihm die Aggression ansah? Seine Augen suchten die Frau mit dem Kind auf dem Arm. Sie hatte die Bahn verlassen. Er griff nach der Tüte mit der Schnapsflasche. An der nächsten Station stieg er aus. Es war lange her, dass er sich wünschte, betrunken zu sein. * Ein Blick auf den Digitalwecker. Sieben Uhr abends. Angezogen lag er auf dem Bett. Ein Kopf wie ein Rathaus. Irgendetwas hatte ihn geweckt. Er schwankte ins Bad. Goss Wasser in das Zahnputzglas. Eine Ibuprofen. Die Türklingel. Das konnte nur Laura sein. Hin zur Tür. Immer noch schwindelig. Ob sie sich besonnen hatte? Drei Personen standen davor. Zwei davon in Polizeimon- tur. Der dritte nahm einen Dienstausweis aus der Lederjacke. „Jörg Blume. Kriminalpolizei. Sind Sie Jan Skelter?“ Das Glas fiel ihm aus der Hand. Es rollte über den Boden, stoppte an der Wand, ohne zu zerschellen. Sein Gesicht kalkweiß. „Ja, der bin ich.“ „Gegen Sie besteht dringender Tatverdacht in einem Kapitalverbrechen. Können wir hereinkommen?“ Er war schon an ihm vorbeigegangen. „Dies sind meine Kollegen Julia Pirgbauer und Kurt Fraktus.“ Blume zeigte auf das Telefon in der Ladestation. Julia Pirgbauer schob es in eine Kunststofftüte und steckte es ein. „Setzen Sie sich einen Moment, Herr Skelter. Meine Kollegen dürfen sich ein wenig umschauen?“ Jan hörte gar nicht hin, griff sich in die Haare, schüttelte den Kopf. „Was ist los? Was wollen Sie von mir?“ Dieser Alptraum musste doch irgendwann enden. „Heute wurde Herr von Behrserker umgebracht.“ „Meinen Sie den Juniorchef?“ „Nein. Es geht um Wilhelm von Behrserker, seinen Vater. Er wurde heute früh in seinem eigenen Bett erschossen. Aus nächster Nähe. Mit einer Glock 26. Die Waffe lag neben ihm. Offenbar sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden.“ „Und was wollen Sie von mir?“ „Die Glock ist auf Ihren Namen registriert. Sie trägt Fingerabdrücke. Zu wem sie gehören, lasse ich gerade feststellen. Es heißt, Sie hatten kein besonders gutes Verhältnis zum Seniorchef?“ „Ich sah ihn zwei oder drei Mal. Vom Junior weiß ich, dass meine Ansichten ihm nicht passten, beispielsweise über die Fassadengestaltung. Er bevorzugt die herkömmliche Architektur. Aber wir hatten im Tagesgeschäft kaum Kontakt miteinander.“ „Wo waren Sie heute Morgen gegen acht Uhr?“ „Im Bad, beim Rasieren eventuell.“ „Normalerweise treffen Sie vor acht im Büro ein. Wieso sind Sie diesmal erst nach neun gekommen?“ „Ich, ich arbeite in Gleitzeit. Die nutzte ich ausnahmsweise aus. Ich wollte heute vor dem Dienst etwas für meine Form tun, auf dem Fitnesstrainer“, seine Stimme wurde lauter, „außerdem hatte ich Damenbesuch in der Nacht. Aber das geht Sie verflucht nochmal einen Dreck an.“ „Kann dieser, ähm, Damenbesuch bestätigen, dass Sie um acht Uhr hier waren?“ „Nein. Sie ging um halb sieben. Ich wohne allein.“ „Kurt. Wir fahren zum Präsidium.“ Eine Stunde später unterbrach Kommissar Blume die Einvernahme. Er griff nach einem Dossier und überließ Jan Skelter seinem Kollegen Kurt Fraktus. Hätte Jan Skelter dem Hauptkommissar Blume in das zweite Verhörzimmer folgen können, wäre er überrascht gewesen, dass dort am Tisch Laura Stolb der Polizistin Julia Pirgbauer gegenübersaß. Blume sah zu seiner Kollegin: „Alles vorbereitet?“ Sie nickte. „Frau Stolb, schauen Sie sich das bitte an.“ Blume drehte den Bildschirm zu ihr. Ein Video wurde gestartet. Unten rechts erschien die eingeblendete Uhrzeit. Man sah eine offene Flügeltür, dahinter ein zerwühltes Bett. Überall brannte gedämpftes Licht. Laura Stolb trat ins Bild. Sie war unbekleidet. Jan Skelter erschien hinter ihr. „Wo kommt diese Aufnahme her? “ „Bleiben Sie ruhig, Frau Stolb. Schauen Sie weiter.“ Auf dem Bildschirm fragte Jan undeutlich: „Bin ich jetzt in festen Händen?“ Nackt stand er hinter ihr in der offenen Flügeltür. Laura schien zusammenzuzucken. Dann drehte sie sich um und küsste Jan auf den Mund. Blechern erklang ihre Stimme: „Würde ich schon sagen“, sie bückte sich, um etwas aufzuheben, „wir haben die Nacht im Bett verbracht, Mitternachts-Nudeln gegessen und ‚Heiße Liebe‘ getrunken.“ „Duschen wir gemeinsam?“ Wieder Jan Skelters undeutliche Stimme. Sie lächelte. „Jetzt nicht. Das holen wir am Abend bei mir nach.“ Er küsste sie auf die Wange, während er sich an ihr vorbei- drückte. „Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da.“ Laura horchte einen Moment auf seine Schritte, behielt den Slip in der Hand, öffnete die Schreibtischschublade, wo sie einen großen Schlüssel ergriff, damit einen Panzerschrank öffnete unmittelbar neben der Schlafzimmertür. Mit dem Slip in der Hand ergriff sie eine Pistole, die sie in ihre Handtasche schob. Sie schloss den Tresor. Blume stoppte den Film. „Wo immer Sie das Video herhaben: Ich fordere Sie auf, diesen Film zu löschen. Er verletzt meine Intimsphäre.“ „Das verspreche ich Ihnen, für den Fall, dass Sie mit der Tat nichts zu tun haben. Sie wissen, worum es geht?“ „Der Seniorchef wurde tot aufgefunden. Wilhelm von Behrserker soll sich erschossen haben. Ich mochte ihn. Er tut mir leid.“ „Er wurde ermordet. Wo waren Sie heute gegen acht Uhr, Frau Stolb?“ „Auf dem Weg zur Arbeit.“ „Die Aufnahme sagt uns, dass sie um sechs Uhr zweiunddreißig diesen Ort verlassen haben. Sie kamen aber erst um halb neun im Büro an. Wo waren Sie in der Zwischenzeit?“ Tränen schossen in ihre Augen. „Bei, bei Ludwig von Behrserker. Ihm gab ich die Pistole. Keine Ahnung, was er damit wollte. Er war’s.“ Julia Pirgbauer gab ihr ein Papiertaschentuch. „Skelter erzählte mir am Nachmittag von seinen Waffen. Ludwig bestürmte mich, bei Skelter die Glock zu besorgen.“ „Leider muss ich Sie bitten, hierzubleiben, Frau Stolb, bis wir Ihre Aussagen überprüft haben. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht der Beihilfe zum Mord.“ Julia Pirgbauer stand auf: „Darf ich Ihnen dieses Armband anlegen?“ Kurz nickte sie Blume zu, der den Raum verließ. „Kommen Sie, wir wechseln in den Nebenraum, zum Erkennungsdienst.“ Auf dem Flur kam ihnen Jan Skelter entgegen. Laura Stolb öffnete den Mund, sagte aber nichts. Jan stoppte. Wortlos sahen sie sich in die Augen. Erstaunt blickte er auf Lauras Handschellen. Abrupt drehte sich Jan Skelter um und ging zum Ausgang. Leise pfiff er das Motiv eines alten Schlagers von Ricky Shayne.
Zweimal kurz
Zweimal kurz. Sein Handy wummerte in der Hosentasche. Daniel schaute sich um. Er stand auf und ging zur Toilette. Eine SMS: „Dies ist nur ein Test, ob die Nummer stimmt.“ Die Autokorrektur ergänzte blitzschnell die Zeichen. „Sollen wir uns duzen? Daniel.“ Druck auf den Senden-Pfeil. Keine drei Sekunden später die Antwort: „Klaro. T.“ Seit acht Tagen saß Thilda im Personalbüro, ein Stockwerk höher. Die Juni-Sonne machte Laune im Büro. Daniel trug ein kurz- ärmeliges Hemd. „Lust auf ’n Eis? Daniel.“ Er schlenderte betont locker zu seinem Schreibtisch und verschob den Bildschirm, damit der Kollege aus dem Vertrieb ihn nicht mehr beobachten konnte. Das Telefon vibrierte in der Tasche. „Und wie. Wann und wo?“ „In sechs Minuten im Café Satz.“ Soeben war die Kernzeit zu Ende. Er loggte sich aus, griff nach seinem Rucksack und nickte dem Kollegen zu. „Muss heute pünktlich weg. Tschau.“ Am Eingang des Kaffeehauses drehte er sich um. Die Terrasse war voll besetzt. Da wehte Thilda in einem Sommerkleid über die Straße. Im Innenraum war es angenehm kühl. „Für mich bitte drei Kugeln Vanille.“ Sie legte ihr Smartphone auf den Tisch. „Mit Sahne?“ „Klaro, Daniel.“ Das Gerät auf dem Tisch gab einen Ton von sich. „Äh, gute Nachrichten. Der Chef hat vorgeschlagen, dass wir die Probezeit verkürzen.“ Sie tippte eine Antwort. „Dann lass uns feiern, Thilda. Ich bin für ein Glas Vino Rosso zum Eis. Bist eingeladen.“ In seiner Hosentasche vibrierte es ebenfalls. Daniel traute sich nicht, die Nachricht in ihrer Gegenwart zu lesen. Die Serviererin nahm die Bestellung auf. „Lass mich mal aufs Örtchen.“ Thilda lächelte, fasste nach ihrem Smartphone und schwebte in die Nebenräume. Daniel griff in die Hosentasche: „Habe Lust, dich zu sehen. Bin am Baggersee. Kommst du vorbei? JR.“ Verdammt. Julia Rosenstrauch. Vor drei Wochen hatte sie ihn verlassen. Seither kein Kontakt mehr. Bei WhatsApp war sie abgemeldet. Eine SMS an sie blieb unbeantwortet. Die E-Mails ebenso. Die Nachricht kam von einer neuen Telefonnummer. Und jetzt … nein, heute auf keinen Fall. Ratlos steckte er das Gerät in die Tasche. Thilda kam zurück und hob eines der Gläser. „Zum Wohl. Ich bin heut’ unglaublich gut drauf.“ Das Eis war noch nicht alle, da hatten beide ihre Gläser leer. Daniel winkte der Bedienung. „Bringen Sie uns doch eine ganze Flasche von dem Zeug.“ „Allzulange will ich nicht bleiben, Daniel, ich bin nämlich hungrig.“ „Hier soll man ganz gut essen können“, griff er nach der Karte, „vor allem, wenn du es italienisch magst.“ „Ob die Minestrone schmeckt?“ „Bestimmt. Aber du kannst gern etwas Handfestes essen.“ „Dann nehme ich danach einen Nudelauflauf und drücke einen italienischen Salat drauf. Was isst du denn?“ „Eine Pizza Mista.“ Bloß nicht an den Kontostand denken. Die Lohnpfändung konnte er gerade noch abwenden. Egal. Das musste heute sein. Die Kellnerin zündete die Kerze auf dem Tisch an und warf einen Blick auf die leeren Gläser. Daniel orderte eine weitere Flasche Wein. „Entschuldige mich für einen Moment.“ Sein Mobiltelefon hatte in der Tasche gewummert. Auf der Toilette wischte er über den Bildschirm: „Hol’ mich hier raus. FKK macht allein keinen Spaß. Ich will angefasst werden. Hoffentlich hast du Rotkäppchen im Kühlschrank. Wann bist du da? JR.“ Ausgerechnet jetzt. Daniel schwitzte. Er würde Julia später antworten. Thilda begrüßte ihn mit einem breiten Lächeln. „Weißt du, die Arbeit im Personalbüro wird gut bezahlt. Aber es ist halt langweilig.“ Und sie redete von der ungeordneten Ablage der letzten Monate, mit der sie nun schon eine ganze Woche beschäftigt war. Und sie sprach von ihrem Chef und der Kollegin in allen Einzelheiten – bis sie staunte, dass die Flasche schon wieder leer war. „Bringen Sie uns bitte noch eine Flasche“, orderte Daniel bei der Serviererin. „Und ich hätte gern die Karte mit dem Nachtisch“, flötete Thilda. Daniel überschlug die Zeche. Bestimmt hundert Euro. Aber das sollte sie ihm wert sein. Den Alkohol spürten beide. Ihr ganzes Leben breitete sie jetzt vor ihm aus. Was das auch immer bei einer Zwanzigjährigen bedeutete. Sie hatte einen Freund. Bis vor zwei Monaten. Die Beziehung endete im Desaster. Dann lieber Single bleiben. Während sie so plapperte, machte Daniel sich seine Gedanken. Bestimmt ahnte sie nicht, dass er doppelt so alt war. Gerade sprach sie offen über ein kurzfristiges Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Und dass es im Bett eher mäßig war mit ihm. Doch es hätte sich richtig angefühlt. Ihre Zunge war schwerer geworden in den zwei Stunden. Berauscht vom Wein wie von den eigenen Worten hatte sie seine Hand gestreichelt. Unter dem schmalen Tisch berührten sich ihre Knie. Wie gut, dass sie nichts von seiner sofortigen Erektion bemerkte. Er bezweifelte, dass bei ihr die Hormone ähnlich oszillierten. Andererseits: Der erneute Toilettengang dauerte schon fünf Minuten. Er blickte auf den Bildschirm seines Smartphones. Keine neue Nachricht von JR. Gut so. Vielleicht kaufte Thilda ja Kondome im Automaten? Daniel musste aufpassen, dass die Fantasie nicht durchging mit ihm. Ob sie vielleicht den Slip …? Nein. Ihre Unterwäsche würde sie anbehalten. Vorläufig. Sie war einfach, aber offensichtlich wohlerzogen. Vielleicht zog sie den Lidschatten nach oder so etwas. An der Ausgabe unterhielt sich die Kellnerin mit einer Kollegin. Ob die beiden über ihn sprachen? Sie waren vielleicht zehn Meter von ihm entfernt; zu verstehen war kein Wort. Wie auch immer: Die Frau war wohl professionell genug, ein Rendezvous von einem Blind-Date zu unterscheiden. Endlich, das Geräusch der Flurtür. Zielbewusst steuerte Thilda auf ihren Tisch in der Ecke zu. Zwei Augen wie Sterne. Sie legte ihr Smartphone auf den Tisch. Sittsam Platz nehmen. Über den Stoff des Kleides streichen. Den Stuhl heranziehen. Nach dem Glas greifen. Ein elektrischer Schlag. Erneut spürte er ihre Beine unter dem Tisch. Suchte sie den Kontakt? Er prostete ihr zu. Locker pendelte die linke Hand neben dem Stuhl. Wie zufällig berührten seine Fingerkuppen eines ihrer nackten Knie. Sie lächelte. Sanft streichelte er die winzigen Härchen auf ihrem Oberschenkel. Auf dem Tisch schob sich ihre Hand auf seine Rechte. „Wir sollten uns langsam davonmachen“, Daniel sprach leise. „Du sagtest, dass Du ganz in der Nähe wohnst, Daniel?“ Thilda schnurrte wie ein Kätzchen. Die Kellnerin sollte abkassieren. Danach konnten sie in sein Mini-Appartement wechseln. Irgendeine Ausrede musste er finden, warum dort so ein Chaos herrschte. Es würde trotzdem eine schöne Nacht werden. Im CD-Spieler lag noch das Album von Loredana. Er brauchte nur einzuschalten. Sie würden sich umarmen. Anfassen. Ausziehen. „Boah Thilda. Das is ja ’n Ding.“ Wo kam der denn her? Anfang zwanzig, Strubbelpony, lila T-Shirt, Knielange Jeans, graue Sneakers. Ruckartig zog Daniel seine linke Hand zurück. Thilda sprang auf. „Äh, lustig. Darf ich vorstellen: Mein Kollege Daniel. Ich arbeite seit acht Tagen in der gleichen Firma wie er. Und das ist mein alter Freund Tyll, ha, Tyll wie Thilda. Ich hab Dich zwei Monate nicht gesehen, Tyll. Komm setz Dich zu uns. Daniel gibt einen aus.“ Küsschen links, Küsschen rechts. Tyll zog einen Stuhl heran. Sofort brachte die Bedienung ein weiteres Glas. Warum goss sie denn jetzt überall nach? Ruck zuck war die Flasche leer. „Wollen die Herrschaften noch einmal den Vino Rosso?“ Das wurde ein teurer Abend. Tyll war Künstler, genauer Aktionskünstler. Und erzählte und erzählte und erzählte. Daniel sollte langsam etwas unternehmen. Sonst lief alles aus dem Ruder. Er musste nachdenken. Auf dem Weg zur Toilette nickte er der Serviererin zu. „Wir wollen dann zahlen.“ Sie würden möglichst schnell das Feld räumen. Vor der Tür konnten sie sich dann von Tyll trennen. Nur so war die Beute vor dem Feind zu schützen. Im Flur spürte er das Vibrieren des Telefons in seiner Hosentasche. Er zog das Smartphone heraus. „Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr, du Idiot. Ich habe hier einen netten jungen Mann kennengelernt. Leb wohl. JR.“ Er dachte an seine Mutter, die immer sagte: Wer weiß, wozu es gut ist. Auf dem Rückweg blickte er zu dem Tisch in der Ecke. Dort standen drei schmutzige Gläser. Die Kellnerin sprach ihn an: „Hier, die Rechnung. Hundertzweiundfünfzig Euro, der Herr. Die jungen Leute sind bereits gegangen.“ Die niedergebrannte Kerze erlosch.
Tamara Krappmann
#lilylenz
Ein Gespräch quält sich voran, erträglich einzig durch die vollen Sektgläser. Nicht der Alkohol hilft weiter, sondern die Tatsache, dass sich die Anwesenden hinter den Gläsern verstecken können, indem sie immer wieder kleine Schlucke nehmen, kaum, dass ihre Lippen feucht werden. Aber wer trinkt, kann nicht reden, oder? Gregor schaut mit Bedauern um sich. Wie erwartet sitzt er nun neben seinen Eltern und hat ihnen nichts zu sagen. Mit seinem Vater wechselt er vorhersehbare Worte. Was man eben fragt, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat. Ihr Gespräch klingt, als seien sie flüchtige Bekannte, vielleicht ehemalige Arbeitskollegen: einander durchaus zugetan, aber nicht einmal eng befreundet. Seine Mutter trägt zur Unterhaltung wie üblich nur abwesendes Schweigen bei. Während sich Gregor mit seinem Vater über das Wetter austauscht, das erstaunliche, außergewöhnliche Wetter, betrachtet er zugleich seine am Tisch versammelte Familie. Sie ist klein: besonders dann, wenn er sie mit der des Bräutigams vergleicht. Bens Familie benötigt drei volle Tische und sie sitzen dicht gedrängt. Alle Altersstufen gehen durcheinander, Greise und Babys und Kinder, dazu unheimlich viele Erwachsene, die einander alle sehr ähnlich sehen und sehr laut und lustig miteinander reden. Oft wird gelacht, die Kinder kreischen, alles wirkt überaus lebendig. Hingegen passt selbst Katharinas weitere Familie leicht an einen Tisch. An anderen sitzen Freundinnen und Freunde, und sie hat sicherlich genauso viele Menschen eingeladen wie ihr Mann. Aber die Menschen, die ihr verwandt sind, lassen sich ohne Mühe in eine Ecke pferchen. Da ist natürlich Katharinas Mutter Lena, die Königin der Tafel, wie es ihre Art ist, überaus präsent, mit selbstbewusst zurückgenommenen Schultern. Neben ihr sitzen ausgerechnet Oskar und Charlotte, Oskars zweite Frau. Die drei unterhalten sich prächtig. Der Anblick ist bemerkenswert, denn Lena und Oskar haben sich einen hübschen Rosenkrieg geliefert. Nun ist das lange vergessen, und sie begegnen sich in einer Art von Kumpelei. Wobei Lena mehr Neigung zu Charlotte zu empfinden scheint als zu ihrem früheren Mann. Die Frauen stecken also hinter ihren Sektflöten die Köpfe zusammen und kichern, mit hochroten Wangen. Oskar lacht meistens mit ihnen, manchmal ein wenig verzweifelt. Neben Charlotte sitzen Holger und Lars, ihre Söhne, Katharinas Halbgeschwister. Sie betrachten die Festgesellschaft mit Unsicherheit und Langeweile, was ihrem Alter geschuldet sein dürfte, denn beide sind noch Teenager. Lars versucht immer wieder, sein Smartphone aus der Tasche zu ziehen und wird jedes Mal von Charlotte scharf zurechtgewiesen. Dann schielt er vorwurfsvoll zu Gregors Mutter. Aber wie alle anderen wagt auch er es nicht, ein Wort an sie zu richten. Gregor und seine Eltern vervollständigen diese Runde. Großeltern gibt es lange nicht mehr, auch keine weiteren Geschwister. Nur Magdalena und Johanna. Zwischen den Geburten der Schwestern liegt ein Abstand von neun Jahren. Das lässt sich auf den ersten Blick erkennen. Aber niemand, der sie zusammen sieht, würde jemals vermuten, dass Lena die Ältere ist. Lena mit ihren buntgefärbten Haaren und den kurzen Röcken könnte beinahe jedes Alter haben. Johanna Lenz nicht. Ihr gelbstichig ergrautes Haar hat sie lieblos zurückgebunden. Ihr Gesicht ist von tiefen Furchen durchzogen, ihre Hände sind mager und knotig. Gregor erinnert sich nur noch mit Mühe an die muntere Mutter seiner Kindheit und vergleicht sie mit dieser Frau, ohne auch nur entfernte Ähnlichkeit zu finden. Da sitzt ein vollkommen anderer Mensch. Johanna hält ihr Smartphone vor sich, in ihrem mageren Schoß, und blickt alle paar Sekunden aufs Display, als erwarte sie eine dringende Nachricht. Das entspricht den Tatsachen: Sie erwartet eine wichtige Nachricht. Seit eineinhalb Jahrzehnten wartet sie darauf. Um sich das Seufzen zu verkneifen, nimmt Gregor rasch einen Schluck Sekt, verschluckt sich und muss husten. Doch seine Augen ruhen auf Johannas Händen. Lilys Verschwinden hat seine Mutter medienaffin werden lassen. Er erinnert sich der ersten Wochen jenes besonders heißen Sommers, in dem sie Flugblätter kopiert und Anzeigen geschaltet haben. Damals hat er noch mitgeholfen, überzeugt davon, seine Schwester käme bald zurück. Das ist nun lange vorbei. Doch während er das Suchen aufgegeben hat, hat Johanna ihre Mittel verfeinert, und wenn er sich nun bei Twitter einloggte und suchen würde mit dem Hashtag #lilylenz, dann fände er dort die Chronologie des gegenwärtigen Tages. Denn ohne Zweifel schreibt Johanna auch jetzt pausenlos an Lily. Ihre Daumen huschen über das Display, während er ihr zusieht. Heute heiratet das Mäuschen, wird da stehen. Erinnerst du dich, wie ihr zwei als Kinder Braut und Bräutigam gespielt habt? Gregor selbst erinnert sich gut daran, sieht seine Schwester mit einem Mosquitonetz auf ihrem runden Kopf, ihr prächtiger Schleier mit langer Schleppe, und einem welken Gänseblümchenstrauß zwischen den Fingern. Wie alt war sie da, sechs oder sieben? Und er hört noch ihre Worte dazu, mit quietschender Kinderstimme gerufen: „Das sieht so unheimlich blöd aus! Greg, du spielst jetzt das Mädchen.“ Woraufhin er ihr einen Vogel zeigte. Deutlich erinnert er sich an ihr ruppiges Lachen. Sicher gibt es von dem Spiel ein Foto, und wenn er sich nicht völlig täuscht, dann hat es seine Mutter noch daheim gescannt und dann bei Instagram gepostet. Würde er ihr Facebookprofil öffnen, dann würde die kleine Mosquitobraut Lily ihm keck von der Seite entgegengrinsen. Johannas Hintergrundbild bei Facebook ist auch ein Foto von Lily, klatschnass und mit einem kleinen Pokal, einer Trophäe vom Schwimmen. Zweihundert Meter Lagenschwimmen war das. Lily lächelt, stolz und zahnlückig. Mittlerweile ist wahrscheinlich ihre gesamte Kindheit öffentlich. Und wer auf Twitter unter #lilylenz nachliest, findet auch den exakten Ablauf des Lebens und der Suche ihrer Mutter. Suchen und leben ist für Johanna längst dasselbe geworden, und ihr Sohn weiß, dass sie ihm übelnimmt, dass er beschlossen hat, es selbst anders zu halten. Johanna starrt auf ihr Smartphone, sooft es ihr nur möglich ist, und erwartet in jedem Moment die eine, entscheidende Nachricht: im Idealfall direkt von Lily. Lily hat dann durch Zufall all jene Botschaften entdeckt, die ihre Mutter voller Hoffnung sendet, und gibt ihr darauf Antwort. Oder sie hat sie längst beobachtet und fasst sich nun endlich ein Herz. Möglicherweise kommt die Nachricht aber auch von einem Fremden. Von irgendeinem Menschen, der Lily kennt oder gesehen hat, einer hilfreichen Person, die Johanna endlich den Hinweis gibt, den sie braucht, um ihre Tochter zu finden. Manchmal meldet sich wirklich jemand. Aber noch nie war etwas Hilfreiches darunter, nie eine wirkliche Spur. Mitunter äußert jemand Mitleid oder schreibt etwas Freundliches. Noch häufiger kommen Beschimpfungen vor, eigentlich ohne Anlass. Johanna nimmt sie als Bestätigung. Es wäre einfacher, findet ihr Sohn, wenn sie wenigstens über Lily reden könnten. Aber es gibt kein Gespräch über seine Schwester und keines jenseits davon. Denn Johanna redet nicht gerne mit Ungläubigen. Der rechte Glaube ist für sie der an das Weiterleben ihrer Tochter. Gespräche über Lily im Präteritum sind ein Tabu für sie. Sie brennt in einem Eifer, in dem sie niemand mehr erreichen kann. Eigentlich, wenn Gregor ehrlich ist, lautet das Wort auch nicht mehr Eifer, sondern Fanatis- mus. Wenn er nun in die Runde blickt, dann sieht er manchmal kurze Schatten auf den Gesichtern der Verwandten. Lena schaut befremdet herüber, mit Tadel für ihre jüngere Schwester. Lena ist zweifellos der Überzeugung, dass es an diesem Tag um ihre Tochter gehen sollte, um Katharina statt um Lily, wenigstens dieses eine Mal. Aber Lena weiß auch, dass sie chancenlos ist und nichts und niemand zu Johanna durchdringt. Sie erinnert sich an hässliche Szenen, nimmt daher alles schweigend hin. Charlotte und Oskar, die Bescheid wissen, sich aber weniger betroffen fühlen, schauen über Johanna hinweg, als ob sie gar nicht dort säße. Holger und Lars mustern sie verlegen, mit einer Spur Neid wegen des Smartphones. Wahrscheinlich hat ihnen niemand verraten, warum für diese alte, nachlässige Frau die Regeln des Benehmens außer Kraft gesetzt sind. Gregors Vater wirkt manchmal beschämt, zeigt aber vor allem Gleichmut. Gregor weiß von ihm längst nicht mehr zu sagen, wie er zu dem Verhalten seiner Frau steht. Teilt er noch ihre wilde Hoffnung, oder verhält er sich schlicht loyal? Treibt ihn die Angst, auch sie zu verlieren? Es ist unmöglich zu sagen. Auch Dieter Lenz ist vor der Zeit gealtert, wirkt schmal und unbeholfen und redet übers Wetter. Da sitzt ein Mann, der das Vertrauen in sein eigenes Urteil lange verloren hat. „Hast du für Schnee gepackt? Wir nicht. Ich dachte: Regen. Aber Schnee?“ Nein, für Schnee hatte Gregor nicht gepackt. Gregors Vater plappert nur noch. Da sie nichts zu bereden haben, müssen sie zwangsläufig plappern. Manchmal fragt Gregor sich, wie es zuhause ist, ob und wie seine Eltern miteinander sprechen. Er hofft, dass sie noch miteinander sprechen. Einmal am Tag, meistens am Abend, twittert seine Mutter die immer gleichen Worte: Bitte komm heim. Ich liebe dich. #lilylenz. Ihr Sohn hofft inständig, dass sie ähnliche Worte manchmal auch laut sagt, zu seinem Vater. Zu ihrem Mann. Aber er glaubt nicht mehr, dass das wirklich der Fall sein könnte. Er nimmt einen langen Schluck Sekt, wodurch sein Glas leider leer wird, betrachtet neidisch Oskar und Charlotte, die durch den jeweils anderen wenigstens jemanden zum Reden bei sich haben, und dann noch neidischer die anderen Tische, wo sich die Sippschaft des Bräutigams knäult, lebhaft und lustig und laut. Er ist selbst kein lauter Typ. Nun jedoch wünscht er sich dorthin, unter diese fröhlichen Leute. Jedenfalls kommt ihm alles besser vor, als noch den ganzen Nachmittag und Abend auf seinem Platz zu bleiben. Dann, endlich, drehen sich Köpfe um, Stuhlbeine schaben über den Boden und die ersten Gäste erheben sich und applaudieren freundlich. Das Brautpaar ist hereingekommen, rotwangig von der Kälte und erschöpft vom vielen Lachen für den Hochzeitsfotografen, aber zugleich sichtlich vergnügt. Gregor erhebt sich ebenfalls und applaudiert mit den anderen Gästen. Seine Begeisterung gilt dem Umstand, dass nun ein neuer Programmteil beginnt, dass es nun gleich ein paar Reden gibt und anschließend Kaffee und Kuchen, wodurch alles etwas einfacher wird. Denn wer den Mund voll Kuchen hat, der muss auch keine Tischgespräche führen.
Frank Schuster
Das Artefakt
Kaum hatte Herbert George das erste Mal in seinem Leben amerikanischen Boden betreten, bekam er auch schon Ärger mit der Polizei. „Mister Wells?“ Er schaute von seinen Papieren auf, die er dem Beamten an der Passkontrolle vorgelegt hatte, und bemerkte, dass ihn still und heimlich zwei Polizisten in die Zange genommen hatten. Er blickte den rechten von den beiden an, von dem er die Stimme vernommen zu haben glaubte. Herbert George spürte Hitze in seine Wangen schießen. Er nickte nervös. Er fühlte sich ertappt, wusste aber nicht, wobei. Mit seinen Papieren war alles in Ordnung, da war er sich sicher. „Mitkommen!“, befahl der andere, der linke Polizist. Während er zwischen den beiden Beamten durch die Menschenmenge im New Yorker Hafen mitschritt, sang er sich zur Beruhigung innerlich The Star-Spangled Banner vor. Das Lied war ihm schon ein unerträglicher Ohrwurm während der Überfahrt gewesen. „… the land of the free.” Von wegen! Es fehlte noch, dass sie ihm Handschellen anlegten und ihn in eine Zelle warfen. Was wollten sie von ihm? War es sein Engagement für die Fabian Society? Mit sozialistischen Ideen war in den Vereinigten Staaten nicht zu spaßen. Seit dem Attentat auf Präsident William McKinley Jr. waren die Amerikaner in Panik versetzt und fürchteten allenthalben Anschläge von Anarchisten und anderen Gruppierungen. Hinter Herbert George lag eine siebentägige Überfahrt mit der RMS Carmania von Liverpool. Die ganze Zeit auf dem Meer hatte er sich unwohl gefühlt. Ozeanriesen waren zwar eine segensreiche Erfindung, sie brachten die Welt zusammen, doch zwischen der alten und der neuen lag tiefes, kaltes Wasser. Die beiden Beamten und er erreichten ein schmuckloses Gebäude. Sie führten ihn in einen kargen Raum. „Setzen!“, sagte einer von beiden und wies still auf einen leeren Stuhl. Mehr als drei Silben bekamen die beiden Uniformierten wirklich nicht heraus. Herbert George nahm vor einem Schreibtisch Platz, ihm gegenüber zwei leere Stühle. Während er noch dabei war, sich auszumalen, wer gleich darauf Platz nehmen könnte, öffnete sich bereits eine Tür und zwei Männer in Zivil traten ein. „Ah, Mister Wells!“, rief der offensichtlich jüngere aus, der einen Aktenkoffer in der Hand trug. „Wir sind hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich kann wohl für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir Ihre Bücher sehr schätzen.“ Er wies auf seinen Begleiter, der zustimmend nickte. Er kam Herbert George bekannt vor. Er trug einen gestutzten Vollbart. Sein lockiges, widerspenstiges, schlohweißes Haar hatte er durch strenges Nach-hinten-Kämmen gezähmt. Der hohe Haaransatz sorgte dafür, dass seine markante Stirn zur Geltung kam. Über seinen dunklen Augen hingen weiße, buschige Brauen. Er hatte den Mann schon einmal gesehen, aber wo? „Gestatten Sie, mein Name ist Anthony Pinker“, riss ihn der jüngere Mann aus seinen Überlegungen. „Ich bin General beim NBCI.“ Als er Herbert Georges fragendes Gesicht sah, ergänzte er: „National Bureau of Criminal Identification.“ Er grinste kurz und fuhr fort: „Und von dem Herrn neben mir haben Sie sicherlich schon gehört.“ „Alexander Graham Bell“, stellte dieser sich mit einem freundlichen Lächeln vor und reichte seinem Gegenüber die Hand. Herbert George war verblüfft. Worauf lief das Ganze hinaus? Warum saß er einem Geheimdienstler und dem Mitbegründer der American Telephone & Telegraph Company gegenüber? Im allgemeinen Bewusstsein war Bell bekannt als der erste Mensch, der ein Patent auf das Telefon angemeldet hatte. Das Foto mit ihm, wie er vor gut anderthalb Jahrzenten den ersten Anruf von New York nach Chicago getätigt hatte, war um die ganze Welt gegangen. Viele Menschen verkürzten das fälschlich darauf, dass er der „Erfinder des Telefons“ sei. So war es sogar schon in einigen Geschichtsbüchern zu lesen. Dabei war Bell bloß ein gewiefter Geschäftsmann. Es war ihm gelungen, aufbauend auf Ideen, die er von anderen Erfindern gestohlen hatte, das Telefon zur Marktreife zu entwickeln. Zugleich baute er ein flächendeckendes Telefonnetz in Nordamerika aus, das seine Firma monopolartig beherrschte. Herbert George erwischte sich dabei, wie er in Gedanken Stoff für seinen Reise-Essay sammelte. Einen Arbeitstitel hatte er schon: The Future in America. „Tee?“, fragte Pinker. Herbert George nickte. Pinker befüllte drei Tassen mit dem heiß dampfenden Getränk. Das Gedeck hatte bislang von Herbert George unbemerkt auf dem Schreibtisch gestanden. „Fast so gut wie bei Ihnen zuhause in good ole England“, sagte Pinker beim Eingießen und schmunzelte. Er gab den beiden Polizisten, von denen bislang jeder in jeweils einer anderen Zimmerecke strammgestanden hatte, ein Zeichen. Sie verließen den Raum. „Mister Wells“, richtete sich Pinker an Herbert George. „Sie sind sicher sehr überrascht darüber, was Ihnen seit Ihrer Ankunft in New York widerfahren ist, und ich muss mich dafür im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika zutiefst bei Ihnen entschuldigen. Wir hätten Sie gerne schon in England erreicht. Von dort erhielten wir jedoch die Nachricht, dass Sie mit der RMS Carmania Richtung New York abgereist seien. Eine wahrhaft glückliche Fügung für uns: Sie kamen uns gewissermaßen entgegen.“ Pinker lachte kurz, nahm einen Schluck von seinem Tee und fuhr fort: „Zu allererst habe ich eine Bitte an Sie: Wenn Sie uns versichern, über ein Vorkommnis äußerstes Stillschweigen zu üben, werden Sie in den nächsten Minuten verstehen, warum wir gerade Sie ausgewählt haben. Wenn Sie es nicht tun, entschuldigen wir uns hiermit für die Unannehmlichkeiten und Sie können Ihre Reise ungestört fortsetzen.“ Herbert George war verwirrt. Pinkers Bitte klang dezent nach Erpressung. Als Schriftsteller war er naturgemäß neugierig. Wie sollte er jetzt noch aussteigen, wenn ihm das verlockende Angebot auf eine Story gemacht wurde? Zugleich aber brauchte er als Geschichtenerzähler ein Publikum. Wie konnte man von ihm verlangen, ein Ereignis, von dem er ahnte, dass es außergewöhnlich sein musste, geheim zu halten? Herbert George überlegte kurz, dann hörte er sich sagen: „Ich versichere Ihnen, still zu schweigen.“ „Bis an Ihr Lebensende?“, hakte Pinker nach. Herbert George spürte, wie es in seinem Inneren kribbelte. Zugleich fühlte er seinen Hunger nach Sensation aufsteigen. Er wollte und konnte jetzt nicht mehr umkehren. Er nickte. Heimlich dachte er dabei: Wir werden schon sehen, wie lange ich die Sache überhaupt für wert befinde, geheim zu halten. Vor allem, wenn ich dieses Land wieder verlassen habe. „Gut. Das freut uns“, sagte Pinker. „Dann möchte ich Sie bitten, diese Geheimhaltungserklärung zu unterschreiben.“ Er schob ihm einen Bogen Papier zu. Während Herbert George kurz über die Zeilen flog, schielte er herüber zu Bell, der einen erleichterten Gesichtsausdruck machte. „Ich hatte gehofft, dass Sie mitmachen“, sagte Bell, während Herbert George unterschrieb. Er sprach noch immer mit einem deutlichen schottischen Akzent, obwohl er bereits vor mehr als drei Jahrzehnten Großbritannien verlassen haben musste, wie Wells im Kopf nachrechnete. Angeblich soll Bell seine Patentschrift für das Telefon nur zwei Stunden vor dem Lehrer und Erfinder Elisha Gray eingereicht haben. Der Unterschied zwischen beiden Papieren war, dass Gray darin seine Erfindung bis in das kleinste Detail beschrieb. Bells Patent hingegen blieb sehr vage. Er verwendete später bei der praktischen Umsetzung einen regelbaren Widerstand in Form eines Drahts, der in eine Schwefellösung getaucht war. Ein solcher war in seiner – im Gegensatz zu Grays – Patentschrift gar nicht aufgeführt. Die Folge war ein langwieriger Patentstreit. Es gab Stimmen, die bezichtigten Bell sogar einer illegalen Verbindung zum Patentamt. Unter dem Schreibtisch zog Pinker den Aktenkoffer hervor. Er hob ihn hoch und legte ihn auf die Tischplatte. Von seinem linken Handgelenk baumelte eine Kette, über die er mit dem Koffer verbunden blieb. Bell zog sich unterdessen ein Paar weißer Stoffhandschuhe über, wie sie Auktionatoren zu tragen pflegen, wenn sie wertvolle Kunstgegenstände berühren. Er ließ sich von Pinker mit einem feierlichen Kopfnicken einen Schlüssel überreichen und schloss damit den Koffer auf. Der aufschnappende Kofferdeckel versperrte Herbert George die Sicht. Bells Hand verschwand dahinter und kam mit einem schwarzen Gegenstand wieder zum Vorschein, den er vorsichtig auf die Tischplatte legte. Pinker legte den Koffer derweil wieder zurück auf seinen Schoß. Der etwa handtellergroße Gegenstand war flach wie ein Brett. Er hatte die Form eines langgezogenen Rechtecks mit abgerundeten Ecken. Er besaß eine glänzende Oberfläche aus Glas, die von einem schwarzen Rahmen eingefasst war, er glich einem Taschenspiegel. In dem Glas spiegelten sich das Licht und die Umrisse des Raums. Falls der Gegenstand tatsächlich als Taschenspiegel dienen sollte, war das Bild, das er zurückwarf, viel zu undeutlich. Silber eignete sich definitiv besser als Beschichtung für einen Spiegel. „Sie können das Ding ruhig berühren“, sagte Pinker an Herbert George gerichtet, nicht ohne auch ihm zuvor ein Paar weiß Handschuhe in die Finger zu drücken. Herbert George zog sich den weichen Stoff über. Er griff nach dem Gegenstand und hob ihn näher in Richtung seiner Augen. Er drehte und wendete ihn und entdeckte dabei mehr und mehr Details, die er in dem Schwarz-auf-Schwarz vorher gar nicht wahrgenommen hatte. An mehreren Stellen, vor allem an den Seitenrändern, befanden sich unterschiedliche Ausstülpungen und Löcher. Das auffälligste Detail aber fand sich auf der Rückseite: eine Vertiefung in Form eines langgezogenen Ovals, in dessen einer Seite ein kreisrundes Stück Glas eingesetzt war, das einer Linse glich. „Wir stehen vor einem ebensolchen Rätsel wie Sie.“ Bells Worte zerrissen das seit Minuten anhaltende Schweigen. Er schmunzelte, offensichtlich erheitert von Herbert Georges nachdenklichem Gesichtsausdruck. „Drücken Sie einmal das Knöpfchen dort und schauen Sie dabei auf die Scheibe.“ Bell zeigte auf eine der Ausstülpungen. Herbert George tat, um was er ihn bat. Er bekam einen Schrecken: Wie aus dem Nichts erschien auf der schwarzen Fläche hinter der Scheibe etwas in weißer Farbe. Ein Symbol. Er hatte Probleme zu erkennen, was es darstellte. Er dachte zunächst an eine brennende Kerze. Dann aber erkannte er, dass es sich um einen Apfel handelte, der an der rechten Seite angebissen war. Das Erste, was Herbert George dazu einfiel, war die biblische Geschichte vom Baum der Erkenntnis, von dessen Frucht der Mensch niemals hätte naschen sollen. Er spürte erneut eine Hitzewallung in seinem Körper aufsteigen. Auf was hatte er sich da bloß eingelassen! „Zugegebenermaßen etwas gespenstisch“, sagte Bell, der bemerkte, wie Herbert Georges Hand anfing zu zittern. Er dachte sicher, es wäre wegen des technischen Illuminationseffekt. Dabei war es das gar nicht. Herbert George kannte solchen Budenzauber aus dem Kino. Es war vielmehr die Erkenntnis, die plötzlich und instinktiv durch seinen Körper schoss, dass er eine technische Entwicklung in den Händen hielt, die nicht aus dieser Zeit oder Welt stammte. Der Film, den das Gerät hinter der Scheibe abspielte, wechselte über in eine nächste Szene. Auf dem Bildschirm war nun ein großes Quadrat zu sehen, das von neun kleinen Kreisen gebildet wurde, die mit den Zahlen von eins bis neun beschriftet waren. Ein weiterer Kreis befand sich außerhalb und trug die Zahl Null. Am oberen Rand des Bildschirms stand wie auf einer Zwischentiteltafel in einem Stummfilm: „Code eingeben. Nach dem Neustart benötigt iPhone deinen Code.“ Als Bell, der sich die ganze Zeit damit zurückgehalten zu haben schien, Herbert Georges zunehmend ratloseren Gesichtsausdruck sah, begann er schallend zu lachen. Es klang in Herbert Georges Ohren wie Gebell. Auf Englisch mochte der Name Bell passend sein für jemanden, der der Menschheit das Telefon mitsamt seinem nervtötenden Geklingel beschert hatte. Auf Deutsch jedoch klang „Bell“ wie ein Befehl für das, was Hunde gerne tun. „iPhone.“ Dieses Wort stach Herbert George ins Auge. Und plötzlich wurde ihm klar, warum er Alexander Graham Bell gegenübersaß. Das Gerät hatte nichts mit Kinematographie zu tun. Es musste sich um eine Art Telefon handeln. Bell, diesem perfiden Kapitalisten, war es zuzutrauen, eine neue Erfindung „iPhone“ zu taufen. Das in seiner Muttersprache großgeschriebene erste Personalpronomen schrumpfte zu einem Strich mit Tüpfelchen, das menschliche Ich trat hinter der Ware zurück. „Mister Wells, wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen“, schaltete sich Pinker ein. „Das Gerät wurde bei Bauarbeiten in der Grand Central Station in Chicago entdeckt. Die alten Schließfächer mussten weg und neue kamen hin. Monatelang wurden Nutzer mit Schildern darauf aufmerksam gemacht, bis zum 1. März dieses Jahres ihre sämtlichen Gegenstände aus den Stahlschränken zu holen. Nach und nach wurden die nicht mehr belegten durch neue ersetzt. Am Ende blieben zwei Schließfächer übrig, die unter der Aufsicht der Polizei gewaltsam geöffnet werden mussten. In einem der Fächer fanden die Beamten nichts, es war interessanterweise völlig leer. In dem anderen fanden sie diesen Apparat hier. Sofort wurden höhere Polizeieinheiten hinzugezogen. Die Vermutung lag nahe, dass das Gerät zu Vorbereitungen auf ein Bombenattentat dienen, es zum Beispiel eine Art Zeitzünder sein könnte. Wie Sie vielleicht wissen, hatten wir in den Vereinigten Staaten zuletzt einige Probleme mit anarchistischen Elementen. Techniker demontierten und prüften es. Es gelang ihnen, auf das Gerät Strom zu geben. Schauen Sie hier, dieses längliche Loch ist eine Buchse.“ Pinker zeigte kurz auf den unteren Teil des Geräts und fuhr fort: „Nachdem die Experten es auseinandergenommen, untersucht und schließlich in Gang gebracht hatten, wurde zunehmend klar, dass es sich um ein Funk- oder Fernsprechgerät handeln muss. Nachdem definitiv ausgeschlossen war, dass das Ding irgendetwas mit Sprengstoff zu tun haben könnte, blieb die ganze Sache dennoch Angelegenheit des NBCI. Denn der Apparat könnte irgendeiner uns feindlich gesinnten Seite als Abhörgerät oder Störsender dienen. Die Frage ist nur: wem? Wer hat diesen Apparat im Schließfach des Chicagoer Bahnhofs deponiert? Und wozu wurde, wird oder soll er eingesetzt werden? Fragen über Fragen. Aber ich übergebe erst einmal das Wort wieder an Mister Bell. Er wird Ihnen weitere Details an der Apparatur erläutern. Sie müssen wissen, Mister Wells: Wir haben Mister Bell als Berater hinzugezogen und, wie Sie, zum Stillschweigen über diese Angelegenheit verpflichtet. Mister Bell, darf ich Sie bitten fortzufah- ren.“ Bell räusperte sich kurz. „Wie Sie sehen, ist nun ein Code einzugeben. Die Kryptographen des NBCI berichteten mir, dass sie nicht lange gebraucht hatten, die richtige Kombination herauszufinden. Gleich der erste Versuch klappte. Mister Wells, darf ich bitten, mir den Apparat kurz zurückzugeben. Das Gerät ist nämlich gesperrt, wenn man nach fünf Versuchen immer noch die falsche Zahlenfolge eingibt.“ Herbert George schob das Telefon hinüber zu Bell, der sich unterdessen den Handschuh von seiner rechten Hand zog. Er fragte sich, wie er es bewerkstelligen wollte, den Code einzugeben. Die Kreise mit den Zahlen lagen hinter Glas und waren bloß eine Simulation von Tasten. Doch sobald Bell drauftippte, reagierten sie mit einer Veränderung ihrer Farbe. Mit einer theatralischen Bewegung gab Bell eine Zahl nach der anderen ein: 1, 2, 3 und 4. Es war genau der Code, den Wells erwartet hatte. Bei Recherchen für eine Erzählung hatte er sich einmal mit Kombinationen für Zahlenschlösser beschäftigt. 1234 war die mit Abstand beliebteste, gefolgt von 1111. Deshalb war es äußerst ratsam, sie nicht für einen Safe zu wählen. „Wissen Sie, Mister Wells“, sagte Bell, während er den Apparat zurückgab. „Die Kryptographen hatten es doppelt einfach: 1234 ist nicht nur der geläufigste Verschlüsselungscode, das Schließfach in der Grand Central Station trug die Nummer 123. Es sieht ganz so aus, als ob sich da jemand nicht allzu viel Mühe gegeben hat.“ Herbert George blickte auf das Gerät. Hinter der Scheibe waren nun über den ganzen Bildschirm unterschiedliche Symbole verstreut. Manche waren trotz ihrer abstrakten Darstellung in ihrer Bedeutung relativ einfach zu erahnen: ein Zahnrad, eine Weltkugel, eine Uhr, ein Kalender, eine Kamera, ein Telefonhörer. Andere wiederum ergaben für Herbert George keinen Sinn: ein weißes kleines f in einem blauen Kreis, ein rotes großes N in einem schwarzen, ein weißes umgekipptes Dreieck in einem roten und drei schwarze Wellen in einem grünen Kreis. „Was passiert, wenn ich da draufdrücke?“, fragte Herbert George an Bell gerichtet und zog sich dabei den Handschuh von seiner rechten Hand. „Kommt drauf an, auf welches der Symbole. Probieren Sie eines.“ Herbert George drückte auf die Uhr, sie schien ihm am unverfänglichsten. „Weltuhr, Chicago“, war zu lesen. Daneben die Zahlen „11:30“. Wenn es halb zwölf bedeuten sollte, ging die Uhr falsch. „Man kann die Symbole übrigens auch verschieben“, sagte Bell. Er bat Herbert Georg, ihm das Gerät noch einmal zurückzugeben, und führte es ihm vor. Er zog mit der Spitze seines unbehandschuhten rechten Zeigefingers eines der Zeichen von oben nach unten. Die Technik war verblüffend. Sie erinnerte Herbert George an seine Experimente in seiner Kindheit mit Eisenspänen auf einer Scheibe, die er mithilfe eines Magneten unter dem Glas in Bewegung setzte. Bell gab ihm das Gerät zurück. „Probieren Sie ruhig noch andere aus.“ Doch bei jedem weiteren Symbol, das Herbert George anwählte, passierte wenig bis gar nichts. Es ging nicht weiter. Es stockte. Bei manchen erschien ein Zwischentitel mit den Worten: „Du benötigst eine Internetverbindung.“ „Ein Funkgerät, das keine Frequenzen findet, funktioniert nicht“, schaltete sich Pinker ein. „Unsere Leute gehen davon aus, dass es sich bei , Internet‘ um eine Art Kommunikationssystem handelt. All unsere Anstrengungen führten bislang nicht dazu, dass wir uns darin einwählen konnten.“ „Einige Anwendungen funktionieren jedoch auch ohne. Sehen Sie hier“, sagte Bell und drückte auf ein Symbol mit den vier mathematischen Zeichen für Plus, Minus, Mal und Ge- teilt. „Sagen Sie mal irgendeine Zahl“, bat er. „Eintausendzweihundertvierunddreißig“, erwiderte Herbert George. Der Code für das Gerät. „Und jetzt noch eine.“ „Hundertdreiundzwanzig.“ Die Nummer des Schließfachs. „So und jetzt sagen Sie mir: Was ergibt eintausendzweihundertvierunddreißig plus hundertdreiundzwanzig?“ Bell strahlte. Er schien kindliche Freude an diesem Spiel zu haben. Während Herbert George noch im Kopf rechnete, tippte Bell die Zahlen ein. Und schon erschien „1357“ auf der Schei- be. „Wahnsinn, welche Geschwindigkeit!“, sagte Pinker mit Begeisterung. „Unsere Leute haben noch nicht herausfinden können, wie das Gerät dies schafft. Anders sieht es mit einer weiteren Funktion aus.“ Er gab Bell ein Zeichen, der sich bereits diebisch auf das zu freuen schien, was er jetzt vorführen konnte. Er tippte auf das Kamerasymbol. Dann hob er das Gerät, schaute kurz auf die Seite mit dem Glas, die er von Herbert George abgewandt hielt, und drückte auf sie drauf. Ein Licht blitzte hell auf. Herbert George war kurzzeitig geblendet. Anschließend drehte Bell das Gerät so, dass alle Personen am Tisch bequem auf die Scheibe blicken konnten. Herbert George fuhr vor Schreck zusammen. Hinter dem Glas war eine farbige Fotografie von ihm zu sehen. Wie hatte sich diese so schnell entwickeln können? In diesem winzigen Gerät steckten gleich mehrere Apparate. Wie war es möglich, dass sie alle in dieses kleine Gehäuse passten? Sein Gehirn durchzuckte erneut der Gedanke, es mit einer technischen Entwicklung zu tun zu haben, die nicht aus dieser Zeit oder Welt stammte. Pinker gab erneut ein Zeichen. Bell legte das Gerät auf den Schreibtisch. „Mister Wells“, sagte Pinker. „Sie fragen sich sicher schon die ganze Zeit, warum wir Sie hinzugezogen haben. Was Sie als Schriftsteller zu der ganzen Sache beizutragen haben, da doch all unsere Männer, die seit Wochen auf Hochtouren ermitteln, noch keine heiße Spur haben. Unsere Experten sind allesamt kluge Menschen, das steht außer Frage. Es fehlt ihnen aber an einer besonderen Gabe. Mister Wells, kurz und gut: Der Krisenstab kam nach einer längeren Sitzung überein, dass wir dringend jemanden mit visionärer Imaginationskraft benötigen. Und dabei sind wir auf Ihren Namen gekommen.“ „Ich mag am liebsten Ihren Roman, in dem Sie sich eine Invasion von Außerirdischen vom Mars ausmalen“, plapperte Bell dazwischen. „Mister Pinker hingegen schätzt Ihr Buch mit der Zeitmaschine.“ Jetzt endlich verstand Herbert George. Und zugleich ärgerte er sich. Er hatte mit seinen 39 Jahren bereits ein umfangreiches Werk geschrieben, darunter Sachbücher, Essays und politische Schriften. Doch immer wieder wurde er auf seine utopischen Fiktionen reduziert. Pinker lächelte Herbert George an und übernahm wieder das Gespräch. „Mister Wells, wir alle in dieser Runde sind uns sicherlich einig, dass wir es hier mit einer Technologie zu tun haben, zu der die uns bekannte zivilisierte Welt derzeit nicht fähig ist. Der Apparat muss von irgendwo weit her kommen. Und mit weit her meine ich räumlich oder auch zeitlich. Was denken Sie darüber, Mister Wells?“ Herbert George schossen viele Überlegungen durch den Kopf. Es fiel ihm schwer, sie ad hoc laut zu artikulieren. Leise und stockend hörte er sich reden: „Das Gerät, seine Gestaltung und Ausrüstung, wirken auf mich zutiefst menschlich. Wenn es von Außerirdischen stammen sollte, sind sie entweder uns Menschen sehr ähnlich oder sie haben es für uns er- schaffen.“ „Sehen Sie, Mister Pinker! Ich sagte es doch, die Zeitma…“ „Ich bitte Sie, Mister Bell. Lassen Sie doch Mister Wells in seinen Ausführungen fortfahren.“ „Wenn der Apparat allerdings tatsächlich von extraterrestrischen Wesen kommen sollte“, fuhr Herbert George fort, „dann hätte ich momentan keine Erklärung dafür, warum sie ihn in einem Schließfach in einem Bahnhof auf der Erde deponiert haben. Anders hingegen sähe es mit einem Zeitreisenden aus. Da hätte ich viele Ideen.“ Herbert George pausierte kurz und fragte schließlich: „Haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht, wie ein Zeitreisender mit den Menschen aus seiner Zeit kommunizieren kann?“ Pinker und Bell schüttelten die Köpfe. „Er kann ja nicht einfach aus der Vergangenheit oder der Zukunft mit einem Telefon anrufen.“ Herbert George lachte kurz auf. Pinker stieg in sein Lachen ein. Aus den Augenwinkeln registrierte Herbert George, wie sich Bells Mundwinkel nach unten verzogen. „Nein, er kann es“, fügte Herbert George mit fester Stimme hinzu, „indem er Artefakte hinterlässt.“ Pinker und Bell schauten ihn fragend an. „Alles von Menschen Gemachte kommt dazu in Frage“, gab Herbert George zur Erklärung. „Ein Brief zum Beispiel, den er wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit irgendwo an einem geheimen Ort deponiert. Das Problem ist nur, der Brief könnte von einer Person gefunden werden, an die er nicht adressiert ist. Im harmlosen Fall könnte der Finder ihn für das Zeugnis eines Verrückten halten.“ „Und im ernsten Fall?“, fragte Pinker. „Könnte das, was auf dem Brief steht, den Gang der Geschichte beeinflussen. Nicht auszudenken, was zum Beispiel passiert wäre, wenn Marie Curies Aufzeichnungen über Radioaktivität in die Hände von Kaiser Nero gelangt wären. Ein vorsichtiger Zeitreisender sollte seine Spuren gut verwischen. In diesem Fall“ – Herbert George deutete auf das Gerät – „trifft das nur teilweise zu. Der Apparat war zwar in einem Schließfach einigermaßen sicher versteckt. Zudem sind auf ihm keine bis kaum für uns lesbare oder auswertbare Informationen hinterlassen. Der Adressat könnte möglicherweise über Einwählen in das Netz, das uns heute noch nicht zur Verfügung steht, an für ihn bestimmte Informationen gelangen. Aber der Zeitreisende machte meines Erachtens einen schwerwiegenden Fehler: Er recherchierte nicht gründlich genug in den Archiven, ob die Schließfächer in der Grand Central Station in Chicago noch mehrere Jahrzehnte überdauern.“ Pinker nickte still. „Das alles klingt schlüssig“, sagte er. „Allerdings sehe ich einen weiteren Fehler: Hätte der Zeitreisende einfach einen Brief deponiert, hätte dies bei weitem nicht für ein solches Aufsehen gesorgt. Auf Papier schreiben Menschen seit Jahrhunderten. Das Gerät hingegen stellt uns nun vor große Herausforderungen. Wir haben eine Erfindung gefunden, die es noch gar nicht gibt. Wie sollen wir damit umgehen? Wir könnten sie jetzt kopieren und damit eine Apparatur in die Welt setzen, deren Zeit noch gar nicht gekommen ist.“ „Es könnte aber auch gut möglich sein, dass das Artefakt selbst die Botschaft ist.“ Pinker und Bell blickten Herbert George fragend an, der erklärte: „Liest zum Beispiel ein Mensch des Jahres 2006 in einer Zeitung des Jahres 1906, dass in der Grand Central Station in Chicago ein schwarzes Telefon unbekannter Herkunft mit integrierter Kamera und Rechenmaschine gefunden wurde, kann er daraus schließen, dass der Zeitreisende angekommen ist.“ Pinker nickte still. „Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit“, fuhr Herbert George fort. „Es könnte etwas schiefgegangen sein. Irgendwas kam dem Zeitreisenden dazwischen, so dass er das Gerät nicht mehr aus dem Schließfach holen konnte. Oder aber er hatte es dort gar nicht für die Nachwelt deponiert, sondern für einen Mitreisenden. Je länger ich darüber nachdenke, kommt mir diese Möglichkeit fast als die wahrscheinlichste vor.“ Pinker und Bell schwiegen lange. Schließlich fragte Pinker: „Was schlagen Sie vor, Mister Wells?“ Herbert George antwortete nicht. Stattdessen schielte er kurz herüber auf Bell. Dann beugte er sich über den Schreibtisch und flüsterte Pinker etwas ins Ohr. Pinker nickte. „Mister Bell, könnten Sie uns bitte für fünf Minuten alleine lassen?“ Bell war sichtlich pikiert. Er wollte etwas entgegnen, aber es hatte ihm die Stimme verschlagen. „Bitte!“, insistierte Pinker. Bell stand widerwillig auf und verließ den Raum. Nachdem die Tür hinter ihm verschlossen war, sprudelte Herbert George mit seiner Idee los: „Mein Vorschlag wäre: Deponieren Sie das Gerät einfach wieder in Schließfach 123 der Grand Central Station in Chicago. Falls die Nummerierung dort jetzt eine andere ist und es keine 123 mehr geben sollte, sorgen Sie dafür, dass sie wieder existiert. Und auch, dass der Schlüssel des früheren Stahlschranks in den neuen passt. Notfalls bauen sie einfach den alten wieder ein. Anschließend breiten alle Beteiligten den Mantel des Schweigens über die ganze Angelegenheit.“ Herbert George stoppte kurz. „Und bitte, Mister Pinker, stellen Sie keine Wachposten an Schließfach Nummer 123 auf. Es könnte sein, dass sie hundert Jahre warten müssen.“ Er lachte kurz auf und fügte mit ernster Stimme an: „Und denken Sie daran: Gerade das Ergreifen des Zeitreisenden könnte den Gang der Geschichte erheblich verän- dern.“ Mister Pinker schwieg. Er schwieg lange. Schließlich stand er von seinem Stuhl auf und schritt auf Herbert George zu. Auch er stand auf und die beiden Männer reichten sich die Hand. „Ich danke Ihnen, Mister Wells. Ich werde Ihren Vorschlag in die Beratungen des Krisenstabs einfließen lassen.“ Er nickte und hob die Stimme: „Mister Bell!“, rief er. „Sie können wieder hereinkommen.“ Bell betrat mit sichtlich beleidigtem Gesichtsausdruck den Raum. „Mister Wells ist im Begriff zu gehen“, sagte Pinker. „Sagen Sie ihm auf Wiedersehen.“ Sie gaben sich die Hand. Herbert George blickte dabei in Bells rot angelaufenes Gesicht. Er hörte, wie er beim Händeschütteln leise schnaubte.
Zwei Monate später erreichte Herbert George ein Einschreiben in seinem Haus in Sandgate. Er war frisch von seiner Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt und brütete über seinem Essay. Der Absender auf dem Umschlag war ihm unbekannt. Als er ihn aufriss, bemerkte er, dass der Name fingiert war. Der Brief kam vom NBCI. Unterzeichnet hatte ihn Anthony Pin- ker.
„Sehr geehrter Mister H. G. Wells,
bitte behandeln Sie die Informationen, die Sie mit diesem Schreiben erhalten, streng vertraulich. Sobald Sie diesen Brief gelesen haben, verbrennen Sie ihn. Ihr Vorschlag, den Sie meiner Person am 3. April 1906 im Hafen von New York unterbreitet hatten, traf im engeren Kreis des Krisenstabs auf große Zustimmung. Es wurden unmittelbar Schritte dazu eingeleitet, ihren Anweisungen zu folgen. Allerdings ist uns ein Fehler unterlaufen. Eine Sicherheitslücke trat auf. Das Gerät sollte gleich nach dem Gespräch zwischen mir, Ihnen und Mister Bell wieder zurück in den Tresor, in dem es sich bis zu Ihrer Ankunft in New York befunden hatte. An dieser geheimen Stelle wähnten wir es auch an jenem Tage, der für die Überführung an den von Ihnen vorgeschlagenen Ort ausgewählt war. Der NBCI fand den Tresor nach Öffnung jedoch leer vor. Ermittlungen ergaben, dass sich einer der beiden Polizisten, die Sie am Tage Ihrer Ankunft am New Yorker Hafen in Empfang genommen hatten, mit einer beträchtlichen Summe Geldes dazu hatte bestechen lassen, das Gerät zu entwenden und seinem Auftraggeber zuzuführen. Nach intensiver Fahndung wurde der Polizist in Kalifornien aufgegriffen. Als seinen Auftraggeber benannte er den schwedischen Erfinder und Telefonfirmengründer Lars Magnus Ericsson. Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Auftraggeber vielmehr dessen schärfster Konkurrent, Alexander Graham Bell, war. Was der bestochene Polizist allerdings an der Westküste wollte, konnte auch Bell nicht erklären. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Delinquent das Artefakt zum Zeitpunkt seiner Ergreifung nicht mehr bei sich trug. Er sagte, er habe es auf seiner Flucht im Santa Clara Valley, südlich von San Francisco, verloren. Alle Versuche, es zu finden, waren bisher erfolglos.
Hochachtungsvoll, Anthony Pinker (NBCI)
Herbert George zerknüllte das Briefpapier zu einer Kugel und warf es in das Kaminfeuer. Während es hell aufloderte und danach langsam zu Asche zerfiel, wünschte er sich viel, sehr viel Regen im Santa Clara Valley. Er hoffte, dass die abrutschenden Erdmassen das Artefakt tief unter sich begraben und frühestens in hundert Jahren wieder zurück ans Licht bringen würden.
Das neue Jahr
Ich starre von innen auf die Hotelzimmertür. Außen trägt sie die Nummer 101. Seit Jahren schon gebe ich sie zum Spaß beim Einchecken als Wunsch an der Rezeption an. Ein kleiner Scherz, den ich mir erlaube. Sonia fand ihn immer ziemlich makaber. In einem meiner Romane geschieht in einem Raum 101 Grausames. Unten im Saal warten sie bereits auf mich. Sie wollen feiern. Gleich werden sie jemanden hochschicken, mich abzuholen. Die Zeiger rücken vor. Sie zeigen fünf Minuten vor. Wie erbärmlich symbolhaft. Bald ist es zwölf. Besser gesagt: null Uhr. Diesen Ausdruck für Mitternacht mochte ich schon immer lieber. Weil er weder nach Anfang noch Ende klingt, sondern nach Auflösung. Nach Auslöschung, nach dem Nichts. Sonia ist seit drei Jahren tot. Ich vermisse sie. Um ein Haar wäre ich vor ihr gestorben. Sehr lange vor ihr. Vor beinahe 34 Jahren, um genau zu sein. Der 21. Januar 1950 hätte mein Todesdatum sein können. An diesem Tag hätte mich beinahe eine Lungenblutung dahingerafft. Nach meinem Beinahe-Ableben kam zum Glück dieses neue Antibiotikum auf den Markt, Isoniazid. Damit bekam ich meine Tuberkulose in den Griff. Sonia war Redaktionsassistentin bei der Zeitschrift meines Freundes Cyril. Sie war 15 Jahre jünger als ich. Fast wäre unser gemeinsames Glück nur von kurzer Dauer gewesen. Sonia. Ich blicke auf das Buch auf meinem Nachttisch. Sie wollen natürlich, dass ich es gleich mit herunternehme. Unten im Saal sind einige Verlagsleute vertreten. Sie haben einiges zu feiern. Mein vor 35 Jahren erschienener Roman schaffte es noch einmal auf die Bestsellerlisten. Wegen dieses vermaledeiten Jahres. Ich mag die aktuelle Ausgabe des Buchs nicht. Ich kann mich an Taschenbücher nicht gewöhnen. Diese schrecklich bunten Cover. Seit jüngerer Zeit drucken sie auch noch diese furchtbaren Strichcodes hinten auf die Hülle. Irgendwann tragen wir alle einen Strichcode auf der Stirn, denke ich. Vielleicht sollte ich diesen Satz gleich in meiner Ansprache sagen. Wohin soll das alles noch führen? Vor kurzem gaben Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten schon die ersten maschinenlesbaren Reisepässe heraus. Ich öffne die Minibar. Mit 80 Jahren vertrage ich längst nicht mehr so viel wie früher. Ich sollte es besser lassen. Sie werden mich später noch genügend nötigen zu trinken. Oh nein. Jetzt ist auch schon auf Whiskyflaschen dieser Strichcode. Schnell schließe ich den Kühlschrank wieder. Es klopft. Da sind sie. Ich nehme das Buch, gehe zur Tür und öffne sie. Draußen auf dem Flur stehen ein Hotelpage und ein Verlagsmensch von Secker & Warburg. Der hält ein Walkie-Talkie in den Händen und macht auf wichtig. Der Anblick seines Geräts löst in mir Erinnerungen an meine Zeit im Spanischen Bürgerkrieg aus. Es ist kein Walkie-Talkie, es ist ein Mobiltelefon. Ein Motorola. Davon habe ich in den Zeitungen gelesen. Kostet ein Heidengeld und doch sollen schon mehrere tausend Menschen eines besitzen. Angeblich tätigte sein Erfinder den ersten Anruf damit von einem Bürgersteig in Manhattan aus. Er rief gleich mal bei seinem schärfsten Rivalen in den Bell Laboratories an. Entwickler sind längst dabei, für Mobiltelefone ein digitales Netz aufzubauen. Nur eine Frage der Zeit also, bis sie sie mit Computern verbinden. Ist eine Idee erstmal gedacht, kann sie nicht mehr aus der Welt. Information hat die Neigung, frei zu sein, und der Staat hat eine Tendenz dazu, Freiheit zu regulieren. Und ein Telefonnetz war schon immer ein probates Mittel, Menschen zu überwachen. Vor allem in Kriegszeiten. Und Krieg ist eigentlich immer. Auch Kalter Krieg ist Krieg. Ich fühle mich zu alt, aus all dem jetzt noch einen neuen Roman zu entwickeln. Ich hake mich bei dem Hotelpagen unter. Wir gehen zusammen die Treppe herab. Kaum haben wir das Foyer betreten, kommen sie auch schon auf mich zu. Sie drücken mir ein Glas Sekt in die Hand und geleiten mich in den Saal. Durch die Fenster sehe ich, wie die Raketen draußen aufsteigen. Sie zählen: „Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins.“ Einer nach dem anderen kommt auf mich zu, stößt mit mir an und wünscht: „Ein gutes neues Jahr 1984, Mister Orwell!“
Eberhard Malwitz
Kurze Geschichte über Smartphones
Ich bin 84 Jahre alt und kann mich noch gut an die Anfänge der digitalen Datenverarbeitung erinnern. Bis zum modernen Smartphone – im Volksmund meist noch Handy genannt – war es ein weiter Weg. Letztlich sind Smartphones ein Nebenprodukt bei der Entwicklung diverser Computer, nachdem die Miniaturisierung technisch so weit gediehen war, dass sie in Hosentaschen passten. Mit der digitalen Computertechnik kam ich erstmals 1962 während meines Studiums in Berührung. Beiläufig erwähnte unser Dozent das Hollerith-System. Dabei kamen stapelweise Lochkarten zum Einsatz, mit denen die Großrechner gefüttert werden mussten, bevor sie überhaupt in der Lage waren, etwas zu rechnen. Der erste Großrechner glich einem Monster, das gerade mal in eine Turnhalle passte. Der digitale Fortschritt faszinierte mich trotzdem, denn als Studenten mussten wir immer noch mit Rechenschiebern auskommen.
30 Jahre meiner beruflichen Laufbahn arbeitete ich in Darmstadt, am heutigen GSI-Helmholtzzentrum für Schwer- ionenforschung. Mein Freund und Studienkollege ging zum CERN, dem europäischen Forschungszentrum in der Schweiz. Dadurch lernten wir frühzeitig, mit der Digitalisierung und diversen Programmiersprachen umzugehen. Die Forscher verbanden mit der Entwicklung neuer Rechenmaschinen die Hoffnung, die Flut der gemessenen Daten endlich schneller auswerten zu können.
In meiner Jugendzeit waren Telefone in Privatwohnungen noch Luxus. Um eine wichtige Nachricht zu versenden, ging man zur Post und gab ein Telegramm auf: „Wir kommen morgen − Gruß von Tante Emma.“ Oft standen die Besucher unangemeldet vor der Tür: „Hier sind wir.“ „Wie schön, kommt erst mal rein.“ Selbstverständlich hätten sie ihr Kommen lieber mit einem Mobiltelefon angekündigt. Aber dass es solche Geräte für Otto und Emma Normalverbraucher jemals geben würde, konnten sie sich nicht vorstellen. Zwar gab es schon mobile Funkgeräte, diese wurden aber hauptsächlich von Polizei und Militär be- nutzt.
Wie kommunizierten die Menschen nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Denn Post- und Telefonwesen waren ja weitgehend zerstört worden. Ich weiß es nicht. Aber als junger Zeitzeuge kann ich berichten, wie die Kinder das Problem gelöst haben. Millionen Familien waren vor der Roten Armee aus dem Osten Deutschlands Richtung Westen geflohen, unter anderem auch nach Rügen, in ein kleines Dorf. Dort lebten sie zusammengepfercht in engen Wohnverhältnissen. Die Kinder spielten notgedrungen auf Straßen und in der Umgebung des Dorfes, egal bei welchem Wetter. Ihre Mütter mussten bei den Bauern für wenig Geld arbeiten. Die Väter waren entweder im Krieg getötet worden oder in Gefangenschaft geraten. Dadurch blieben die Kinder nach der Schule und in den Ferien sich selbst überlassen. Sie trafen sich täglich in Scharen auf dem Dorfplatz oder an anderen beliebten Treffpunkten. Sie schienen einen sechsten Sinn zu haben, denn sie wussten immer, wo die anderen sich aufhielten, auch ohne Handys. Der soziale Zusammenhalt und die Gruppendynamik funktionierten prächtig. Im direkten Dialog wurde alles ausdiskutiert, beispielsweise, was man alles noch anstellen könnte. Trotz des ärmlichen Daseins – oder gerade deswegen – war das für mich eine glückliche und kreative Zeit. Wir mussten uns alles selbst bauen, was uns die Eltern nicht bieten konnten, vom Spielzeug bis zum Fahrrad. Hätten wir Smartphones gehabt, wir hätten sie genau so gerne benutzt wie die heutige Generation.
Dennoch hatte die Kommunikation ohne Handys einen ganz anderen, einen besonderen Reiz. Sie war wesentlich intensiver, voller Emotionen und Gefühle. Den direkten zwischenmenschlichen Dialog kann weder heute noch in Zukunft ein Smartphone ersetzen. Mit Sprache und Bild jederzeit die anderen digital erreichen zu können, ist zweifellos eine große Errungenschaft. Aber sobald es ums Persönliche geht, ist der direkte Kontakt ehrlicher. Ich möchte die Mimik, die Gesten und den feuchten Glanz in den Augen meiner Gesprächspartnerin oder meines Gesprächspartners hautnah erleben. Wichtige Inhalte einer Unterhaltung bestehen nicht nur aus nackten Worten. Auch das digitale Visualisieren der Gesprächspartner ist kein echter Ersatz, weil man nur das zu sehen bekommt, was der andere zulässt. Sogar der Geruch spielt während der Kommunikation eine Rolle − mehr, als es uns bewusst ist, behauptet die Wissenschaft.
In den 1950er-Jahren, als die Forscher noch ohne leistungsfähige Rechenmaschinen auskommen mussten, wurde im CERN ein genialer Mathematiker eingestellt. Seine einzige Aufgabe bestand darin, die manuellen Berechnungen der Experimentatoren zu überprüfen. Nachdem die ersten Großrechner seine Arbeit übernommen hatten, schlich er nur noch über den Hof, zu nichts mehr nutze. Beim abendlichen Kegeln war er aber immer dabei. Eines Tages stellten ihn die Kegelbrüder auf die Probe. Er sollte bis zum nächsten Treffen drei Seiten des Genfer Telefonbuchs auswendig lernen. Natürlich bestand er diese Prüfung mit Bravour.
Die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung begeisterten mich derart, dass ich unser Konstruktionsbüro bei der GSI komplett auf Computer-Aided-Design (CAD) umstellen ließ. Mit der Software „CATIA“ von Dassault wurde immerhin das Kampfflugzeug Mirage konstruiert. Mercedes und BMW verwendeten sie ebenfalls. Und nun sollte der neue Teilchenbeschleuniger für unser Forschungszentrum damit designt werden? Anfänglich hatte ich schlaflose Nächte, doch schließlich überzeugte mich die Software und ist heute in der GSI zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel geworden. Ich hatte einen Mathematiker und einen Physiker als professionelle Berater und lernte diverse Programmiersprachen. Ständig verwickelte ich die beiden in Diskussionen, wie man einem Computer beibringen könnte, mit Pattern Recognition eine von Hand gezeichnete Gerade oder einen Kreis zu erkennen. Unzählige Stunden verbrachte ich bis spät nachts an einer der Workstations, die damals in den Fluren des Forschungszentrums zur freien Verfügung standen. Zweifellos war ich damals süchtig, Programme zu schreiben und habe meine eigentlichen Aufgaben vernachlässigt.
In den achtziger Jahren stürmte ein Mitarbeiter in mein Büro, um mir etwas Wichtiges mitzuteilen. Er fuchtelte wild mit der freien Hand umher und presste mit der anderen ein Mobiltelefon mit Tasten ans Ohr. Übrigens, das erste, das ich zu Gesicht bekam. So lief er wichtigtuerisch durch die Flure des Forschungszentrums. Alle machten sich über ihn lustig. Aber nicht lange, denn er war immer bestens informiert.
Die digitale Technik entwickelte sich rasant und wurde immer komplexer. Eines Tages brachten meine Kinder Handys mit nach Hause, die sie sich von Freunden geliehen hatten. Noch beobachtete ich dieses Teufelszeug mit Argusaugen, denn außer Telefonieren konnte man nicht viel mit diesen Dingern anfangen. Es vergingen Jahre, bis ich mir ein Handy zulegte . Diese Winzlinge wurden immer besser und waren vielseitig verwendbar, beispielsweise als Taschenrechner. Längst konnten sie sich in ihrer Leistung mit Personal Computern messen, lediglich die Handhabung auf dem kleinen Display war sehr mühsam. Wenn mein Freund vom CERN mich besuchte, unterhielten wir uns stets über Teilchenbeschleuniger. Aber schließlich landeten wir immer beim Thema Smartphone. Dann tauschten wir uns über die neuesten Apps aus. Niemand brauchte mehr Angst zu haben, dass einem während des Stadtbummels die Partnerin oder der Partner – oder noch schlimmer: das Auto – abhandenkommen könnte. Ein Anruf per Smartphone genügte und schon hatte man sich wieder gefunden. Und wenn man nicht mehr wusste, wo man das Auto geparkt hatte, kein Problem, nur wenige Klicks und eine Computerstimme lotste einen sicher hin. Die Adressensammlung digital im Smartphone zu haben, war sehr nützlich. Und wenn man sich nicht mehr erinnern konnte, ob die gesuchte Person Meier oder Geier hieß, auch kein Problem: Man brauchte einfach nur „eier“ als Suchbegriff einzugeben. Früher hätte man mühselig das gesamte Adressbuch durchlesen müssen. Ebenso gab es einem ein Gefühl von Sicherheit, den digitalen Terminplaner immer zur Hand zu haben.
Als ich wieder einmal meinen Hausarzt aufsuchen musste, war das Wartezimmer voll besetzt. Junge Patienten saßen nach vorn gebeugt und bearbeiteten mit fliegenden Daumen ihre Smartphones zwischen den Knien – mit Zugang zum Internet und Tausenden Apps. Vertieft in eine andere Welt, huschte bisweilen ein Lächeln über ihre Gesichter. Einige hatten Sorgenfalten auf der Stirn. In einer Ecke bellte ein Hund, ach nein, ein Smartphone. Ich wollte nicht mehr nur Zuschauer sein, während die jungen Leute auf ihren Geräten herumhackten, und zückte meins ebenfalls. Ich las die E-Mails, überprüfte meine Termine und schrieb meiner Frau eine WhatsApp. Die älteren unter den Wartenden oder exakter ausgedrückt, jene, die schon so alt waren wie ich, aber diese Wunderwerke nur vom Sehen kannten, warfen mir mitleidige Blicke zu. Auch ohne mich anzusprechen, glaubte ich zu wissen, was sie dachten: „Warum müht sich der alte Opa so ab? Mit nur einem Finger! Der sollte mal unsere Enkel sehen, die schreiben mit zwei Daumen, schneller als ein Maschinengewehr, sogar blind unterm Tisch“. Ich dachte mir meinen Teil: „Ist ja schon gut, ich weiß, eure Enkel sind lauter kleine Einsteins.“
In meinem Alter braucht man das Smartphone nicht mehr für Liebesgeflüster. Eher in Notfällen, um den Hausarzt anzurufen. Aber da nimmt ohnehin niemand ab. Falls ich jemals dringend ärztliche Hilfe benötigen sollte, würde ich also per Smartphone einen Notruf absetzen – selbstverständlich nur, wenn ich dazu noch imstande wäre. Der Rettungs-Hubschrauber würde mich finden, sogar im tiefsten Wald, weil er durch den Notruf auch meine Koordinaten wüsste. Ohne Handy würde ich in solchen und ähnlichen Situationen keine Chance haben. Eine Eigenschaft moderner Smartphones liebe ich besonders: Man kann mit den Winzlingen mittlerweile reden und wird hervorragend verstanden. Auch Texte kann man diktieren. Einfach auf das Micro-Symbol klicken und sprechen: „Was bedeutet Zensus?“ Oder: „Wie viele Einwohner hat Köln?“
Mittlerweile lässt sich das Smartphone auch als Navi verwenden. Vorbei ist die Zeit, als man in der Stadt Passanten nach dem Weg fragen musste. In seriösen Datenbanken recherchieren zu können, ist ein wahres Geschenk. Die Huldigungen ließen sich noch endlos fortsetzen. Ich versuche mir vorzustellen, wozu Smartphones in der Zukunft noch fähig sein würden, und bastele mir im Kopf verschiedene Szenarien zusammen. Die Zukunft kann niemand vorhersagen, aber die bisherige Entwicklung zu extrapolieren, erlaube ich mir trotzdem. Angenommen, Smartphones könnten eines Tages riechen, womöglich so gut wie Hunde. Unmöglich? Geht nicht gibt es nicht! Sicherheitshalber stelle ich meinem Smartphone noch vorher die Frage: „Gibt es euch auch mit Geruchssensoren?“ Prompt kommt die Antwort: „Der Bosch-Konzern entwickelt Smartphones, die den Gehalt von Kohlendioxid in der Raumluft messen können und bei Überschreiten des zulässigen Grenzwertes Alarm schlagen.“ Wenn Bosch schon eine derartige Entwicklung betreibt, wie weit mögen dann erst Samsung und Apple sein, frage ich mich.
Falls es eines Tages tatsächlich gelingen sollte, Smartphones das Geruchsvermögen von Hunden einzuverleiben, entstünden unvorstellbare Nutzungsmöglichkeiten. Beispielsweise wäre es dann mit dem Fremdgehen vorbei. Hierzu eine erfundene Geschichte:
Irgendwann werden fast alle Erwachsenen und Jugendlichen Smartphones nutzen, auch die älteren Semester, weil alle im Zeitalter der Digitalisierung geboren worden sind. Dadurch ergäben sich insbesondere für totalitäre Staaten ungeahnte Möglichkeiten, dem Volk ihren Willen aufzuzwingen. Noch können wir selbst entscheiden, ob wir uns ein Smartphone zulegen oder nicht. Aber was wäre, wenn eine Regierung per Gesetz das Smartphone als Ersatz für Ausweispapiere jeglicher Art deklarieren würde? Das hieße, dass die Daten aller Dokumente wie Personalausweis, Fahrerlaubnis, Bankkarte, Gesundheitskarte usw. zukünftig im Smartphone oder auf einem Server gespeichert sein müssten. Damit wäre die Verpflichtung verbunden, das Smartphone immer bei sich zu haben, wie vorher einige Papiere. Eine solche Umstellung würde man den Bürgern selbstverständlich als große Erleichterung verkaufen. Das wäre sie tatsächlich, denn egal mit welchem Amt oder welcher Institution wir es zu tun bekämen, die Vorlage unseres Handys als Identitätsnachweis würde ausreichen. Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir zu gläsernen Menschen werden, die beliebig von oben gesteuert werden können? Natürlich nicht. Spätestens, wenn Smartphones durch künstliche Intelligenz in der Lage sind, sich nachts heimlich einzuschalten, um sich zu unterhalten oder sich gar zusammenzurotten, um ihren Besitzern eins auszuwischen, brauchen sie uns nicht mehr. Hoffen wir, dass derartige Zukunftsvisionen niemals Realität werden. Was mich betrifft, werde ich mein Smartphone auf alle Fälle mit ins Altenheim nehmen, es sei denn, meine Augen würden nicht mehr mitspielen.
Thomas Fuhlbrügge
Adel verpflichtet
Könige und Schlösser hatten es mir schon immer angetan. Seit ich von meiner Mutter Märchen vorgelesen bekam. Vor allem Dornröschen. Dumm nur, wenn man so gewöhnlich ist wie der Dreck unter den Fingernägeln. Ab und zu so zu tun, als ob man dazugehörte, ist aufregend. Es ist mein Hobby und das meiner Freundin Ilona. Wir beide arbeiten bei derselben Zahnmedizinerin. Sie als Arzthelferin. Ich, Martina, 28 und Dauersingle, an der Anmeldung. Unsere Kaffeetassen ziert die Queen. Ihre Beerdigung haben wir in voller Länge live verfolgt. Genauso wie die Hochzeiten ihrer verzogenen Brut. Freitagabend war es wieder so weit. Wenn andere ins teure Konzert gehen oder ein Heidengeld für den Urlaub ausgeben, fahren Ilona und ich nach Kronberg. Ins Schlosshotel. Vor 120 Jahren zog Victoria Kaiserin Friedrich, wie sie offiziell hieß, in den Taunus. Sie war die Mutter von Willi II und die Tochter der Queen von England. Die Dame ließ sich den Altersruhesitz nach eigenen Vorstellungen erbauen. Ihre Herkunft spiegelte sich in der Architektur wider: deutsche Renaissance, englische Tudorgotik und hessischer Fachwerkstil. Das gesamte Anwesen erinnert an das schottische Königsschloss Balmoral. Vor 60 Jahren wurde der ehemalige Wohnsitz in ein luxuriöses Hotel umgebaut. Es ist unser Lieblingsort. Wo ist es sonst möglich, in einem kaiserlichen Schloss mit Originaleinrichtung zu wohnen? Zugegeben, dort zu nächtigen können wir uns nicht leisten. Wer das Zimmer von Wilhelm zwo bucht und an seinem Originalschreibtisch sitzen will, gibt über 2000 € pro Nacht aus. Das 5-Gänge-Menü im Restaurant für 155 € – ohne Käse – liegt ebenfalls nicht in unserem Budget. Aber einen Abend in der dortigen Bar Frederick’s ausklingen zu lassen, dafür lohnt es sich zu sparen. Schon Wochen zuvor haben wir reserviert. Denn uns interessiert ein ganz bestimmter Platz: Der Tisch vor dem Bild Venedig im Nebel. Das ist ein echter William Turner. Das einzige Gemälde des Künstlers in Privatbesitz. Nicht Stiefelriemen-Bill Turner aus dem Film Fluch der Karibik. Sondern der weltberühmte und bedeutendste Maler Englands. 16.00 Uhr. Der Feierabend rückte näher. Natürlich kam ein Notfall in die Praxis und die Chefin machte Überstunden. Wir daher ebenfalls. Endlich. Ilona und ich nahmen die Jacken. Wir verabschiedeten uns ins Wochenende. Dann ging es zur Freundin nach Hause. Meine Garderobe hatte ich im Auto. Erst einmal vorglühen. Sie mixte alkoholfreie Cocktails. Dazu Minipizzen aus dem Backofen. Und während ihre drei Katzen um unsere Beine schnurrten, machten wir uns bereit. Das edle Kleid aus dem Versandhaus. Die neuen Schuhe. Die Perlenkette. Ein Erbstück von Oma. Does Your Mother Know von ABBA dröhnte aus dem Lautsprecher. Es dauerte, bis wir mit unserem Look zufrieden waren. Ein Blick auf mein Handy: dreiviertel acht. Ins Auto und los. Wir waren bester Stimmung. Nach einer halben Stunde erreichten wir das Ziel. Sobald das Eingangstor des Schlossparks passiert war, hatten wir das Gefühl, in einem Rolls Royce zu sitzen und durch einen englischen Park zu fahren. Nur, dass es ein verbeulter, alter Corsa war. Daher parkten wir am Ende des Platzes, zwischen einem Jaguar und einem Porsche. „Lass Dich nicht blöd anquatschen“, sagte Ilona zu ihrem Opel, als sie abschloss. Die Begrüßung durch den Doorman und das Betreten des Schlosshotels Kronberg versetzen jeden Gast in eine andere Welt. In die des royalen, englischen Luxus. Sobald wir das Hotel betraten, gelangten wir in die einladende Eingangshalle. Sie ist Treffpunkt und zugleich wohnlicher Salon. Mit Sofa, großem Kamin und Gemälden. Die Rezeption liegt diskret in der rechten Seite der Halle. Dort führte unser Weg in die Bar. Dezente Klaviermusik geleitete uns. Dunkle furnierte Wände. Alle Sessel mit edlem Leder bespannt. Frische Blumen und Kerzen auf jedem Tisch. Wir sind beileibe keine Stammgäste. Trotzdem begrüßte uns Carsten hinter der Bar mit einem Lächeln. „Schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen.“ Er deutete auf unseren Platz. „Möchten Sie zur Begrüßung einen Cosmopolitan, wie beim letzten Mal?“ „Dass Sie sich das gemerkt haben ...“ Ich war beeindruckt. „Gern.“ Wir setzten uns. Mein Platz war direkt vor dem Bild. Ilona saß gegenüber. Sie machte erst einmal ein Selfie. Venedig im Nebel. Zarte Farben, Silhouetten der Stadt. Ein massiver Holzrahmen. Darunter ein kleines Messingschild. JMW Turner. Nach kurzer Zeit standen die Cocktails und eine Schale mit Nüssen vor uns. Der Pianist in der Ecke spielte zu unserer Entzückung ABBA in verspielten Variationen. Im Laufe des Abends wechselte er auf Queen. Wir unterhielten uns prächtig. Die Gespräche drehten sich um Katzen, Männer, Reisen und nur wenig um den Job. Das hatten wir uns geschworen, ließ sich aber nie ganz vermeiden. Ilona war wie ich Single. Und wir tummelten uns auf diversen Dating-Seiten im Netz. Manchmal schlugen wir uns gegenseitig die Profile der Männer vor. Und wir erzählten uns von jedem Kennenlerntreffen. Zu diesem Zweck hatten wir beide eine App installiert, auf der man sah, wo sich die Freundin aufhielt. Aus Sicherheit. Würde eine abgeschleppt und in Not geraten, ermittelte die andere den genauen Aufenthaltsort. Das war allerdings noch nie nötig gewesen. Neben uns waren kaum Besucher anwesend. Zwei Herren an der Bar. Gesetztes Alter. Unternahmen eine Whiskyprobe. Wahrscheinlich auf Firmenkosten. Das Paar im Golfdress. Sie dünn wie ein Hering und geschminkt wie eine Bordsteinschwalbe. Er mit geölten Haaren und doppelt so alt. Dazu ein einzelner kahlköpfiger Mann links vom Flügel. Soeben brachte Carsten erneut zwei Gläser Long Island Ice Tea. Ich überschlug unsere Rechnung und die Menge des getrunkenen Alkohols. Dies würde das letzte Getränk sein. Hoffentlich kamen wir in keine Alkoholkontrolle. Ein Zimmer hier oder ein Taxi waren definitiv nicht drin. Ein Blick auf das Display. Kurz nach Mitternacht. „Irland. Da würde ich sofort hin“, griff ich den Faden unseres Gesprächs wieder auf. „Der Ring of Kerry ist traumhaft. Hier, ich habe noch Fotos von 2017.“ Ein Wischen über den Bildschirm. Etwas polterte an der Tür zur Bar. „Ruhig bleiben. Dann passiert niemandem was!“ Zwei Männer stürmten in den Raum. Dunkle Klamotten. Basecaps. Pistolen. Was war hier los? Sie rannten in die Mitte des Saals. Einer trug eine schwere Sporttasche. Der andere deutete auf uns. „Los! Beiseite!“ Niemand rührte sich. Der Pianist machte eine Bewegung. Ob er sich in den Flur absetzen wollte? Da zog der glatzköpfige Gast eine Waffe. „Keine Dummheiten.“ Er stand auf. Kam zu seinen Komplizen. Beide stürmten auf uns zu. „Weg hier!“ Geschockt rückte ich beiseite. Der Erste griff zum Bild. Also darum ging es. Die Sporttasche landete auf dem Tisch. Unsere Gläser klirrten zu Boden. Der Inhalt tropfte über die Platte. Einer fasste zum Reißverschluss. In der Tasche befand sich Werkzeug. Beide Gangster griffen nach massiven Brecheisen. Einer hob den Turner an. Ein lautes Kreischen ertönte. Wir hielten uns die Ohren zu. Die junge Frau schrie. Der glatzköpfige Räuber brüllte ihr etwas entgegen. Im Lärm ging es unter. Unbeirrt rammten die Diebe ihre Eisenstange an die Wand und zerrten mit urtümlicher Gewalt. Der Rahmen splitterte. Einer nahm sich eine Beißzange und hantierte hinter dem Bild. Direkt vor mir stand die Tasche. Niemand achtete in diesem Moment auf mich. Zwei Räuber bearbeiteten das Gemälde, der dritte hatte sich der kreischenden Frau zugewandt. Ich reagierte. Ließ das Smartphone aus meiner Hand in die Tiefen der Tasche gleiten. Ein letzter Widerstand. Dann hielten die Verbrecher den Turner vor sich. Sofort schnappten sie sich die Tasche und stürmten aus der Bar. Ich lugte aus dem Fenster in Richtung Parkplatz. Dort wartete ein Van. Vier Personen sprangen hinein. Einer hielt sich bestimmt in der Eingangshalle auf. Bedrohte womöglich die Frau an der Rezeption und den Türhüter. Über allem kreischte die Alarmanlage. Tumult. Leute liefen umher. Bedienstete kamen. Die hysterische Golferin erlitt einen Schwächeanfall. Ihr Begleiter fächelte ihr mit einer Serviette Luft zu. Ilona und ich setzten uns. Meine Freundin zückte ihr Handy und filmte. Die umherirrenden Menschen. Und den ramponierten Fleck, an dem bis eben ein weltbekanntes Kunstwerk hing. Dann nahm ich es ihr aus der Hand und tippte auf dem Display. Keine zehn Minuten später Blaulicht in der Auffahrt. Polizisten von der Polizeistation Königstein. Endlich verstummte die Sirene. Welche Wohltat für unsere Ohren. „Wir müssen Sie bitten, sich für Vernehmungen zur Verfügung zu halten.“ Ein Mann in einem Anzug. Womöglich von der Hotelleitung. „Bitte begeben Sie sich in die Halle.“ Wir standen auf. Im pompösen Eingangsbereich war es wie in einem Ameisenhaufen. Hotelgäste in Schlafanzug, Köche, Uniformierte. Ich ging auf einen wichtig aussehenden Polizisten zu. Er instruierte zwei Männer in Zivil. „Die Kollegen aus Oberursel bereiten Fahrzeugkontrollen vor. Das SEK aus Frankfurt ist verständigt. Der Hubschrauber in Eschborn ist gleich in der Luft.“ Anscheinend der Einsatzleiter. „Entschuldigen Sie. Ich war bei dem Überfall Zeuge.“ „Wir kommen nachher zu Ihnen. Bitte bleiben Sie in der Nähe.“ „Ich habe den Dieben mein Smartphone in ihre Tasche untergejubelt. Sie können es orten. Es hat eine entsprechende Funktion.“ Ich zeigte dem Polizisten Ilonas Smartphone. Auf dem Bildschirm war eine Karte eingeblendet. Auf einem kaum sichtbaren Feldweg bewegte sich ein Kreis. Der Vorgesetzte war nähergetreten. Zuerst blickte er mich verständnislos an. Dann schaute er genauer hin. „Die versuchen, querfeldein nach Neuenhain zu gelangen. Damit umgehen sie die Straßensperren.“ Er gab Anweisungen in ein Funkgerät. „Das ist fantastisch. Bitte geben Sie mir das Smartphone.“ Meine Freundin gesellte sich zu mir. „Hoffentlich bekomme ich es nachher wieder.“ „Das wirst Du schon. Es war doch praktisch, dass wir beide diese App installiert haben.“ Es wurde spät. Ilona und ich saßen auf einer bequemen Couch. Die goldene Standuhr zeigte halb zwei. Wir bekamen einen weiteren Espresso gereicht. Stilvoll auf Silbertablett mit Zuckervariationen, Gebäck und einem Glas Wasser serviert. Inzwischen war der Erkennungsdienst angekommen. Sicherte Spuren. Verteilte Nummernkärtchen und schoss hunderte Fotos. Ein Blick aus dem Fenster verriet, dass das Fernsehen eingetroffen war. Der Hessische Rundfunk. Scheinwerfer flackerten auf. Ich hatte bereits die Personalien zu Protokoll gegeben. Einer netten Beamtin meine Geschichte erzählt. Da hörten wir Jubel aus Richtung des Restaurants. Die Soko hatte dort ihre Zentrale eingerichtet. „Sie haben die Gangster!“ Einer der Kellner lief in die Eingangshalle. Offenbar war er anwesend, als die Nachricht durchgegeben wurde. „Und das Bild wurde sichergestellt.“ Eine Viertelstunde später kam der Einsatzleiter zu uns. „Die Strolche haben es tatsächlich bis auf die A66 geschafft. Aber mithilfe Ihres Smartphones waren wir ihnen auf der Spur. Der Hubschrauber ortete sie ebenfalls und verfolgte sie mit der Nachtsichtkamera. Über das Westkreuz sind sie auf die A5 bis zum Rastplatz Eschborn. Dort hatten sie zwei gestohlene Fahrzeuge abgestellt. Wollten die Autos wechseln. Hier erfolgte der Zugriff. Niemand wurde verletzt.“ Ich strahlte. „Konnte der Turner gerettet werden?“ „So ist es. Er ist nur leicht beschädigt.“ „Wer würde denn ein solches Bild verkaufen können? Das kennt doch jeder.“ „Sie glauben nicht, wie viele russische Oligarchen für ihre Privatsammlungen bereitstünden. Aber dank Ihres Einsatzes wurde das vereitelt. Ich muss Ihnen danken.“ „Dann können wir jetzt endlich nach Hause fahren?“ Der Polizist blickte mir in die Augen. „Aber nicht in Ihrem Zustand. Eine Kollegin bringt Sie heim.“ Damit waren wir einverstanden. Am kommenden Tag waren die Zeitungen voll. Mein Telefon stand keine Sekunde still. Ich musste Interviews geben. Wurde in die Sendung Maintower eingeladen. Die größte Überraschung erwartete uns allerdings, als wir Ilonas Corsa abholten. Die Geschäftsleitung des Schlosshotels empfing uns und bedankte sich mit je einem gigantischen Blumenstrauß. Außerdem luden Sie uns zum Dank auf ein Verwöhnwochenende ein. Mit allem Drum und Dran. Und Übernachtungen in der Kaiser-Suite. Bis wir unsere Smartphones wiederbekamen, dauerte es allerdings drei Wochen. Marina & ChatGPT:
1. marina an ChatGPT:
nähere dich dem stil von marina d’oro an. ich reduziere, was ich sehe, sprache wird bild. kurz, überflüssige wörter meidend, pars pro toto, verdichtung, verschiebung … gerne auch fehlerhafte formulierungen, wenn sie treffender sind. und wörter trenne ich oft in ihre bestandteile wie bei gänse-blümchen.
schreibe ein eigenes gedicht angelehnt an folgendes gedicht von marina d’oro:
prompt schreibt chatGPT los. sein ‚ergebnis‘:
Die glänzenden Stiefel wie Lack, knochenhoch geschnürt, Trotzen sie dem Wiesengrund, auf dem Gänseblümchen blühen.
Ich reduziere, was ich sehe, Sprache wird Bild, in der Erzähltperspektive.
Vor ihm das Smartphone, ein Fenster zur Welt, Doch im wahren Leben, stirbt der Stadtwald langsam dahin.
Von Wiesensamen in Tütchen, spricht man zum Erhalt der Vielfalt, Doch was ist mit den Bäumen, die seit Jahren hier standen.
Stämme und braune Blätter liegen neben seinem Kopf, Während die Bahn drei Stationen mit blauem Licht passiert. Ich suche nach Worten, die das Bild verdichten, Pars pro toto, Verschiebung, wie bei Gänse-Blümchen.
Das Bild des jungen Mannes im Zug, Ein Moment des Innehaltens, des Nachdenkens, Über das, was wir tun und was wir lassen, Für eine Welt voller Wiesensamen und Bäume, die bleiben.
Marc Mandel & ChatGPT
Julia und Marc
Auftrag an ChatGPT: Schreibe eine Geschichte über Julia und Marc. Julia ist neu im Büro. Zum Feierabend fragt ihr Kollege Marc, ob er sie nach unten begleiten könne. Im Aufzug prahlt Marc, dass er für alle Datenbanken des Unternehmens verantwortlich ist. Julia will mit zu ihm in die Wohnung. Er kocht Kaffee in der Küche und sie fragt ihn, ob sie auf seinem Computer nach ihren Mails schauen kann. Auf einem Zettel unter dem Laptop steht sein Passwort, das sie sofort fotografiert und weiterschickt. Gleichzeitig bucht sie einen Flug. Als Marc zurückkommt, lehnt Julia den Kaffee ab; sie müsse sofort los. Am nächsten Morgen ist sein Zugang gesperrt und alle Daten verschlüsselt – von Julia keine Spur.
Text von ChatGPT: Julia war gerade neu im Betrieb und hatte noch nicht viele Freunde gefunden. Eines Abends, als sie allein im Büro war, traf sie auf Marc, einen Kollegen, der sie freundlich begrüßte und ihr anbot, gemeinsam nach unten zu gehen. Da sie denselben Weg hatten, nahm sie das Angebot an. Während sie im Aufzug waren, erzählte Marc, dass er alle Datenbanken ihres Arbeitgebers betreue. Julia war beeindruckt, aber auch besorgt, dass jemand mit so viel Macht möglicherweise unethisch handeln könne. Als sie in Marcs Wohnung ankamen, bat sie ihn, auf seinem Laptop ihre E-Mails zu checken, während er Kaffee kochte in der Küche. Während Marc in der Küche beschäftigt war, nutzte Julia die Gelegenheit, um das Passwort zu fotografieren, das auf einem Zettel unter dem Laptop lag. Sie verschickte das Passwort an ihren eigenen E-Mail-Account und buchte sofort einen Flug in eine andere Stadt. Als Marc zurückkam, bemerkte er nichts von Julias Plan und fragte, ob sie jetzt einen Kaffee trinken wolle. Julia lehnte ab und verabschiedete sich höflich von ihm, bevor sie leise die Wohnung verließ. Am nächsten Morgen, als Marc zur Arbeit kam, bemerkte er, dass seine Zugangsdaten geändert und alle seine Datenbanken gehackt worden waren. Er wusste nicht, wer dahintersteckte, aber er wusste, dass er sich nicht mehr auf seinen Job verlassen konnte. Julia hatte ihm gezeigt, dass Macht auch missbraucht werden konnte, und er hatte den Preis dafür bezahlt.
Biobibliographische Angaben
Stefan Benz Geboren 1966 in Darmstadt. Seit 1985 Kulturjournalist mit den Schwerpunkten Theater, Tanz und Film. Studium der Germanistik, Amerikanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Frankfurt (Master 1992). Seit 1994 Redaktionsmitglied beim Darmstädter Echo, arbeitet als Kulturredakteur. Seit 2016 schriftstellerische Tätigkeit. Zuletzt erschienen: „Theaterherz – Herr Beck und der Tod des reichen Mannes“ (Roman, Hamburg 2020); „Theaterpest“ (Kurzgeschichte in der Anthologie „CO-RO-NA“, Darmstadt, 2020); „Theaterhölle“ (Kurzgeschichte in der Anthologie „Tatort Darmstadt“, Darmstadt 2021).
Fritz Deppert Geboren 1932 in Darmstadt und immer noch dort lebend. Dr. phil., promoviert über Ernst Barlachs Dramen, Gründungsdirektor der Bertolt-Brecht-Schule (Oberstufengymnasium) in Darmstadt, Mitglied des PEN, Ehrenpräsident der europäischen Autorenvereinigung „Die Kogge“, Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Merck-Ehrung der Stadt Darmstadt, Goethe-Plakette des Landes Hessen. Jüngste Veröffentlichungen: „Möglichkeiten zu Trauern“, „24 Episteln“, 2021; „Alles in allem“, Prosa und Gedichte, 2022.
Alex Dreppec Geboren 1968, promovierter Psychologe. Über 300 Veröffentlichungen u. a. im deutschen und englischen Sprachraum, z. B. in „Der Große Conrady“ (Neuauflage 2008), „Cincinnati Review“ (USA) und „Orbis“ (GB), seit 2019 u. a. in Anthologien und Literaturzeitschriften auf allen fünf Kontinenten. Regelmäßiger Autor u. a. bei „Das Gedicht“ und „Parody in Impression“ (New York, eingestellt). U. a. Wilhelm Busch-Preis 2004 (erster Platz). Erfand den Science Slam, der sich international ausbreitet. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Gedichtband: „Tanze mit Raketenschuhen / Dance with Rocket Shoes“, 2016. 2020 u. a. Mitherausgeber der online-Anthologie „Lockdown-Lyrik“ für dasgedicht. de. www. dreppec. de
Marina D’Oro Geboren: ja, im Stutengarten. Studium der Germanistik und Politologie. Volontariat, Redakteurin, Vorstandsstab Kommunikation. Seit 1985 lebhaft in Frankfurt am Main. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Jüngste Veröffentlichungen: „Kasinostraße 3“, Anthologie der Darmstädter Textwerkstatt, 2014; „Lockdown-Lyrik 121“, Gedichtblog, 2020.
Elena Feder Geboren 2005 in Darmstadt. Abitur 2023 an der Viktoriaschule, Leistungskurse Deutsch, Mathematik. Seit früher Kindheit Begeisterung für Literatur und das Schreiben. Mitglied der Textwerkstatt für Jugendliche bei Kurt Drawert.
Thomas Fuhlbrügge Jahrgang 1974. Lehrer für Katholische Religion, Politik und Wirtschaft, Ethik und Philosophie an der Bachgauschule in Babenhausen. Der Autor, Musiker und Liedermacher lebt mit seiner Frau und seinem Sohn im südhessischen Altheim. Ehrenpreis „Riedschreiber 2022“ der Riedbuchmesse in Stockstadt. Letzte Werke: Massengrab (2020), Muna (2021), Wolkshatz (2022), Kindgerecht (2023), alle erschienen im Coortext-Verlag.
PH Gruner Geboren 1959. Seit 1982 in Darmstadt. Politik- und Sprachwissenschaftler, Dr. phil., Autor, Publizist, bildender Künstler. 1996 bis 2016 Redakteur beim Darmstädter Echo. Mitglied des PEN Deutschland und des VS-Hessen. Geschäftsführer der Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde. Gründer der Literaturgruppe POSEIDON (www. literaturgruppe-poseidon. de). Diverse Preise und Stipendien. Jüngste Publikationen: „Die extrem kurze Zeit der Seligkeit. Zehn Kurzgeschichten und ein Hörspiel“, Darmstadt 2018; „Das Ohr. Ein Märchen für Erwachsene und solche, die es werden wollen“, Darmstadt 2022. „Drei Frauen“, Novelle, Ludwigsburg 2022. www. phgruner. de
Tamara Krappmann 1982 in Darmstadt geboren. Studierte Literaturwissenschaft und hat über die Namen in Uwe Johnsons „Jahrestagen“ promoviert. Für die Echo-Medien (Darmstadt) ist sie seit 2006 in wechselnden Rollen tätig, unter anderem als Freie Mitarbeiterin, Online-Redakteurin, als Senior-Editorin und Reporterin. 2021 und 2023 zählte sie zu den Preisträgern der Riedbuchmesse Stockstadt. Kurzgeschichten erschienen in den zugehörigen Sammelbänden „Das Viertel“ und „Himmel und Hölle“.
Eberhard Malwitz Geboren 1938. Seit 1970 in Darmstadt. Als Diplom-Ingenieur (FH) Abteilungsleiter am GSI-Helmholtzzentrum für Schwer- ionenforschung. Parallel dazu bildender Künstler. Autor von Kurzgeschichten und wissenschaftlicher Literatur. Das erste Buch „Donnerkeile“ mit Zeichnungen über das Ende des Zweiten Weltkriegs erschien 2003. Seit 2008 Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. 2014 erschien der Roman „Neckarstrahl“, ein Krimi und Wissenschaftsthriller. 2017 Initiator, Mitherausgeber und Mitautor des interdisziplinären Buchprojekts „Vom Targetrad zum Federkiel. Elf Physiker der GSI treffen auf neun Autoren der Literaturgruppe POSEIDON“. „Vor dem Nebel“, Autobiografie, erschien 2021. www. malwitz-art. de
Marc Mandel Geboren 1948 im Saarland. Seit 1997 in Darmstadt. Rockmusiker, Hotelpianist, Philosoph und Literaturwissenschaftler. Freier Journalist (u. a. für das Darmstädter Echo und die Jüdische Allgemeine) sowie Autor. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Jüngste Veröffentlichungen: „Möbiusschleife – Wie frei willst du sein?“ (Thriller). „Mädchenlieder – Gedichte über ausgezogene Mädchen in frischbezogenen Betten“, beide Altheim 2023. www. marcmandel. jimdo. com Sorosh Masudi Geboren in Afghanistan, wohnhaft in Darmstadt, verarbeitet seine Erlebnisse und Beobachtungen aus Vergangenheit und Gegenwart und seine Gedanken dazu mit Zeichnungen. Er hat jüngst an der Alice-Eleonoren-Schule (AES) in Darmstadt sein Deutschzertifikat B1 erworben. Die AES bietet wie andere Berufliche Schulen jungen Geflüchteten, Spätaussiedlern und Zuwanderern mit anfangs keinen oder geringen Deutschkenntnissen Intensivklassen (InteA-Klassen) an, die auch zur beruflichen Bildung beitragen und durch ein sozialpädagogisches Angebot flankiert werden. In seiner Klasse fiel den Lehrkräften Masudis zeichnerisches Talent auf.
Gerty Mohr Geboren in Darmstadt, wo sie heute wieder lebt. Studium der Kunstgeschichte, Archäologie, Komparatistik, Germanistik und Anglistik in Bochum, Essen, Grenoble und Pisa. Schreibt Lyrik, Kurzprosa, Buchrezensionen sowie Ausstellungskritiken, übersetzt aus dem Englischen, arrangiert Lesungen und Ausstellungen. Langzeitleseprojekt mit dem bildenden Künstler Klaus Kiefer. Zehn Jahre Redaktionsarbeit bei einer Frauenzeitschrift, Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller, Mitglied im Verein Für die Schwarze Kunst, Mitglied im PEN-Förderkreis International, Vorstandsmitglied im IADM (Internationaler Arbeitskreis Druck und Medien), Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Herausgeberin von „Bretagne“, Bibliophile Taschenbücher, Harenberg-Verlag, „Ewwerschter Kunststickscher“, Odenwald-Verlag, sowie der Anthologie „Vollzug – Knastliteratur gitterfrei“, ebenfalls Odenwald-Verlag. Ewart Reder Geboren 1957 in Berlin, lebt in Maintal bei Frankfurt. Seit 1999 veröffentlicht er Literatur verstreut und in Buchform. Freier Mitarbeiter des Literat, Berlin, 1999 bis 2008, freier Mitarbeiter der Frankfurter Rundschau, bei neues deutschland und beim Kritischen Lexikon der Gegenwartsliteratur, Mitbegründer und Redakteur der Literatursendung WortWellen, Radio X, Ffm (seit 2001), Teilnehmer internationaler Literaturfestivals und -Kongresse, Fernsehfilm Buch auf! Ein Porträt des Schriftstellers Ewart Reder, von Bernhard Bauser, Offenbach 2000. Letzte Buchveröffentlichungen: „Reise zum Anfang der Erde“, Roman, Axel Dielmann Verlag, Frankfurt am Main 2016, „Die hinteren Kapitel der Berührung“, Gedichte, Pop Verlag, Ludwigsburg 2021. Diverse Auszeichnungen, z. B. Stipendium der Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2012-2014. htpps://literatur. net
Andreas Roß Geboren 1962, lebt seit 1985 in Darmstadt, von berufs wegen seit mehreren Jahrzehnten als „Mundwerker“, also Sozialarbeiter, unterwegs. Neben zwei Kurzgeschichtensammlungen „Begegnung mit dem Berserker“ (2011) und „Das Leben ist eine Zicke“ (2018) sind fünf Kriminalromane erschienen: „abgedrückt“ (2013), „weißkalt“ (2015), „Tage, die alles verändern“ (2017), „Innere Schreie“ (2020) und „Der Mäzen“ (2023). Von 1996 bis 2008 monatlich Kurzkrimis im Darmstädter Stadtmagazin „Vorhang Auf!“. Seine Zuneigung zum Krimi-Genre entwickelte er insbesondere in der Zeit, als er in verschiedenen Justizvollzugsanstalten tätig war und so Geschichten hörte, die ihn inspirierten – zumal anscheinend nichts unwahrscheinlicher ist als die Realität. Dazu kommt die Liebe zu seiner Wahlheimat Darmstadt. www. krimiautor-ross-darmstadt. de
Frank Schuster Geboren 1969, lebt in Darmstadt. Journalist und Autor; Redakteur des Darmstädter Echo, davor Öko-Test-Magazin und Frankfurter Rundschau. Studium der Germanistik, Anglistik, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt am Main, Marburg und Oxford. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Jüngste Veröffentlichungen: „Odenwald“, Klima- Thriller, 2023; „Sternenfutter“, dystopischer Roman, 2018; „Das Haus hinter dem Spiegel“, Jugendbuch, 2014. facebook/Frank Schuster
Tom Wolff Jahrgang 1962, Journalist und Sänger, aufgewachsen in Norddeutschland, seit Mitte der 80er Jahre Wahl-Hesse, lebt und arbeitet in Darmstadt. Studium der Kunstgeschichte und Filmwissenschaften. Redakteur u. a bei der taz und Frankfurter Rundschau, derzeit beim Darmstädter Echo. Freie Beiträge zu Kultur, Architektur, Reise und Alltag u. a. für Die Zeit, NZZ Folio und Der Freitag. Textet für die Bands „Salon Erika“, „Aloha Bros“ und „La Source Bleue“. Letzte Veröffentlichung auf CD: Salon Erika, „Die Letzten ihrer Art“, 2021.
Iris Welker-Sturm Die Wortstellerin verknüpft Wort, Bild und Objektkunst in Ausstellungen und Text-Konzerten. Studium der Kommunikationswissenschaften. Mehrere Jahrzehnte als Lehrkraft tätig und in der Lehrerfortbildung (Freinetpädagogik). Mitglied der Künstlerinnengruppe GEDOK und der Literaturgruppen Die Kogge und POSEIDON. Veröffentlichungen u. a.: „das unerhörte zwischen. gedichte & mokka kaos“, Hamburg 2014; „aus der stimmhaft. Roman über Luise Büchner“, Frankfurt 2021. Auszeichnungen u. a.: ver. di: Stimmen gegen rechts 2013, Dagmar-Morgan-Preis 2016, Landschreiberpreis 2019. www. wortstellerin. de
Barbara Zeizinger Geboren 1949 in Weinheim, Studium der Germanistik, Geschichte und Italienisch, schreibt Lyrik und Prosa. Redaktionsmitglied bei den Zeitschriften Bawülon und Matrix des Pop Verlages. Ihr Roman „Am weißen Kanal“ wurde ins Italienische übersetzt. Mehrfache Stipendiatin des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Mitglied u. a. in der Europäischen Autorenvereinigung Die Kogge, des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, des Exil-P. E. N. und des PEN-Zentrums Deutschland. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Im Zusammenhang mit der internationalen Lyrikergruppe QuadArt mehrere mehrsprachige Bücher, alle herausgegeben von der polnischen Autorin Małgorzata Płoszewska. Letzte Veröffentlichungen: „Bevor das Herz schlägt“, Roman 2021 und „Schon morgen wird alles gewesen sein“ Gedichte 2023, beide im Pop Verlag Ludwigsburg erschienen. Die Literaturgruppe POSEIDON
. . . wurde aus der Taufe gehoben im Sommer 2005 von den Freunden PH Gruner und Wigand Lange (1946-2021). Ihr Vorhaben: In Südhessen beheimatete Autoren sollten weniger über- als miteinander sprechen. Obwohl das Sprechen übereinander bekanntlich äußerst beliebt ist. Jedoch wenig zielführend, wenn es ums Kennenlernen oder gar ums Kennen geht. So bringt POSEIDON also Lyriker, Essayisten, Erzähler, Romanciers, Dramatiker, Feuilletonisten, Satiriker und sonstige Schreibende an einen Tisch. POSEIDON ist keine Sezession, kein Club, kein Verein, sondern Ideenbörse und Plattform für Austausch, Debatte und gemeinsame Aktion. Die ersten zehn Autoren-Treffen im griechischen Restaurant POSEIDON in Darmstadt gaben der Gruppe ihren Namen.
POSEIDON hat Lesungen an typischen wie ungewöhnlichen Orten umgesetzt, zum Beispiel in Eisenbahnwaggons, in einem Schleichkatzenkäfig (Darmstädter Vivarium), inmitten einer großen Expressionismus-Ausstellung (Mathildenhöhe Darmstadt), bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, im Darmstädter Keller-Klub, in alternativen Kleinkunsttheatern, Kulturzentren und in interdisziplinären Projekten mit Künstlerverbänden wie dem BBK.
POSEIDON gibt es in Buchform, als Hörbuch und im Kunstkatalog:
Die Generation Z ist 2023 in aller Munde. Im Grunde ist es die Generation Smartphone. Geboren zwischen 1995 und 2010, kann sie sich kaum ein Leben vorstellen ohne Smartphone. Oder sich vorstellen, wie es früher war. In der Generation Golf etwa. Sie scheint so weit weg wie die Renaissance. Wie damals das Leben lief, erscheint tatsächlich jedem, der nicht dabei war, fremd. Wie war Leben damals überhaupt möglich? Telefonieren zum Beispiel. Brach man beim Drehen der ulkigen Wählscheiben ständig in Lachen aus? Fand man es appetitlich, speckige Telefonbücher durchzublättern, die sich in den gelben, roten oder grauen Häuschen mit einem Qua- dratmeter Stellfläche befanden, Telefonzelle geheißen, nur um letztlich festzustellen, dass die Seite mit dem richtigen Namen und der passenden Nummer herausgerissen war? Ein Elend. Von den mit Kaugummi verschlossenen Münzschlitzen im Telefonzellen-Wählscheibenapparat oder von den Münzen, die durch ihn immer lotrecht hindurchfielen, gnädig zu schweigen. Oder wie fühlte es sich an, einen Straßenplan einer Stadt auf einem Quadratmeter Papier, kleingefaltet, in der Tasche zu haben statt eines flachen Dings, in dem alle Stadtpläne aller Städte aller Welt drin sind? Und alle Flugpläne und alle Fahrpläne und alle Hoteldaten dazu. Grob unglaubwürdig scheint auch, dass man 1990 nie, auf einer Parkbank zum Beispiel in Castrop-Rauxel sitzend, blitzschnell Texte und Fotos und Grafiken austauschen konnte mit einem Menschen, der zeitgleich auf einer Parkbank in Narvik, Nordnorwegen, saß.
So schnell kann es menschheitsgeschichtlich also gehen mit technischen Prozessen und Etappen, die zum schier Selbstverständlichen in der Grundausstattung des Lebens werden, ja die Qualität von Identität annehmen. Ein Buch mit Smartphone-Storys ist also kein Wunder. Das flache Wunderdings in der Tasche, meist permanent in der Hand, ist zu wichtig geworden. Es schwirren derartig viele Geschehnisse, Geschichten und Anekdoten rund um das Smartphone durch unsere Gesellschaft – von skurril über witzig über ärgerlich bis lebensgefährlich –, dass eine literarische Auseinandersetzung geradezu überfällig ist. Ehrlich gesagt – der Band hätte auch anders betitelt werden können, zum Beispiel so: Das Smartphone als zentrales digitales Werkzeug der zivilisatorischen Moderne. Das Werkzeug würde so zwar exakt benannt, richtig, es wäre jedoch ein Sachbuch geworden. Als didaktisches Buch der mentalen Gesundheitsvorsorge hätte das Buch auch diesen Titel tragen können: Der Einfluss des Smartphones auf Intelligenz, Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen. In diesem Falle wäre es ebenfalls ein Sachbuch geworden, in der thematischen Konzentration auf Kinder und Jugendliche sogar ein recht depressiv stimmendes. Und selbstverständlich, dritte Option, könnte es auch noch wie folgt reißerisch in großen Lettern auf dem Titel prangen: Deformierte Twitter-, Tiktok- und Facebook-Gehirne: Wie ständige digitale Mediennutzung das Denken verändert und die Demokratie gefährdet. Dies wäre das perfekte Buch für Kulturpessimisten, im Grunde sicher auch das erfolgreichste in der Vermarktung – wenn all die technikaffin intelligenten Kulturkritiker nicht gerade mit allen Fingern auf und allen Sinnen in ihren Smartphones wären.
Was auf Umwegen vermittelt: Selbstverständlich war und ist das Smartphone ein digitaltechnischer Sprung vorwärts sondergleichen. Kommunikation, mediale Unterhaltung und jedwede Datenübertragung wurden in Schnelligkeit und Präzision revolutioniert. Kein anderes Adjektiv passt hier besser. Zudem wird die Welt geschrumpft: Das Smartphone ist das Werkzeug einer erfahrbaren Globalität, das alles in den Schatten stellt, was je dem Menschen so leicht und transportabel in Händen lag.
Aber ebenso selbstverständlich ist, dass die Autoren in diesem Band nicht die affirmative Lobpreisung im Sinne hatten, keine Elogen zum Wunderphone verfassen wollten und konnten. Das wäre im besseren Falle langweilig und vorhersehbar, mündete im schlechteren Fall in kritiklose Verabsolutierung. Kulturkritik blickt halt gerne auf die Schatten, die ein neues helles Licht so wirft. Es ist im Grunde wie in der Medizin oder im Journalismus: Mediziner schauen nicht nach den Gesunden und Starken und Schönen, sondern nach den Geschädigten und Kranken – und nicht zuletzt dem Krankmachenden. Im Journalismus wird auch nicht gemeldet, dass auf der Kreuzung X in Y-Stadt tagelang keinerlei Zwischen- oder Unfälle zu verzeichnen waren. Der Journalist meldet den Unfall. Und fragt nach dem Warum. Sind wir als Autoren dieses Buches voreingenommen? Sind wir zu kritisch? Sehen wir das Smartphone zu einseitig? Vielleicht ist die Antwort ein Vergleich: Ähnlich würden die Autoren der Literaturgruppe POSEIDON nämlich auch über Automobile schreiben. Ja, unsere Autos. Deren Erfindung war schließlich ebenfalls eine Revolution, und auch sie verkürzte die Distanzen und schrumpfte, auf ihre Art, die Welt. Alltags- und kulturkritisch gesinnte Schriftsteller würden jedoch weniger Begeisterung regnen lassen über das Design, über Komfort, Antrieb und Schnelligkeit der Automobile, sondern sich dem Verbrauch von Ressourcen widmen, über Emissionen schreiben, über Bewegungsarmut und Verkehrstote, über den Flächenverbrauch von geparktem Blech auf Bürgersteigen – und damit ebenfalls wieder über die Schatten, die im Lichtkegel erst mal nicht zu sehen sind.
Mit dem Titel Smartphone-Storys machen sich Literaten zwar über das technische Gerät her, sie schildern, beschreiben, debattieren und problematisieren jedoch auch all jene Phänomene, die Teile der Gesellschaft gerne pauschal als digitale Modernisierung bezeichnen. Der Begriff versachlicht die epochemachende Wandlung, die mit dem Zaubergerät des Smartphones weltweit vollzogen wurde und wird, als auch die damit angestoßenen, im historischen Vergleich gesehen gravierenden Veränderungen des politschen, gesellschaftlichen, kommunikativen und gesamten zivilisatorischen Prozesses. Weil Schnelligkeit ja so viel gilt: Schnelligkeit ist im Bereich der Digitalität zu einem bipolaren Begriff geworden, zu einem Sehnsuchts- und Schreckensbegriff in einem: Jeder Bürger möchte seinen schnellen Amtstermin oder Zahnarzttermin buchen und die Kinokarte sofort ausdrucken. Viele Jugendliche indes werden bereits psychisch auffällig oder krank vor Angst, in den sozialen Netzwerken des digitalen Lebensraumes irgendetwas zu verpassen. Es geht alles so schnell und es ist alles so scheinbar und gleichzeitig wichtig, dass das Gerät kaum weggelegt und schon gar nicht mal temporär ausgeschaltet werden kann. „Süchtig nach dem Smartphone“ heißen daher Angebote von Drogenberatungsstellen in Deutschland. Das ist konsequent. Auch der religiös inspirierte Raum hat reagiert – mit angepassten neuen Angeboten in der Fastenzeit. Vor zwanzig Jahren wurde für den vierzigtägigen Zeitraum mit Verzichtsübungen zur Vorbereitung auf das Oster-Fest das sogenannte „Auto-Fasten“ propagiert. Es hob das Fasten in technische Sphären. Inzwischen steht auch das „Smartphone-Fasten“ auf dem Programm. Lustig wird es im Netz dann, wenn Smartphonitis, die Droge und Erkrankung, via Smartphone diagnostiziert, erklärt und behandelt wird. „Ablenkungen aus dem Weg schaffen!“, rät etwa eine Plattform, und zwar so: „Wie viele Tabs hast du gerade offen? Unser Smartphone ist, egal bei welcher Beschäftigung, ständig parallel mit am Start. Das sind immens viele Eindrücke, die unser Gehirn verarbeiten muss. Die Folge: wir fühlen uns zerstreut und ausgelaugt. Nutze jetzt diese neue Smartphone-App, die dir hilft, weniger Zeit am Smartphone zu verbringen. Die App lehrt, die Momente zu identifizieren, in denen wir uns ans Smartphone hängen. In fünfminütigen Übungen werden wir dauerhaft in Impulskontrolle, Selbstreflektion, Achtsamkeit und Resilienz gestärkt.“ Eine wunderbare Idee. Es erinnert an die Idee des Teams um Greta Thunberg, die Klimaaktivistin nicht mit einem bösen Flugzeug, sondern an Bord eines Segelbootes über den Nordatlantik nach New York zu bringen für ihre berühmte zornige Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die Rede wurde auf YouTube gestellt und von 5,4 Millionen Menschen auf der ganzen Welt live verfolgt. Das verursachte 422 Tonnen Kohlendioxyd – so viel, wie bei 97 Transatlantikflügen entstehen. Dies offenbart, wie entscheidende Zusammenhänge im Themenfeld Smartphone und Internet generell im Dunkeln bleiben oder ganz bewusst unterbelichtet werden. Alleine die Videos, die im Netz abgespielt werden, erzeugen weltweit so viele Treibhausgase wie das Land Spanien. Und populäre Strea- minganbieter erzeugen so viele Emissionen wie Chile. Jede Whatsapp-Nachricht, jedes zuckende Werbebanner, jedes Selfie, jede Google-Suche und die riesige Tonnage an Mails und Spam im Netz beschäftigen Clouds, also eigentlich Rechenzentren, auf der ganzen Welt. Die sind jeweils so groß wie Shopping-Center auf der grünen Wiese und saugen unendliche Megawatt Strom. Und weil die Prozessoren jedes Watt in Hitze wandeln, braucht es noch weiteren Strom, um die chronisch Überhitzten wieder abzukühlen. Was Wunder, dass das Internet mit all seinen Angeboten zurzeit vier Prozent aller Treibhausgase global verursacht. Der internationale Luftverkehr bringt es übrigens auf 3,5 Prozent.
Von der Cloud zurück zum einzelnen Menschen. Nicht um zu klagen, sondern um bewusst zu machen. Aufschlussreich sind inzwischen viele wissenschaftliche Untersuchungen. Auch ganz schlichte. Etwa die, bei der drei verschiedene Gruppen von Menschen eine Aufgabe am Computerbildschirm lösen sollen, die konsequente kognitive Aufmerksamkeit verlangt. Eine Gruppe darf ihr Smartphone umgedreht auf dem Tisch ablegen, eine weitere muss es in die Hosentasche stecken, eine dritte muss es außerhalb des Testraumes lagern. Letztere erreicht klar die besten Testergebnisse. Die erste hat umgekehrt das größte Handicap: Das Gerät, das da umgedreht liegt auf dem Tisch, es zieht immense Quanten an Konzentrationsfähigkeit ab, da die Menschen stets erwarten, dass Wichtiges und Interessantes geschieht und vermeldet wird. Und sie es – versäumen.
Vielsagend, nicht zuletzt, auch das Echo des Smartphonismus in der bildenden Kunst. Beispiel: Die Malerin Sophie Gogl, 1992 geboren in Österreich, zeigt sich seit geraumer Zeit in ihrer Selbstporträtmalerei angemessen digital sozialisiert. Ob auf dem Bett, auf dem Sofa oder auf der Toilette sitzend – Gogl zeigt Oberkörper und Kopf, ihr Konterfei, stets illuminiert vom Schein des Smartphones, die Augen sind fest auf seine leuchtende Oberfläche gerichtet. So erzählt sie stimmig vom pausenlosen Aufgesogensein durch unentwegte Mitteilungs- und Bilderströme. Und zeigt pars pro toto: Das Werkzeug Smartphone ist auch in der Thematisierung durch die Bildende Kunst in der Welt des 21. Jahrhunderts angekommen.
Mit dem vorliegenden Band bringt die Literaturgruppe POSEIDON das Smartphone als Hauptthema ein in die Literatur. Von den 18 Autoren im Altersspektrum von 18 bis 90 Jahre sind 17 tatsächlich aus Fleisch, Nerven und Blut und mit organischem Zentralen Nervensystem versehen. Die Ausnahmen bilden die Storys Julia und Marc und „Schreibe ein Gedicht“. Sie wurden vom Chatbot ChatGPT (Generated Pre-trained Transformer) verfasst oder mitverfasst. Ja, diese Kostprobe waren wir uns schuldig in einem Band über die digitale Welt samt Ausblicken in die Sphären der Künstlichen Intelligenz und den vielen Befürchtungen und Erwartungen, wie das System KI auch die Buchbranche und das Schriftstellerdasein verändert, aufrollt, umwälzt. Unsere Autoren Marina D’Oro und Marc Mandel haben in einem Online-Dialog dem Chatbot mit wenigen Namen, Begriffen und Sätzen, quasi einem Minimal-Skript, den Auftrag gegeben, anhand dessen doch ein Stück Literatur zu verfassen. Und zackzack waren sie da, die kleinen Werkstücke. Urteilen Sie selbst.
Und nun, zuletzt, zu uns, den Autorinnen und Autoren dieser Anthologie. Auf eines legen wir nämlich alle und ohne Ausnahme großen Wert: auf Sie als die analoge, echt-menschliche Leserschaft mit Interesse, Emotion und Affekt. Und mit dem Spaß und dem Humor, das Phänomen literarisch zu verkosten.
Fritz Deppert
Es
Da lag Es oder Sie, noch wusste er nicht, wie er Es oder Sie ansprechen sollte, schwarz glänzend auf dem Tisch. Im Gegensatz zu einem Taschenspiegel, der mehr oder weniger fröhlich, je nach Tagesform und Grund, warum er aus der Tasche gezogen worden war, darauf bedacht war, seine Umgebung bis ins Detail abzubilden, eine finstere, tückisch glänzende Schwärze. Ein Geschenk seiner Kinder, das er nicht abweisen konnte, weil es gut gemeint war. „In Deinem Alter musst Du erreichbar sein!“, sagten sie in einem Ton aus Sorge und Bestimmtheit. Da er von Unklarheiten nichts hielt, entschied er sich für das neutrale Es und beugte sich über das schwarze Rechteck. Er sah sein eigenes Gesicht, leicht verschwommen aber identifizierbar und düster gefärbt, als blicke er schon aus dem Jenseits zurück. Als er es anlächelte, reagierte es nicht. Dann hörte er ein leises Hallo. Zunächst hielt er das für eine Einbildung. Die Fantasie, über die er in reichem Maß verfügte, spielte ihm wohl wieder einen Streich. Doch dann flüsterte es: „Du musst die Taste an meiner rechten Seite drücken, dann gehöre ich Dir.“ Da er nicht sicher war, ob er wollte, dass das schwarze Etwas ihm gehörte, zögerte er. Dann suchte er die Taste. Neugierig auf neue Erfahrungen war er zeit seines Lebens gewesen. Daran hatte sich auch im Alter nichts geändert. Nachdem er sie, schmal und unscheinbar und gleichsam verborgen, entdeckt hatte, nahm er das Ding in die Hand und drückte die Taste. Er war kein Technikfan. Trotzdem faszinierte ihn, was nun geschah. Farben huschten über die Fläche, bildeten Muster, aus denen Gegenstände wuchsen, Würfel, Kugeln und Säulen. Was er von den ersten Erläuterungen durch einen der Enkel behalten hatte, weil der es ihm eindringlich langsam vorgemacht hatte, war, dass er ein Muster zeichnen musste, einen Längs- und einen Querstrich, die einen rechten Winkel bildeten. „Willkommen“, sagte die Stimme zu ihm, die jetzt aus dem Bild einer Eule sprach. Auch dieses Bild hatte der Enkel in das Gerät hinein gezaubert, weil er wusste, dass Großvater Eulen sammelte. Ein schönes Bild, von Eulen gab es nur schöne Bilder. Die Stimme wirkte zwar einschmeichlerisch, aber kalt. So stand er nun da, das Ding, das Es, in der Hand und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Die Stimme forderte ihn auf, das Bild zu drücken und zu streicheln, dann stünde Es ihm zur Verfügung. Das wollte er eigentlich nicht. Aber die Neugier bewog ihn zu drücken und zu streicheln. Eine Kaskade von Tönen und Bildern prasselte auf ihn ein, so ähnlich wie aus dem Fernsehgerät, wenn er aus Langeweile über die dargebotenen Programme zappte und an Sender geriet, die ihm alles Mögliche verkaufen wollten, ob er es brauchte oder nicht. Mit Hilfe der Fernbedienungen drückte er die Programme weg. Aber was sollte er in diesem Fall machen? Er drückte, er streichelte, die Aufforderungen und Angebote wurden immer zahlreicher und aufdringlicher. In den Werbepausen kam Musik und beschallte seine Ohren. Als schließlich Helene Fischers Stimme ertönte, reichte es ihm. Er packte das Gerät in eine Tüte, zog seine Jacke an und begab sich auf den gewohnten Abendspaziergang, wenn auch früher als sonst. Unterwegs, als er sich sicher war, dass niemand ihn sah, warf er die Tüte in eine Hecke am Wegrand und kehrte erleichtert nach Hause zurück. Keine fremde Stimme empfing ihn, kein Gerät wollte gedrückt und gestreichelt werden. Zufrieden setzte er sich in den Sessel und las in dem Buch, das dort immer in Griffweite lag, in dem Fall ein Aufsatz darüber, wie Erdbeben entstehen. Am nächsten Morgen klingelte es, er öffnete, ein Junge stand vor ihm, etwa zehn Jahre alt, hielt das schwarze Ding in der Hand und sagte: „Das habe ich gefunden, es gehört Ihnen“ und strahlte ihn an. Er überlegte, ob er die Tür zuschlagen sollte, aber als er das glückliche Gesicht des Finders ansah, entschied er sich dazu, das Ding zu nehmen und dem Jungen einen Finderlohn in die Hand zu drücken. Da war Es nun wieder. Er legte es in eine Schublade, um in Ruhe zu überlegen, wie es weitergehen sollte. Doch vom Tag darauf an schellte es mehrmals täglich und ein Paket nach dem andern stapelte sich zuerst in seinem Flur, dann vor der Tür. Den Absendern nach, die er anfangs noch entzifferte, waren es Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Pillen für die Nachtruhe, Bücher mit allerlei Ratschlägen für allerlei Fälle, vom Schlaganfall bis zur Magenverstimmung, von Partnersuche bis zur Altersgymnastik, vom Verhütungsmittel bis zum Stimulator. Dann gab er es auf und rief seine Kinder zu Hilfe. Es war das erste Mal, dass er dies tat, denn sein Ehrgeiz war es, allein zurecht zu kommen. Aber er wusste keinen Ausweg. Sie kamen, schickten die Pakete zurück und blockierten in dem Smartphone alle Werbeangebote. Nun lag Es wieder auf dem Tisch, der schwarze Glanz schien matter geworden zu sein, sein Gesicht spiegelte sich verschwommen und verzerrt und die Aufforderung „Drück mich, streichle mich“ klang leiser und weniger verführerisch. Sie wirkte ein wenig kläglich. Trotzdem verfolgte sie ihn, wohin er in seiner Wohnung auch ging. Zuerst steckte er Es hinter die Bücher. Goethes Faust und E. T. A. Hoffmanns Zauberkünstler sollten es zum Verstummen bringen. Da er jedoch immer genauer hinhörte, sogar die Ohren spitzte, hörte er immer noch die Aufforderung „Drück mich, streichle mich.“ Nur das Ausrufezeichen dahinter hörte er nicht mehr. Als er alte Zeitungen auf den Dachboden brachte, packte er das Ding zwischen die Blätter und ließ es mit ihnen zusammen dort zurück. In der Wohnung war es still, kein Flüstern mehr, selbst wenn er angestrengt horchte; er genoss es. Nach zwei Tagen klingelten die Mansardenbewohner und beschwerten sich. Von seinem Dachboden kämen ununterbrochen Töne, als wäre dort eine Katze eingesperrt. Das störe sie sogar im Schlaf. Also tappte er, sich selbst dabei anknurrend, auf den Dachboden, holte Es und brachte es in den Keller. Das leise Weinen und die Aufforderung „Drück mich“ ignorierte er. Er legte es hinter die Weinflaschen und kehrte in seine Wohnung zurück. Es gelang ihm jedoch nicht, die Stimme und das klägliche Weinen zu verdrängen. Jedes Glas Wein erinnerte ihn. Er musste eine endgültige Lösung finden. Während er noch grübelte, strahlte Arte, sein Lieblingssender, eine Dokumentation über die Nibelungenfestspiele am Wormser Dom aus. Nachdem er die Sendung gesehen und das Fernsehgerät ausgeschaltet hatte, stand sein Entschluss fest. Am nächsten Tag fuhr er nach Worms zu der Stelle, an der angeblich Hagen den Nibelungenschatz in den Rhein geworfen hat, nahm Es aus der Tasche, drückte es und streichelte es, ließ die Bilder und Töne über sich ergehen als wäre er auf einem Jahrmarkt, und warf das Ding, seine Beschwerde „Das kannst du mir nicht antun“ ignorierend, in hohem Bogen in den Rhein. Nachdem er den Dom besucht und die romanische Architektur und ihre stille, beruhigende Frömmigkeit besichtigt hatte, fuhr er nach Hause, nahm das Nibelungenlied aus dem Bücherregal und stellte es in den öffentlichen Bücherschrank in seinem Viertel. Seitdem hat er von dem Es nichts mehr gehört. Die Kinder, die seine unwilligen Reaktionen auf Nachfragen scheuten, zuckten mit den Achseln und wagten ihn nicht mehr zu fragen. Manchmal meinte er, kurz vor dem Schlafengehn, wenn er im Sessel sitzend seinen abendlichen Rotwein trank und die Straße draußen und die Geräte drinnen in der Dunkelheit verstummten, noch ganz leise die Stimme flüstern zu hören: „Drück mich, streichle mich“.
Ein roter Stuhl
Nachdem er sich sicher war, dass er dort bleiben würde, hatte er nach einem Haus am Stadtrand gesucht. Er liebte es, zwischen seinen Arbeitsstunden am Schreibtisch lange Spaziergänge zu machen, um den Kopf frei zu bekommen und dann intensiv weiterarbeiten zu können. Nach Wochen der Suche fand er das, was seinen Vorstellungen entsprach, ein kleines Haus aus den neunzehnhundertfünfziger Jahren in einem Vorort, der sich auf dieser Seite nicht ausgebreitet hatte, weil das Land jenseits der Siedlung bewaldet war und unter Naturschutz stand wegen Wanderdünen, die jedoch schon lange nicht mehr wanderten. Ein schnörkelloser Nachkriegsbau ohne störende Auffälligkeiten, ein weißgetünchtes Viereck folgte auf das andere weißgetünchte Viereck. Ein alter, allein lebender Mann hatte es bewohnt, seine Frau war vor Jahren verschwunden, erzählte ihm die Tochter. Sie kümmerte sich um ihn und zwang ihn schließlich, als er gehunfähig und zeitweise dement geworden war, in ein Heim umzuziehen, obwohl er sich mit Händen und Füßen dagegen wehrte. Da sie Familie hatte und berufstätig war, musste sie so handeln, obwohl es ihr, wie sie versicherte, schwer fiel. Sie hatte ihn durch die bereits leergeräumten Räume geführt und er hatte ihr ohne Zögern zugesagt, es zu kaufen. Der Vertrag war inzwischen unterschrieben und vom Notar beglaubigt. Nach dem Treffen in dessen Büro wünschte sie ihm mehr Glück mit dem Haus, als sie es gehabt hätte. Als er beim Verabschieden ihr zartblaues Kleid bewunderte, errötete sie und antwortete: „Sagen Sie doch einfach Elvira zu mir.“ Jetzt gehörte das Haus also ihm. Die Schlüssel in seiner Hand belegten es. Er öffnete die auf den ersten Blick aus Metallgittern und undurchsichtigem Glas bestehende Tür, trat ein. Den größten Raum mit Blick zum Wald hin hatte er als sein Arbeitszimmer vorgesehen. In seiner Mitte stehend, wartete er, bis der Hall seiner Schritte sich verloren hatte und begann, ihn in Gedanken einzurichten. An der Innenwand fehlte eine Steckdose. Die würde er legen lassen müssen, weil er für die vielen Geräte, die er besaß – Computer, TV-Gerät, Musikanlage, Internetradio – eine Stromquelle brauchte. Als er sich bei der Schlüsselübergabe gewundert hatte, wieso diese Wand ohne Steckdose war, hatte Elvira einen flüchtigen Blick darauf gerichtet und kopfschüttelnd gesagt, dass sich ihrer Erinnerung nach dort sogar eine Doppelsteckdose befunden hätte. Er sah sich um in dem Zimmer, in dem er die meiste Zeit verbringen würde. Etwas störte ihn, einmal wegen seiner Farbe, braun und rot, und zum anderen, weil es sich als einziger Gegenstand in dem ansonsten leeren Raum befand: In der Mitte des Zimmers stand ein Stuhl. Roter, verblichener Stoff überzog Sitz und Armlehnen, die Holzteile, die aus dem Rot hervorragten, waren fleckig braun. Der ursprüngliche Lack war durch die Hände des ursprünglichen Besitzers abgeschabt. Vielleicht hatte der alte Mann dort darauf gewartet, dass der Umzugswagen zur Abfahrt bereit war, hatte sich erhoben und war mühsam, kaum die Füße von der Erde hebend, am Arm der Tochter zu ihrem Wagen gegangen und beide hatten den Stuhl vergessen. Also stand er da. Er wirkte verbraucht, abgenutzt, gealtert, obendrein täuschte er Qualität vor, die, nachdem der allgemeine Wohlstand ausgebrochen war, in den kleineren Besitztümern imitiert wurde. Man hatte überlebt und war wieder wer. Immerhin war er nicht aus den Fugen gegangen. Das Haus gehörte ihm, demnach auch dieses Zimmer und auch dieser Stuhl. Dass der Stuhl mitten im Zimmer stand, irritierte ihn. Seiner Erfahrung nach hätte er entweder am Fenster stehen sollen, damit der Besitzer den Auszug oder die nicht stattfindende Dünenwanderung beobachten konnte, oder in Türnähe, um dort darauf zu warten, abgeholt zu werden. Als er ihn zu einer dieser Stellen, nämlich dem Fenster, rücken wollte, ließ er sich nicht bewegen, so, als wäre er am Boden befestigt. Er kniete sich und suchte nach Befestigungen, konnte jedoch nichts finden, was darauf hindeutete. Als er sich erhob, knackten die Kniegelenke und signalisierten ihm, dass er nicht mehr der Jüngste war und solche Bewegungen unterlassen sollte. Er setzte sich auf den Stuhl, legte die Arme auf die Lehne, sah auf die leeren Wände und versuchte sich vorzustellen, wie er sie mit Möbelstücken und Bildern ausstatten könnte. Es gelang ihm nicht, seine Gedanken darauf zu konzentrieren. Sie schienen sich zu verselbstständigen und ihn auf eine Reise mitzunehmen, die aus verschwommenen Bildern bestand, denen er keinen Sinn zuordnen konnte. Wahrscheinlich spielte ihm die Fantasie einen Streich und er sah die Reihe der Vorbewohner durch das Haus pilgern, um sich zu verabschieden. Dann hörte er ein leises Summen, das aus der Wand zu kommen schien. Nachdem er sich erhoben hatte, war es nicht mehr zu hören. In den kommenden Tagen war er damit beschäftigt, seinen beweglichen Besitz in das Haus zu bringen, die Papiere, die kleinen Gegenstände, die Bücher, gerahmte Fotografien und vor allem die Geräte, die er nicht in fremde Hände geben wollte. Die Möbelstücke brachte eine Spedition. Er hatte einen vergilbten Grundriss erhalten, wahrscheinlich aus dem Bauantrag, und danach die Einrichtung vorgeplant, indem er Geräte und Möbelstücke mit dem Maßband auf ihre Breite überprüfte und die Zahlen mit Bleistift in den Plan an die Stelle schrieb, an der er den Gegenstand platzieren wollte. Irgendwem, vielleicht auch ihm, musste ein Messfehler unterlaufen sein, denn das zukünftige Arbeitszimmer erwies sich innerhalb der Seitenwände um circa 20 Zentimeter schmaler als im Plan angegeben. Doch die Gegenstände ließen sich um diese fehlenden Zentimeter zusammenrücken. Endlich befand sich alles an seinem Platz. Er setzte sich wieder in den Stuhl, da er sich mitten im Zimmer stehend anbot, um mit einem Blick rundum zu überprüfen, ob er mit dem Ergebnis zufrieden war. Kaum saß er dort, hörte er wieder das Summen. Es kam aus der steckdosenlosen Wand. Als er sich erhob, um darauf zuzugehen, konnte er das Geräusch wiederum nicht mehr hören. In den folgenden Tage beschäftigte er sich mit Einräumen und Umräumen, Aufstellen der Bücher, Ausbreiten der aktuellen Papiere auf dem Schreibtisch. Er vergaß das Summen, vergaß sogar den Stuhl, so als gehöre er dazu. Da er noch Fragen zu den Kellerräumen hatte, unter anderem zu einer etwa zwei Meter langen Rolle mit Plastikfolie, rief er Elvira an, um ihr die Fragen zu stellen. Sie konnte ihm zufriedenstellende Auskünfte geben; zu der Rolle meinte sie, sie stamme wohl noch aus der Bauzeit und er solle sie einfach wegwerfen. Offensichtlich war sie erleichtert, dass der Verkauf des Hauses reibungslos vonstatten gegangen war und wurde gesprächig. So erfuhr er, dass ihre Mutter vor Jahren den Vater wegen eines anderen Mannes verlassen hatte und zwar sehr plötzlich. Sie brach alle Kontakte ab. Versuche, sie aufzufinden, waren erfolglos. Zu diesem Zeitpunkt lebte die Tochter bereits nicht mehr im Haus; sie hatte eine eigene Familie, darunter ein Baby, das alle ihre Kraft forderte und aufzehrte. Zwar konnte sie nach einiger Zeit den Mann ausfindig machen, in den sich ihre Mutter verliebt hatte, aber er erklärte zu ihrer Überraschung, dass ihre Mutter zu dem Treffpunkt damals nicht erschienen war und sich auch danach nicht mehr gemeldet hätte. Ihr Handy wäre auf Anrufbeantworter geschaltet gewesen und seine Versuche, sie bei ihrem Ehemann entdecken zu können, wären erfolglos geblieben, obwohl er tagelang das Haus beobachtet habe. Schließlich hätte er aufgegeben. Vater und Haus wären ihr zu der Zeit fremd geworden, ohne dass sie es erklären könnte. Vielleicht, weil sie das Gefühl hatte, dass der Vater nicht mit ihr über die Mutter sprechen wollte und auch nicht besonders erfreut schien, wenn sie ihn besuchte. Es sei auch nie eine Verbindung zwischen ihm und seiner Enkelin, ihrer älteren Tochter, entstanden, er habe abweisend gewirkt und es damit begründet, dass sie seiner verschwundenen Frau allzu sehr ähnlich sei. Zum Beispiel habe er sie beide nicht ins Haus gelassen, wenn sie ein blaues Kleidungsstück trugen; sogar auf ein blaues Haarband habe er reagiert und die Enkelin erst eingelassen, nachdem sie es ablegt hatte. Folglich besuchten sie ihn selten. Erst seine altersbedingte Hilflosigkeit habe sie wieder öfter im Elternhaus zusammengebracht. Die Frage nach dem roten Stuhl beantwortete sie mit dem Vorschlag, ihn in den Sperrmüll zu geben. Er erinnere zu sehr an die letzten Jahres des Vaters, den sie bei ihren wenigen Besuchen stets in diesem Stuhl antraf, und sie habe jedes Mal den Eindruck gehabt, als enthalte dieser Stuhl ein Geheimnis, das er vor ihr verberge. Nach dem Gespräch untersuchte er den Stuhl, ohne etwas Überraschendes finden zu können. Er tastete die zum Teil verschlissenen Polsterungen ab, drehte und wendete ihn, stellte ihn auf den Kopf, ohne sich zu wundern, dass er ihn plötzlich bewegen konnte. Als er sich danach setzte, hörte er wieder das Summen. Während er sich auf das Geräusch konzentrierte, spürte er unter der rechten Hand eine raue Stelle auf dem Holzteil der Lehne und entdeckte eine in das Holz geritzte Zahl. Der Länge nach war es kein Code oder eine Bankgeheimzahl oder dergleichen. Ein Datum konnte es auch nicht sein, die Punkte fehlten. Die ersten Ziffern 04917 kamen ihm bekannt vor. Es war eindeutig eine Handynummer. Er zögerte anzurufen, setzte sich stattdessen an seinen Schreibtisch, versuchte einen angefangenen Text weiterzuschreiben. Seine Gedanken kehrten immer wieder zu der eingeritzten Nummer zurück. Auch die Blicke aus dem Fenster auf die über die Düne herüber rotbraun leuchtenden Stämme der Kiefernbäume vermochten es nicht, ihn abzulenken. Also erhob er sich, ging zu dem roten Stuhl zurück, setzte sich, nahm sein Smartphone und wählte die Nummer. Ein Klingeln erschreckte ihn, es war deutlich zu hören und es kam zweifelsfrei aus der Wand. Als es in seinem Phone piepste und eine Stimme ihn aufforderte, eine Nachricht zu sprechen, schaltete er hastig ab. Er sprang auf, lief hin und her, setzte sich wieder und wählte die Nummer erneut. Wieder kam das Klingeln aus der Wand. Jetzt stellte er sich dorthin und drückte die Wiederholungstaste. Er konnte es nicht überhören. Als er ein Ohr an die Wand presste, hatte er das Gefühl, ein Telefongerät befände sich direkt neben seinem Kopf und sende aufdringlich laute Klingeltöne. Auch die Ansage, die ihn aufforderte, seine Nachricht zu sprechen, dröhnte in sein Gehör, als stünde die Sprecherin neben ihm. Nun musste er sich bewegen, hin und her, im Zimmer, dann vor dem Haus, um das Haus herum, und die nächsten Schritte bedenken. Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, kehrte er zurück, überprüfte durch wiederholten Anruf seinen Eindruck. Es war keine Einbildung. Der Ton war real und genau zu orten. Daraufhin stand sein Entschluss fest. Zuerst klopfte er die Wand ab und stellte fest, dass sich dahinter offensichtlich ein Hohlraum befand. Dann holte er einen Hammer und schlug auf sie ein. Sie zeigte Risse, bröckelte, ein Loch tat sich auf. Hinter dem Loch nur Dunkelheit und auch die herbeigeholte Taschenlampe fand nur Hohlraum und Teile einer Plastikfolie. Noch am gleichen Nachmittag bestellte er einen Hausmeisterdienst. Die Nacht verbrachte er unruhig, wenn er einschlief, träumte er, er wäre in einer Kiste eingesperrt, könnte nicht heraus und auf seine stummen Angstschreie reagierte niemand. Am Vormittag kamen zwei Männer in blauer Arbeitskleidung, besahen die Wand, klopften daran, wie er es getan hatte, und erklärten, hinter der gesamten Wand befände sich tatsächlich ein Hohlraum; mit seinem Einverständnis würden sie diese offensichtlich nur aus verputzten Platten bestehende Verkleidung entfernen. Er nickte, setzte sich in den roten Stuhl und sah zu. Die beiden räumten die von ihm aufgestellten Möbelstücke weg, legten Folie aus, befeuchteten die Wand wegen der Staub- entwicklung, und schlugen zu. Stück für Stück brach sie heraus und enthüllte eine weitere Wand. Als sie zu der Stelle kamen, an der er das Klingeln geortet hatte, hörten sie auf und erklärten, im Zwischenraum befände sich ein größerer Gegenstand. Dann lösten sie mit vorsichtigen Hammerschlägen nur noch kleine Stücke. Zum Vorschein kam eine mehrfach mit einer Folie umwickelte Leiche, dem noch erkennbaren, wenn auch teilweise vermoderten blauen Kleid nach eine Frauenleiche. Sie schien ihn anzustarren. Nachdem sie sich von ihrem Schreck erholt hatten, sowohl er als auch die beiden Handwerker, riefen sie die Polizei und gaben ihr eine genaue Beschreibung des Vorgangs. Sie kamen zu mehreren, Uniformierte und welche in weißen Kitteln, und untersuchten den Fund. Dabei sah er, dass eine Schnur aus der Folie heraus und zu der Doppelsteckdose an der inneren Wand führte. Ein Ladekabel. Beim Öffnen der Folie kam ein Handy älteren Baujahres zum Vorschein. Es war an das Kabel angeschlossen. Er berichtete den Beamten von seinen Anrufen, die baten ihn daraufhin, erneut die Nummer zu wählen und, obwohl sie es erwartet hatten, erschraken alle, als das altertümliche Gerät laute Klingelzeichen von sich gab. Inzwischen traf auch die von ihm benachrichtigte Tochter Elvira ein und bestätigte, dass ihre Mutter das blaue Kleid getragen hatte, als sie verschwand. Auch die Handtasche, die in die Folie mit eingewickelt war, erkannte sie. Da sich dort der Ausweis der Mutter fand, stand fest, wer die Tote war. Die scheinbare Gefasstheit Elviras war zu Ende, sie rannte schreiend aus dem Haus. Einer der Beamten drückte ihm ein Protokoll der polizeilichen Untersuchung in die Hand und bat ihn, es zu unterschreiben. Inzwischen transportierten die Männer in den weißen Kitteln die Leiche mitsamt der Folie ab, um in der Pathologie die Todesursache feststellen zu können. Nur er und die beiden Handwerker blieben vor der heruntergeschlagenen Wand zurück. Sie baten ihn um eine Pause. Auch sie waren betroffen von dem, was sie vorgefunden hatten. Doch sie versprachen, am nächsten Tag wiederzukommen, den Schutt wegzuräumen und die zum Vorschein gekommene Wand herzurichten. Er gab ihnen beim Verabschieden den Auftrag, sie zart blau zu streichen, dann setzte er sich in dem plötzlich totenstillen Raum in den roten Stuhl und versuchte, das Erlebte zu sortieren und zu verkraften. Danach legte er ein unbeschriebenes Blatt Papier auf die Schreib- unterlage seines Arbeitstisches und beschriftete es schwungvoll mit einem einzigen Wort: Elvira. Anschließend stellte er den Stuhl auf die Straße und schloss das Haus ab, als könnte er auf seinen vier Holzbeinen zu ihm zurückkehren wollen.
Iris Welker-Sturm
Smart brain for free
Zur Zeit der Pandemie habe ich das Spielen auf dem Smartphone entdeckt, traditionelle Brett- und Kartenspiele, die ich sonst mit Freund! nnen spielte, kann man hier gegen den Computer spielen. Es gibt sie kostenlos, nimmt man die allgegenwärtige Werbung, die Datenveräußerung und die entstehenden Stromkosten in Kauf. Von Aufforderungen wie „Zeit, dein Gehirn zu trainieren“ oder auf die Empfehlung „von Ärzten“ lasse ich mich zur „daily challenge“ verlocken. So habe ich die Herausforderung für den 14. Februar angenommen – „füllen Sie das Herz für IQ 140+“ – das Display beglückwünscht mich mit einem Sternchen, obwohl ich beim ersten Mal gescheitert bin. Auf die Aufforderung „spiel das und bleib scharf“ hingegen habe ich mich nicht eingelassen; ich war mir nicht sicher, wie scharf ich bereits bin und wie weit ich in dieser Hinsicht gehen will. Die so genannten Reisen, bei denen man mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad von level zu level turnt, bergen Suchtgefahr. Über diese Schiene und permanente Belobigungen lässt man sich fast unbemerkt zu Bezahlvarianten locken. Die schrägen Übersetzungen und Hinweise belustigen mich anfangs. Da wird ein „gewinnendes Spiel“ angepriesen, man verspricht mir „hektarweise Spaß“, wenn ich „meinen Drachen entwickle“. Beim Skattreff kann ich „Hinterhand“ spielen. Ich kann prüfen, ob ich etwa ein „Schläfenlappengehirntyp“ bin, und „Easy brain“ schätzt mein Gehirnalter auf 35 – ich kann mich nicht entschließen, ob ich versuchen soll, mich weiter zurück zu entwickeln. Neben allgemeiner Werbung werden eine Unzahl weiterer Spiele angepriesen – zunächst meist „for free“. Nicht immer kann ich das Spielerische nachvollziehen, wenn z. B. eine frierende Frau mit Kind im Schneetreiben vor sich hin zittert, weil sie von Ehemann oder Richter aus dem Haus gewiesen wurde. Ich könnte sie oder auch die spärlich bekleidete junge Frau, die über einem Feuer hängt, retten, wenn ich schnell genug die richtigen Klötzchen verschiebe, gibt man mir zu verstehen. Bei fast jeder Spielewerbung bin ich gezwungen, passiv mitanzusehen, dass eine Katastrophe nicht verhindert wird oder dass das Opfer gar zu Tode kommen wird, wenn ich mein begonnenes Spiel weiterspielen will. Bei „royal match“ gibt es sogar eine Königsfigur, einsam und von Unbill verfolgt, die völlig hilflos auf Rettung von mir wartet. Er winkt, mit der flachen Hand versucht er die ihn verfolgenden Speerspitzen abzuhalten und gleichzeitig wegzulaufen. Der nächstfolgende Werbespruch „the sneaker makes the man“ lässt mich vermuten, dass er nur nicht die richtigen Schuhe gewählt hat. Wie er wohl auf den Slogan „bleiben Sie den ganzen Winter über trocken“ reagieren würde, wenn ihm in einer anderen Folge Ertrinken droht? Aber vielleicht ist ja „das Besondere näher als wir denken“ oder aber wir denken nicht weit genug. Über die Methode, die das Spiel „rise of Empire“ empfiehlt, konnte ich noch verwundert den Kopf schütteln und die imperialistische Haltung beklagen, mit der der Held einen Menschen aus dem Wasser zieht und ihn umgehend für sich schuften lässt, ihn offenbar auch zur Vermehrung heranzieht, oder woher kommen auf der einsamen Insel plötzlich die zahlreichen Frauen? Als Kohorte kommandiert sie der Held zur Feldarbeit. Im Trailer erlebt man sie nur gebückt. Erschreckt haben mich dagegen in letzter Zeit vermehrt auftauchende Spiele anderer Art. Eines stellt zum Beispiel die provokante Frage „Was machst du so, um dein Heimatland zu verteidigen?“ und die Antwort ist: „Ich spiele als x-Land … ich baue Raketen … Da kommen Schiffe direkt auf uns zu … aber meine heftigen Raketenbomber werden mit denen schon fertig werden“ – und dann der Hinweis „call of war – world war II – install now“. Sie heißen „top war battle time“, „stormshot“ oder „total battle“ und ich werde aufgefordert „defeat all your enemies“ und „start now“. Der Fußballreporter neulich hatte wohl Ähnliches gesehen, als er mehrmals von „wegverteidigen“ sprach. Ich sehne mich nach Spielanweisungen zurück wie „erst denken, dann ziehen“. Vielleicht kann ja die zwischen den Kriegsspielen platzierte andere Werbung zum Denken anregen: „Sterbegeld ab 6,31 € mtl – mit ANNA – Mutterliebe versichern“.
Schlüsselrolle
Seinen Wohnungsschlüssel hatte sie ihm zurückgeschickt, um ihre Worte zu bekräftigen. Sie kann und will nicht so einfach auf Freundschaft umschalten, wie er sich das vorstellt. Das längliche Briefkuvert blau, die Farbe schien ihr in mehrfacher Hinsicht passend. Papierschnipsel der letzten nicht eingelösten Versprechen polsterten aus, ein langer Klebestreifen verschloss das Kuvert. Einschreiben mit Rückschein, so würde sie wissen, dass und wann die Sendung angekommen ist. Ein klarer Schlussstrich. Es war alles gesagt. Nun würde sie Ruhe haben.
Sie hatte sich getäuscht. Gegen 23 Uhr am folgenden Abend erschien ein Foto auf dem Display ihres Smartphones. Es zeigt die Rückseite eines offenbar geöffneten blauen Briefumschlags, nachlässig wieder verschlossen mit zerknittertem Klebestreifen, schräg über die Kuvertklappe geklebt. Da hatte sich jemand dran zu schaffen gemacht. Die beigefügte Nachricht fragte, ob es richtig sei, dass der Brief „nur mit einem Tesastreifen gesichert“ gewesen sei. Leicht irritiert, rafft sie sich zu einer flapsigen Antwort auf: „Nein, zugeklebt war er auch.“ Die folgende Nachricht erwischt sie schon halb im Schlaf. Es habe Scherben gegeben, er habe sich an der Hand verletzt und blute. Zusatz mit Sternchen „Briefinhalt – nur die Schnipsel der Einladungskarten.“
Was war das Ziel dieser Nachricht? Sollte sie jetzt Mitleid bekunden? Hatte sie den Brief nicht gut verschlossen? Dann hätte ihn der Mann am Postschalter doch aber wohl nicht so angenommen. Konnte jemand den Schlüssel herausgenommen haben? Dann hätte er doch wohl die Spuren zumindest zu verwischen versucht oder gleich den ganzen Brief verschwinden lassen. Es war spät in der Nacht, aber an Schlaf nicht mehr zu denken. Vielleicht wollte er ihr nur ein schlechtes Gewissen machen. Verwirrt ließ sie die Nachricht ohne Antwort, schaltete auf stumm. Der Eindruck verdichtet sich, als sie am nächsten Morgen die dritte Nachricht liest: „Ich sehe grade, dass auf der Vorderseite Einschreiben mit Rückschein vermerkt ist – ich habe keinen Empfang quittiert – von daher meine Frage, warum Einschreiben mit Papierschnipseln, ein einfacher Brief hätte es doch auch getan.“ Sie soll offenbar zu einer Antwort gedrängt werden. Wenn der Schlüssel nicht im Brief war, wieso spricht er dann von „nur“ und „gesichert“? Sie hatte doch weder im Brief, noch in einer Nachricht etwas vom Schlüssel erwähnt. Jetzt ist sie doch froh, dass sie den Brief nicht selbst eingeworfen hat und wird erst einmal die Rückmeldung der Post abwarten.
Sie entschließt sich zu einer hinhaltenden Antwort: „Ich habe meine Gründe.“ Die Fragen, die ihr durch den Kopf gehen, lassen sich nicht so leicht abstellen. Hatte der Postbote etwa die Sendung gar nicht quittieren lassen und lediglich in den Postkasten gesteckt? Zwei Tage gingen ins Land. Dann endlich von der Post die Mitteilung, dass der Brief drei Tage davor dem Empfänger Rudi Kramers zugestellt und ordnungsgemäß vom Empfänger quittiert worden sei. Die Unterschrift, leicht krakelig, lesbar als Rudi Kramer. Von Beschädigung oder „geöffnet von der Post“ stand da nichts. Wieder setzt das Gedankenkarussell ein: Er hatte doch geschrieben, er habe keinen Empfang quittiert? Sollte der Postbote ihn nicht angetroffen haben und zu faul gewesen sein, das Schreiben zur Poststation zu bringen? Reichlich unwahrscheinlich, dass der es auch noch selbst unterzeichnet haben könnte. Aber wenn jemand den Schlüssel entnommen hat, hätte er ja die Adresse und könnte sich jederzeit Zutritt zu seiner Wohnung verschaffen. Müsste bei offensichtlicher Beschädigung nicht der Empfänger protestieren und nicht unterschreiben? Hatte etwa gar ein Nachbar oder Fremder unterschrieben? Sie vergleicht die Unterschrift mit früheren Signaturen ihres Expartners. Die wenig ausgeschriebene Handschrift passt; das R zu Beginn ist ein wenig ungelenk und größer als sonst; und es fällt ihr auf, dass am Ende des Nachnamens ein s fehlt. Sowas merkt ein eiliger Postbote vielleicht nicht.
Füße stillhalten. Nicht provozieren lassen. Sie ist sich mittlerweile fast sicher, dass der Schlüssel sehr wohl im Brief war, auch, dass er ihn entgegengenommen hat und verärgert war. Jetzt will sie sehen, wie weit er das böse Spiel treibt. Sie schickt ihm ein Foto des Rückscheins und empfiehlt, falls er das nicht geschrieben habe, zur Polizei zu gehen. Und tatsächlich, er schreibt, das werde er tun, wenn er in den nächsten Tagen zurück sei von seiner Reise. Aber vorher fragt er noch einmal unter seinem Nickname an, vorher wolle er doch noch wissen, ob er nur Unterschriftenfälschung oder auch Diebstahl anzeigen solle. Dies neuerliche Insistieren bestärkt sie. Jetzt soll sie wohl Angst haben, dass jemand bei ihm einbrechen könnte. Wenn er wirklich befürchten würde, dass jemand seinen Schlüssel entwendet hat, würde er wohl kaum so ruhig bleiben und verreisen. Sie kennt seine leicht aufbrausende Art.
Er kennt sie und ihre üblichen Reaktionen wohl auch. Das Grübeln kann sie nur schwer abschalten. Da fällt ihr eine Story ein, die er ihr mehrmals kopfschüttelnd erzählt hat: Von offizieller Seite sei er darauf hingewiesen worden, dass seine Unterschrift nur mit vollem Namen gültig sei, so wie es im Pass steht: Das wäre Rudolf-Dietrich Kramers und auch der Bindestrich sei Bestandteil seines Namens. Sie erschrickt. Sie traut ihm zu, dass er lügt, sich solche Winkelzüge ausdenkt und sie auf diese Art unter Druck setzen will. So viel zum Freundschaftsangebot. Aber der Polizei würde er wohl kaum einen solchen Bären aufbinden wollen und können. Bevor er am Ende vielleicht noch einen Einbruchdiebstahl vortäuscht, blockiert sie ihn auf allen Kanälen.
Ewart Reder
Der Spiegel der Doria G.
In dem gemütlichen und abwechslungsreichen Land Analogonien lebte einst ein junger Prinz ein landesübliches Leben: gemütlich und abwechslungsreich. Ihm fehlte nichts von dem, was ihm Freude bereitete, auch nichts von dem anderen, das zum Leben gehört, das die Freude nicht zu groß werden lässt. Nur eine Frau hatte er noch nicht gefunden und darum reiste er viel, weil er dachte: Alle sehen heißt auch die Richtige sehen. Tatsächlich war es eine Reise, seine dreihundertsiebzehnte, die den Prinzen in das Land Virtu Al Virtus und dort zu einer auf den ersten Blick bereits unentrinnbaren Frau führte. Sie hieß Prinzessin Doria G. (Name von der Redaktion geändert) und war eine jener Frauen, deren sichtbare Reize dadurch ins Unermessliche gesteigert werden, dass hinter ihnen noch eine Zugabe zu liegen verspricht, die, zum Sichtbaren addiert, unermesslich sein muss, weil sie mit jedem Reiz, den die Frau nach und nach offenbart, immer mitzuwachsen scheint, sodass das Versprechen nie abnimmt, ja, nicht einmal gleichbleibt. Um ein Beispiel zu geben: Der Rücken der Prinzessin Doria erschien dem Prinzen als die Brücke ins Paradies. Er konnte sich keine anmutiger geschwungene Verbindung zwischen Kopf und Hintern einer Frau vorstellen als die unter Dorias Kleid sich abzeichnenden dreiunddreißig Wirbel. Aber eine Brücke führt eben wohin. Und ein gebeugter Rücken ist nicht alles, was ein Rücken sein kann, dachte der Prinz jedes Mal, wenn er Dorias Rücken betrachtete. Denn Doria saß immer vorgebeugt. Selbst wenn sie einmal stand, beugte ihr Rücken sich vor, sodass eigentlich nur Dorias Beine standen, nicht Doria insgesamt, vielmehr Dorias Oberkörper auch im Stehen vorgebeugt auf ihren Beinen saß wie auf jenem Sofa, auf dem Doria sonst den ganzen Tag saß. Und was machte Doria in dieser Haltung beziehungsweise was machte, dass Doria diese Haltung zu ihrer Lebensgrundhaltung gemacht hatte? Es war ihr Zauberspiegel, in den Prinzessin Doria den ganzen Tag sah, ein mittelkleiner rechteckiger Handspiegel, der Dorias Erwartung an das Leben vollständig enthielt. Schade, dachte der Prinz, dass ich diesen Rücken noch nie habe auseinanderfahren sehen wie eine Schlange, die sich erinnert daran, eine Schlange zu sein, die sich erinnert daran, eine Schlange zu sein, die sich erinnert ... Aber zurück zu dem Spiegel. Noch ein anderes Problem machte der unserem analogonischen Prinzen. Er wusste nämlich nicht, wie seine erstmalig geweckte Liebe (die er zugleich für die letzte seines Leben hielt) einer Frau mitgeteilt werden konnte, die noch nicht mal sein Gesicht, geschweige denn die darin abgezeichneten Liebesgefühle anguckte, weil sie nur immer in den Spiegel sah. Alles hatte der Prinz versucht, Händeklatschen, Zwicken, Stricknadelstiche, einen Chinaböller direkt am Ohr der Prinzessin gezündet – vergebens. Ihm war klar: Er musste einen anderen Weg gehen zum Auge und dahinter zum Herzen von Prinzessin Doria, und er war bereit diesen Weg zu gehen. So sicher das Kamel durch das Nadelöhr gehen muss (weil das Gleichnis sonst nicht funktioniert), so sicher würde er ins Innere des Zauberspiegels vordringen, weil Prinzessin Dorias schöne Augen darauf und auf nichts sonst in der Welt ruhten. Zuerst atmete er ganz tief aus, das verkleinerte seinen Körper schon mal um zehn Prozent. Dann hielt er die Luft einfach an und weigerte sich wieder einzuatmen. Das brachte noch mal fünf Bonusprozente, wegen Kühnheit. Er aß nicht mehr, trank nicht mehr, aber das Vollprogramm, ohne Nachtbulimie wie beim Ramadan. Satte dreißig Prozent für dreißig Tage gabs dafür. Am Ende kaufte er sich dreißig gebrauchte Computertastaturen, knipste die Minustasten raus und spülte eine nach der anderen mit „Doktor Alberichs Verkleinerungswasser“ durch die Gurgel in den eigentlich dafür schon zu kleinen Magen. Der Zoomeffekt brachte den Durchbruch. Mädchenfingergroß stand der Prinz neben dem Zauberspiegel, den Prinzessin Doria für eine Sekunde aus den Augen verloren hatte. Aber was jetzt? Wie rein in das Ding? Und genau das, was so unmöglich aussieht – das war in derselben Sekunde schon passiert! Verrückterweise. Der Zauberspiegel fand nämlich, dass der Prinz mit seiner Liebesdiät die Voraussetzungen eines Zauberspiegelinhalts nach dem Gesetz von Virtu Al Virtus bereits erfülle: Verrücktheit. Und machte keine langen Anstalten, machte einfach auf. Beam-Bang nennt man das. Der Prinz war drin. Bildschirm an und da lächelte er. Und Prinzessin Doria war sofort weg. Also hin. Sie wollte sofort heiraten. Da passierte aber etwas, das Prinzessin Doria in ihrem Zauberspiegel noch nie passiert war. Plötzlich stand ein anderer Mann neben dem analogonischen Prinzen und behauptete, er sei der eigentliche Prinz aus Analogonien und der andere sei ein Fake. Der Mann aber, der dies behauptete, war der überhaupt unattraktivste Mann, den der Zauberspiegel der Prinzessin jemals für ein Date angeboten hatte. Er sah aus wie ein Baby, das, ohne zwischendurch ein Mann gewesen zu sein, schon ein Greis geworden war, also total weiche Haut, aber komplett in Falten, mehr Teebeutel als Mensch. Und als ob das wichtig gewesen wäre, hatte er noch nicht mal ein Gesicht. Die Prinzessin schrie vor Verwirrung. Was war denn hier los? Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es die Liebe wirklich gab, aber jetzt wusste sie es ja und zugleich wurde behauptet, der, den sie liebte, existiere gar nicht? Sie hätte beinahe den Zauberspiegel ausgemacht, so verwirrt war sie. Der angeblich gefakte Prinz machte jedoch etwas ganz Einfaches und das Problem löste sich dadurch auf. Der Prinz griff nach dem Mann, der das Ungeheuerliche behauptet hatte, packte ihn an zwei Falten, die man für Ohren hätte halten können, küsste ihn mitten in das, was von der Lage her das Gesicht hätte sein können, falls vorhanden. Und im selben Moment war der Teebeutelgestaltige weg und nur noch der echte und einzige Prinz blieb übrig. Genauso toll wie vorher sah er aus und von manchen Stellen seines Körpers strahlte für Sekundenbruchteile eine kleine „100“ auf, in hellblau, in gelb, in rosa, in hellgrün, verblasste dann wieder und ließ nur den appetitlichsten Körper zurück, den Prinzessin Doria in ihrem jungen Leben je gesehen hatte. Gleich wollte sie wieder heiraten. Und jetzt wollte sie auch küssen. Das war aber nicht so einfach. Öffnete sie die heiß an der Zauberspiegeloberfläche haftenden Lippen, so vergrößerte der Prinz sich, statt gut zu schmecken. Schloss sie die Lippen schreckhaft, so verkleinerte der Geliebte sich, was ihr noch viel weniger gefiel. Mit der Zunge erreichte sie gleich gar nichts als unangenehm elektrische Empfindungen – nass wie die Tränen, die bald von außerhalb des Bilds über den Zauberspiegel gelaufen kamen. Es war ihr bislang größter Frust. „Halte ein“, sagte der Prinz. „Du musst zu mir in den Zauberspiegel kommen, dann wird alles gut.“ „Wie jetzt?“, fragte Prinzessin Doria. „Das geht doch gar nicht.“ Doch, es gehe, sagte der Prinz. Und zwar „müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen“, wenn er mal Kleist zitieren dürfe. „Im Märchen geht das, Herr von Kleist“, fügte der Prinz hinzu sehr zum Missfallen von Prinzessin Doria, die sich davon nicht angesprochen fühlte. Komischerweise kam sie aber selbst drauf, was zu tun war. Sie hungerte ihrerseits dreißig Tage, schaute von hinten in ein Fernglas, las als erstes Buch ihres Lebens eine Kinderausgabe von „Der kleine Däumling“, ließ Google per Gesichtssuche ein Satellitenbild von sich selbst anzeigen, hatte lauter gute Einfälle und musste am Ende sogar fünf Schritte in der Browserchronik wieder zurückklicken, bis sie fünf Zentimeter groß neben ihrem Zauberspiegel stand. Und klingelte ... nee, das haben die Dinger ja nicht (noch nicht). Und Einlass begehrte. Das können die jungen Dinger, wie sie alles können, was unbedingten Gehorsam verlangt. Und so kamen der Prinz aus Analogonien und die Prinzessin Doria G. aus Virtu Al Virtus doch noch zusammen. Allerdings nur, um eine Wiederholung dessen zu erleben, was ihren Spaß vor einigen paarunddreißig Tagen schon mal gebremst hatte. Eine andere Frau trat nämlich zwischen sie und behauptete, die wahre Prinzessin Doria G. zu sein. Die andere sei ein Fake. Die angeblich wahre Doria sah jetzt aber richtig schlimm aus. Nicht wie ein Teebeutel. Eher wie ein Mensch, der versucht haben musste, ein kubisches Stück Fleisch zu werden. Wie deutlich soll ich werden? Haben Sie mal einem Verkehrsunfall beigewohnt, bei dem der Fahrer nicht angeschnallt war und sein Körper beim Aufprall die Form des vorderen Teils der Fahrgastkabine ... Nein. Es lässt sich nicht beschreiben. Auch das Märchen muss seine Grenzen kennen. Prinzessin Doria schrie ungefähr eine halbe Stunde. Dann machte sie etwas, das auch nicht immer hilft. Nämlich etwas, das jemand anders mal gemacht hatte und das in der Situation geholfen hatte. Sie küsste das kubische Stück Fleisch ungefähr dahin, wo die wichtigsten Icons auf der Zauberspiegeloberfläche sich befunden haben würden, wenn das Stück Fleisch ein Zauberspiegel gewesen wäre. Und was soll ich sagen – damit war sie weg. Aber nicht so wie damals, nicht hin und weg und verliebt. Nein. Sie war verschwunden. Übrig blieben das kubische Stück Fleisch und der Prinz aus Analogonien. Der wollte dann auch nicht mehr so richtig, und wenn es kein Märchen wäre, wären die beiden definitiv nicht zusammen alt geworden. Weil es aber ein Märchen ist, sagte das kubische Stück Fleisch zu dem Prinzen aus Analogonien: „Komm Schatz, mach das Ding doch mal aus.“ Und nahm ihm das Ding weg und machte es aus. Und sah den Prinzen an. Und da merkte der, dass sie eigentlich doch wunderschön war. Und wenn die beiden vielleicht auch nicht ewig zusammenbleiben, können sie es jetzt wenigstens mal probieren miteinander. Tom Wolff
3snaps
countdown
drei prozent akku sehr schwach an einem dünnen ladebalken hängt deine message dein bild dein neues profil dicke sonnenbrille die haare streng zum dutt schulterblick weg von der kamera bist das du jetzt
zwei user ein herz ein perfektes matching 97 Prozent auf der dating app gute passung das muss was werden sagten wir beschlossen wir wischten alle zweifel vom schirm nur dein profil warst nicht du war ein datensatz nicht kompatibel mit meinen analogen fehlern meinem unverpixelten gesicht meine ladung extrem schwach
eins muss ich dir noch sagen noch tippen mein profil mein perfektes wochenende ausschlafen kuscheln joggen pizza mit viel chili mit anchovis mit allen freunden mein spaß am kitesurfen snowboarden sundowner down under meine lust auf neue horizonte das bin nicht das war nie das gerät schaltet jetzt in den ruhemodus
fail
Gibma Handy Gib Kommando Pizza ordern Lieferando
Wodka alle Alle wollen Lassma liefern Lass Gorilla rollen
Geiles Hoody Nices Shirt Von Zalando? Nee von Muddi Voll der Nerd
Lassma los Bestell’n Benser Car2Go Raus aufs Land Oder so
Checkma den Trecker Honk am Steuer Voll der Checker Sagt er bestellt Bestellt sein Feld
flashback
wie wäre das wieder kreise drehen mit der wählscheibe deine alte nummer hauptstadtverbindung elf ziffern elfmal bis zum anschlag kurbeln elfmal schnarrt die scheibe zurück spannt sich die spiralschnur zerrt am hörer widerspenstig von meiner hand bis zum wandgerät im flur im wohnheimdunkel schritte hallen türen knallen neon flimmert die alte wohnheimluft voll bohnerwachs und fett und schweiß ich in gedanken schon fast bei dir
wie wäre das wärst du grad unterwegs und gingst nicht ran wärst du zuhause dösend lesend auf deinem jugendbett würde der dicke grüne apparat an eurer küchenwand mit schrillem krächzen dich aus dem halbschlaf reißen und du die treppe runtereilen knarrendes holz freudiges poltern du mit nackten füßen über die kalten küchenfliesen klatschen den hörer hastig von der gabel reißen das knacksen in der leitung wie ein kuss wie wäre das
Stefan Benz
Der letzte Kumpel
Linux war das letzte Kind, das ein Smartphone kriegte. Beweisen ließ sich das bei zehn Milliarden Menschen auf der Erde natürlich nicht. Aber sein Onkel hatte das ja auch bloß gesagt, um den Vater zu ärgern, der in der Familie immer schon als rückständiger Nostalgiker gegolten hatte. Wer benannte seinen Jungen schon nach einem uralten Betriebssystem? Und dann richtete er seinem Sohn zur Geburt auch noch eine eigene Website ein. Eine Seite! Im Internet! Ja, wo lebten sie denn? Damit konnte sich Linux als Kind nirgends blicken lassen, ohne ausgelacht zu werden. Genauso wie mit seinem Smartphone, das schon veraltet war, als es auf den Markt kam: eine silbrig changierende Scheibe, die sich in Farbe und Form an den Untergrund anpasste. Wenn man mit diesem Telefon tatsächlich telefonierte, was im Grunde schon lange kein Mensch mehr machte, dann formte es die Ohrmuschel so nach, dass es vor dem Gehörgang hängen blieb. Biomorphing galt in der Kommunikationselektronik als wahnsinnig innovativ. Lange her. Immerhin hatte das Ding keine Tasten mehr, sowas wie Kabel konnte man auch nicht einstecken. Von einem Besuch im Museum für Kommunikationskultur wusste Linux, dass es das mal gegeben hatte. Dort lag ein iPhone 14 neben einer ausgestopften Brieftaube, Morsegeräten und Wählscheibentelefonen. Was für ein Schrott, sagte seine Kindergärtnerin damals, und alle lachten. Linux aber blieb still, denn er wollte sich keine Blöße geben. Keiner sollte von seinem iBaby 43 wissen. Es wuchs zwar mit seinem Nutzer, passte sich an die Größe von Handteller und Fingern an, lud sich mit Sonnenlicht auf, hatte aber nur G17-Standard. Nach diesem Modell war die Produktion eingestellt worden. Sowas brauchte die Welt nicht mehr. Und dennoch hing Linux an seinem Smartphone. Es hatte nicht nur als Babyphone fungiert, als er noch in der Wiege lag; es hatte ihm auch die Stimmen der Eltern und Großeltern vorgespielt, wenn er weinte; und es hatte ihn mit seinen 52000 Milliamperestunden ausdauernd gewärmt, wenn er im Bettchen auf ihm lag und die Decke obendrüber wieder verrutscht war. Im Unterricht hatte Linux später von Konrad Lorenz und dem Gänsemädchen Martina gehört. So wie das Küken den Zoologen als Erstes im Leben gesehen und als Mutter angenommen hatte, verhielt es sich wohl auch mit seinem Smartphone, hatte Linux sich überlegt. Irgendwie war es doch immer schon dagewesen. Vielleicht sogar gleich nach der Entbindung. Ob Vater das Gerät mitgenommen hatte zum Life-Launch seines Sohnes im Rollout-Center der Reproduktionsagentur? Gefragt hatte Linux nie, vorstellen aber konnte er sich das schon. Und es würde auch viel erklären. Es war jedenfalls vor allem diese frühe Prägung, die dazu führte, dass er so sehr an dem völlig veralteten Gerät hing. Dabei vergaß er es oft in der Hosentasche, zusammengeknüllt zwischen Rotzfahnen. Die Taschentücher lösten sich zu Mutters Missfallen im Unterleib des Reinigungsroboters flockig auf, das faltbare Phone aber ließ sich bis 60 Grad einschäumen, mit 1400 Umdrehungen schleudern. Und man musste es nicht mal bügeln. Das wäre dem iBaby 43 wahrscheinlich auch schlecht bekommen. Einfach glattstreichen genügte. Wenn Linux wütend war, konnte es sein, dass er sein Smartphone zerknüllte und an die Wand warf, aber dann zog es ihm meistens in der Magengrube. Er sammelte es ganz schnell wieder ein, streichelte es, bis es wieder flach neben ihm lag, Wärme verströmte und eine Melodie spielte, die seinen Blutdruck sin- ken ließ. Dabei konnte das iBaby ohne Berührung noch nicht mal seine Biodaten auslesen. Aber es reagierte auf die Frequenz seiner Stimme. Das reichte schon. Dann meldete sich die Sprachsteuerung Ultimus, die an den Tonfall seines Vaters angepasst war. Mit Ultimus richtete Linux seine ersten Social-Media-Accounts ein: bei Gossip und Chat-Tube, Mammuth und Muskerade, Brainbook, Tok-Tak, später auch bei tUktUk. Und nach den Trump-Trust-Gesetzen auch im Magaversum. Das war natürlich nur was für Nerds. Und das wusste er auch. Niemals konnte er davon in der Schule erzählen. Auch nicht, als er sein iBaby von einem Freund seines Vaters zum iBuddyXL hatte aufrüsten lassen. „Ein Kumpel von einem Computer“ hatte der Werbeslogan gelautet, was schon damals total retro geklungen hatte. Sowas besaß ja längst auch keiner mehr. Wer brauchte das auch, wenn er eine Schnittstelle im Nacken hatte? So ein Neuroport, den alle nur „Ännpi“ nannten, war so viel smarter. Angeschlossen ans Nervensystem konnte jeder Nutzer über Funkkontakt Audiofiles von der Suprabibliothek direkt an die Nervenleitungen des Gehörs senden. Filme ließen sich kabellos ans Auge übermitteln, die Iris wiederum fungierte als Kamera. Dass der Neuroport Gesundheitsdaten 24/7 auslas und an Health-Hub und Security-System meldete, dass er von Adrenalin bis Insulin den Status der wichtigsten Hormone über Depotausschüttungen regulierte – alles kein Hexenwerk. State of the art. Damals. Nicht nur der Vater aber hatte sich lange dagegen gewehrt. Auch die Mutter war in Sorge gewesen. Natürlich ließ sich ein Kind über den „Ännpi“ jederzeit orten. Doch auf der anderen Seite steckte im Nacken auch die Moneymaker-Technik für Kredittransaktionen. Und obwohl viele Eltern diese Funktion am Neuroport gar nicht freigeschaltet hatten, war es wiederholt auf Schulhöfen dazu gekommen, dass Kindern der Chip aus dem Nacken geschnitten wurde. Schlimm genug, dass die Kleinen stark bluteten und oft an der Wirbelsäule verletzt wurden, aber meist musste nach solch einer Attacke auch noch der Port ausgewechselt, das ganze Kind neu konfiguriert werden. Die Eltern von Linux wollten das nicht riskieren. So ging er lange nur mit seinem iBuddy durchs Leben. Bis zu dem Tag, als ihm sein Chef klarmachte, dass er seinen Job verlieren würde, wenn er sich weiterhin der modernen Technik verweigerte. Und das verstand er ja auch. Wie sollte er mit anderen Menschen in Kontakt treten, wenn sein Bewusstsein nicht im Magaversum hochgeladen war? Wie schnell konnten dort bei den einfachsten zwischenmenschlichen Transaktionen schon ein paar Petabyte an Daten ausgetauscht werden. Ohne einen NP, der mit KI seine PI, die Persönliche Intelligenz, potenzierte und optimierte, war er ja im Grunde sprach- und gefühllos. Also ließ sich auch Linux eines Tages den Neuroport implantieren. Der Onkel war da längst tot, aber wahrscheinlich hätte er spitz und zutreffend bemerkt, dass sein Neffe wohl auch der letzte Mensch war, der einen NP eingesetzt bekam. Linux trug seinen Namen wohl zurecht. Er war eben schon als Auslaufmodell zur Welt gekommen. Irgendwann hatten seine Kinder und Enkelkinder aufgehört, an ihm herumzumeckern, warum er sich der Zukunft verweigere. Seit er sein gesamtes Bewusstsein hochgeladen hatte ins Magaversum, war er glücklich mit seinem Port. Dass sich die Prionen in seinem Hirn verklumpten, musste ihn nicht mehr kümmern. Sein Geist war ja im Backup für immer aufgehoben. Nur sein Körper zerfiel zusehends. Gelbe faltige Haut, die Nase ädrig, die Augen tief in den Höhlen, der Rücken gekrümmt, alle Gelenke geschwollen. Linux war mit 107 Jahren zwar noch längst kein Greis, aber doch kein schöner Anblick mehr. Das wollte heute auch keiner mehr sehen. Aber genau dafür gab es ja Altkörperverwahranstalten, die Body-Storage-Lösungen mit individueller Vitalfunktionskontrolle kombinierten. Linux war damit zufrieden. Also, sein Bewusstsein oben im Magaversum war einverstanden, und sein Körper konnte damit existieren, bis der Mietvertrag im Storage-Zentrum der Firma Body Culture auslief. Er hatte sich für seine letzten Jahrzehnte einen komfortablen Container gegönnt. Ärmere Menschen lagen in einer Röhre. Linux aber hatte Platz für Besucher, die selten kamen. Das aber machte ihm gar nichts aus, denn in seiner linken Hand spürte er das warme weiche Material seines iBuddy. Es lag da, seit er eingezogen war. Und manchmal, wenn er eine menschliche Stimme hören wollte, unterhielt er sich mit der Sprachsteuerung Ultimus übers Wetter, die Dürre, die Tornados, Überflutungen. Was alte Leute halt so wissen wollen, wenn der Tag lang und leer ist. Heute aber brauchte er Ultimus nicht, heute hatte sich sein Urenkel angekündigt. Am Nachmittag kam er. Ein eiförmiger Serviceroboter, auf dem sich mit einem Leuchten ein Lächeln abzeichnete, schob den jungen Gast in seinen Container. Wie nett. Endlich wieder mal Besuch. Da lagen die beiden also: ein wächserner Greis auf einer weißen Bahre neben einem gläsernen Behälter mit einer milchigen Nährflüssigkeit, in der sich ein grauer Klumpen und ein Faserstrang – Gehirn und zentrales Nervensystem – abzeichneten. Zwei Stunden hatten Linux und sein Urenkel, in denen sie ganz nah beieinander lagen, während ihre Gedankendatenströme im Magaversum zusammenflossen. Viel verstand der alte Mann nicht von dem, was seinem jungen Gast so alles durch die Neuronen brauste. Aber es war auch egal. Irgendwann hörte Linux gar nicht mehr zu, was sein Urenkel dachte. Er hatte ja alles, was er brauchte in seiner rechten Hand. Er umschloss die warme Scheibe, die sich sofort um seine Finger schmiegte. Alle anderen Funktionen seines Smartphones waren längst erloschen, aber dieses Feature funktionierte noch. iBuddy drückte ihn zärtlich. Einen besseren Kumpel gab es nicht. Linux war glücklich.
Barbara Zeizinger
Worte hängen in Wolken Sieben Gedichte
Bitte wenden Sie
Im Halblicht der Dämmerung unterwegs auf der A7. Im Westen der Widerschein der Sonne, auf dem Grünstreifen Treibgut aus Müll. Mein Smartphone als Reiseführer verlangt ‒ Bitte wenden Sie ‒ Unmögliches. Während ich weiter die falsche Richtung nehme, überfällt mich eine ferne Erinnerung an einen See, an dem ich deinen Brief zerriss, weiterfuhr, dem Süden entgegen. Ich bin endlich angekommen, schrieb ich, obwohl es nicht stimmte. Nur zeitweise überwog das Gefühl, die richtige Ausfahrt genommen zu haben.
Ich wüsste gerne, was sie denkt
In der S-Bahn das Handy als Fluchtpunkt vor dem immer gleichen Blick auf dieselben Straßen, Häuser, Graffiti. Meine Nachbarin ist jung, die Ausschnitte der Stadt interessieren sie nicht. Für sich sein im überfüllten Waggon. Atempause.
Undenkbar Gespräche mit Fremden. Nicht hier, nicht jetzt. Der Kopfhörer als Zeichen. Musik die abgesteckte Grenze. Als sie aussteigt, lächelt sie mich an, wünscht einen guten Abend. Ich staune.
Die Zeiten ändern sich
Du Idiot, schreit die junge Frau im ICE 215 in ihr Handy. Du verdammter Idiot!
Drei Worte, bei denen meine Mutter ‒ weil viel zu privat ‒ alle Fenster verschlossen hätte.
Tempora mutantur fällt mir ein, als säße mein alter Lateinlehrer neben mir. Im Zug wird es still. Auch ich lege die Zeitschrift weg.
Vorwürfe in hoher Stimmlage, Fragewörter, Halbsätze, halbherzige Versuche der Zuhörer, den Streit zu begreifen.
Er ist fremdgegangen. Hat beim Einkauf die Kinder vergessen. Die Wäsche verfärbt.
Nein, ich werde nicht … Sehr laut. Dann ein Tunnel, Funkloch, Schweigen.
Tempora mutantur … Mir fällt nicht ein, wie der Satz weitergeht. Ich glaube es war ein Hexameter.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen.
Eigentlich habe ich es nicht eilig
Staugefahr sagt Googlemaps und gleich darauf, als wolle es mich trösten, du befindest dich immer noch auf der schnellsten Strecke.
In Wahrheit Stillstand. Auf der Gegenfahrbahn fließender Verkehr. Noch denke ich in Minuten, ahne, es wird nicht dabei bleiben.
Neben der Autobahn ein offener Landstrich, auf der Böschung vertrocknete Gräser. Eine Familie mit Bechern und Broten. Picknick gegen Langeweile.
Ein junger Mann steigt aus, sucht mit Blicken das Ende der Schlange. Eine Zigarette, ein Lächeln.
Mein Smartphone lügt, sage ich durch das geöffnete Fenster. Gemeinsames Warten auf stop and go.
Was er später wohl erzählen wird, von den Minuten, in denen sich unsere Geschichten kurz berührten?
Ferngespräche
Erinnerungen enden immer in Melancholie sagt Leonardo Padura, der kubanische Dichter, in dessen zweitem Havanna-Krimi die verdächtige Musikerin gerade den traurigen Kommissar verführt.
Sitze im Zug Richtung München, die Landschaft draußen taucht auf, verschwindet wieder wie so vieles. Das alles wollte ich dir erzählen, aber der Akku meines Handys ist leer und ich habe vergessen, wo das Kabel ist.
Ich muss mich gedulden wie früher, als ich jung war und wartete, bis der Zähler umsprang auf den Mondscheintarif.
Ich schicke ein Fragezeichen
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Paul Watzlawick
Es stimmt, ich habe gezögert, dir diesen Satz zu schreiben. Seitdem Funkstille. Ich warte, schicke Smileys, rote Ausrufezeichen, den hochgestreckten Daumen. Nichts. Melde dich! Großgeschrieben. Nichts. Ich stelle mir dein Zögern vor, dein Stirnrunzeln, das schwere Atmen wie neulich, als wir spazierengingen und der Himmel nahezu durchsichtig war. Ich hätte dich anrufen sollen, etwas hinzufügen, etwas Nettes. Den Satz abschwächen durch meine Stimme. Ich sende ein Fragezeichen. Digitales Schweigen. Im Café
1 In der Mitte öffnet sich der Raum. Dorthin schiebt er den Kinderwagen, kurvt um Tische und Stühle, setzt sich an einen Tisch, wählt einen anderen. Er bestellt Tee, ein Kännchen mit Kandis, beugt sich über den Kinderwagen, schlägt die Decke zurück, holt sein Handy aus dem Jackett, liest einen Krimi, legt das Handy weg, zieht dem Baby das Mützchen aus, holt das Baby aus dem Wagen, gibt ihm die Flasche, gibt ihm eine Rassel, wippt mit den Knien, nippt am Tee, legt das Baby in den Kinderwagen, sieht sich um, sieht eine Frau ihren Espresso umrühren, Zucker, denkt er und schreibt eine Einkaufsliste.
2 Ihre Blicke überfliegen den Raum, finden einen Tisch im hinteren Teil, sie eilt auf ihn zu, streift den Kellner, streift einen Kinderwagen, ein Stuhl für sie, einen für die Tasche. Sie bestellt einen Espresso, doppelt, stark, streicht eine Fluse von ihrem Jackett, schaut auf die Uhr, schreibt auf ihrem Handy, liest, schreibt, trinkt den Espresso in einem Zug, trinkt ein Mineralwasser, legt das Handy beiseite, lehnt sich zurück, schaut zu dem Mann mit dem Kinderwagen, lächelt ihn an.
3 Sie sitzt gern am Fenster, will gleichzeitig drinnen und draußen sein. Sie bestellt Cappuccino, koffeinfrei mit Sahne, leert die Tasse langsam, löffelweise, schlückchenweise, bittersüß, wie Hochzeitsflug und Abschiedsmusik. Ein Mädchen geht vorbei, langhaarig, Minirock. Sie schaut ihm hinterher. Sie hat vergessen, dass man so jung sein kann.
4 Mit der rechten Hand fährt sie sich durchs Haar, setzt einen Kopfhörer auf, setzt sich an die Theke. Sie bestellt Cola mit Zitrone und Eis, trinkt mit einem Strohhalm, sucht im Spiegel zwischen Flaschen eine freie Stelle. Zu dunkel, denkt sie, ich muss zum Friseur, vielleicht Strähnchen. Ihr Handy klingelt, sie nimmt den Kopfhörer ab, spricht, lacht, steckt das Handy weg, schiebt mit beiden Händen ihre Haare zusammen, lässt sie wieder fallen. Zwischen den Flaschen sieht sie Teile einer alten Frau.
5. Zwei Jungen betreten den Raum, blicken zu dem Mädchen an der Bar, suchen einen freien Tisch. Apfelschorle, Spezi. Zwei Handys liegen auf dem Tisch. Sie trinken, schieben die Gläser in die Mitte, laden ein Spiel herunter, spielen, schweigen, sagen Level 7, sagen krass, sagen cool, spielen, schweigen, spielen, schweigen. Bei Level 9 schaut einer auf die Uhr, trinkt seine Apfelschorle aus, sein Spezi der andere, sie packen ihre Handys ein, steuern auf den Ausgang zu, sehen das Mädchen telefonieren, sagen man sieht sich.
PH Gruner
Zoes Weg ins Büro
Zoe ist fröhlich und zielstrebig und kommunikativ. Sie geht morgens beschwingt und tatendurstig aus dem Haus und bewältigt zu Fuß ihren Weg zur Arbeit. Auch im Winter. Zurzeit ist Februar. Die Wetterapp verkündet gefrierende Nässe und leichte Glatteisbildung, aber bis 10.35 Uhr trocken, ab 10.36 und 45 Sekunden zögerlich einsetzender Nieselregen aus Südwest. Zoe ist gut zu Fuß. Sie ist 28 Jahre jung und mittelgroß und sagt von sich, sie habe die Figur Pandabär. Nicht das Wesen, nur die Figur, wie sie betont. Denn sie ist eine sehr schnelle und standfeste Pandabärin. Nicht leicht umzustoßen, nicht leicht aus der Fassung zu bringen. Auch heute nicht. Sie ist warm angezogen, trägt Schal und Mütze, feste Schuhe und hat in der Tasche die leichteren Schuhe fürs Amt dabei, fürs Bauaufsichts- amt. Dort arbeitet sie als städtische Angestellte. Zoe trägt ihre feinen schwarzen Fingerhandschuhe. Die schwarze Linke hält auf dem gesamten Arbeitsweg das Smartphone stets eng vor ihrem Pandabärenbauch, die schwarze Rechte kommt nur aus der Manteltasche hervor, wenn beide Daumen in Windeseile eine Message tippen. Zoes Ohren werden, unter der Mütze, gewärmt und akustisch versorgt von zwei kuscheligen Kopfhörerschalen. Zoe hört „Happy“, ihren jüngst wiederentdeckten, absoluten Lieblingssong von Pharrell Williams. „Because I’m happy, clap along if you feel like happiness is the truth“. Zoe ist gewappnet. Sie singt im Geiste mit, mit dem schlaksig-schlanken und wunderbar biegsamen Pharrell, ja, happiness is the truth, absolut, klar, nichts sonst, aber im Augenblick ist Zoe mit den Augen auf der WhatsApp von Freundin Nora, die fragt „Hey, gehn wir Freitagabend in Frau Luna in die Oper? Ich check mal nach Karten, okay?“ Gute Frage. Zoe checkt aber erst mal ihren Kalender. Und übersieht dabei Fatih. Fatih ist nicht allein, sondern wie stets am Morgen mit seiner dreieinhalb Tonnen schweren, ordentlich fauchenden Straßenkehrmaschine unterwegs, seinem City Ranger 3500. Fatih verfolgt, wie Zoe den Fußgängerüberweg mit lächelnd gebeugtem Kopf überquert, leider bei hellem Rot. Er hat es kommen sehen. Er weicht mit seinem City Ranger couragiert aus, rammt dabei jedoch einen Fahrradfahrer. Den hat er nicht kommen sehen. Der Radler wird vom Sattel geholt, gerät samt seinem gelben Helm unter den City Ranger 3500 und wird niedergekehrt. Es ist ein Verfahren ohne Gnade. Der City Ranger holpert und rattert über ihn hinweg. Er vermengt das plattgedrückte Rad mit dem flachgequetschten Radlerkörper zu einer feucht-frisch geputzten, breiartigen Masse, die sich weigert, vom Kehrbauch des City Rangers aufgenommen zu werden. Zu sperrig. Fatih stellt auf Notstopp, springt aus der Fahrerkabine, verliert beim wirren Blick auf das angerichtete Unheil jede Fassung, schreit lauter als der Verkehrslärm, reißt sich beide Ohren vom Kopf, will einfach nur rennen, losrennen, wegrennen, stolpert aber über den gebogenen Fahrradlenker, der, als einziges Detail wiedererkennbar, unter dem City Ranger herausragt und schlägt auf einem weißen Strich des Zebrastreifens mit dem Kopf auf. Auf dem Weiß zeichnen sich zwei dickflüssig-rote, von der angefrorenen Straßenoberfläche abdampfende Fleckspuren ab, die Fatihs Schädel aus dem Bereich der abgerissenen Ohren verlassen. Zoe durchquert derweil das Tor zum Englischen Garten. Clap along if you know what happiness is to you. „Frau Luna gebongt. Hab Zeit. Und Lust. Hol Kärtchen, egal welche. Kuss!“, tippt sie rasend schnell, und ab zischt die Message zu Nora. Auf dem breiten Hauptweg durch den Englischen Garten ist Zoe plötzlich in Südafrika. Das geht schnell. Über Instagram hat Amtskollege Luca, im Kurzurlaub, Bilderstrecken aus Johannesburg und Kapstadt geschickt. Sie scrollt und scrollt. Der Mann hat’s gut. Die Frau mit dem Lastenrad, die ansetzt, die in der Mitte des Weges gehende Zoe zu überholen, nicht. Denn sie erkennt zu spät, dass Barbara und Agnes mit ihrem vierjährigen Zwergspitz ihre Morgenrunde gehen. Der Zwergspitz steht rechts des großen Weges, Barbara und Agnes aber am linken Rand. Sie rufen mit spitzen Sopran-Stimmchen den Zwergspitz, er heißt Raphael, aber er hört nicht. Und so ist die Hundeleine stramm gespannt überm Weg. Das Lastenrad nähert sich kraftvoll. Zoe schaut sich grade an, was Luca auf seinem Teller hatte gestern beim Schnabulieren in seinem Lieblingsrestaurant in Kapstadt, als die Frau mit dem Lastenrad die Leine ins Vorderrad spinnt, Leine und Zwergspitz mit einem furios anzusehenden Schwung hochreißt und dabei mit einem hohen Eigendrehimpuls versieht, gerne auch als Spin bezeichnet. Raphael fliegt empor durch die Morgenluft, überquert die unteren Äste einer Platane am Wegesrand und hängt schließlich mit hängender Zunge und vollkommen verblüfftem Gesichtsausdruck am untersten Ast, pendelnd an der Leine in Höhe der Gesichter von Barbara und Agnes. Die Frau mit dem Lastenrad bremst ab und beginnt sofort mit dem Ausschimpfen der Beiden, die wiederum diesem Ausbruch von Wut und Empörung gar keine Beachtung schenken, weil sie mit vereinten Kräften Raphael von seinem pendelnden Schicksal am Baume befreien. Zoe singt mit bei Clap along if you know what happiness is to you und staunt über die Fotos vom Nachtisch, den Luca sich da gegönnt hat. Er ist über 9000 Kilometer Luftlinie von ihr entfernt! Nicht zu fassen! Dem Mann geht’s gut! Barbara und Agnes schließen ihren von der Leine befreiten, rotbraunen Raphael in die angstvoll zitternden Arme und lassen sich von seiner kleinen rauhen Zunge das Gesicht abschlecken. Das ist Dankbarkeit. Die Frau mit dem Lastenrad zeigt ihnen den kaminrot behandschuhten Stinkefinger und radelt zornesrot weiter, an Zoe vorüber. Die wird vom sonnig-süßen Kapstädter Nachtisch abgelenkt durch die akustisch und visuell aufploppende Erinnerung an ein Zoom-Meeting, das in fünfzehn Minuten beginnen soll. Zoe beißt sich kurz auf die Unterlippe. Stimmt. Das Zoom-Meeting. Es geht um die mögliche Installation brandneu entwickelter weiblicher Wandurinale im „WC-Center“ des Hauptbahnhofs. Ein Modellprojekt des Future-Miktions-Fonds des Innenministeriums. Wichtige Sache. Stellungnahme des Bauaufsichts- amtes erbeten. Zoe ruft die Datei auf, in der sie die Punkte ihres Pro-Plädoyers notiert hatte. Sie stellt die Endlosschleife von „Happy“ kurz ab und liest sich selbst laut vor: „Mehrere Studien ergaben, dass über die Hälfte der befragten Frauen in Europa ein Urinal benutzen würden, wenn es verfügbar wäre. Wir als Bauaufsichtsamt nehmen die Forderungen nach einer Urination equality, der dringlich zu verwirklichenden Gleichstellung beim Pinkeln, außerordentlich ernst. Urinale für Frauen oder Unisex-Urinale sind insgesamt weitaus weniger verbreitet als reine Männerurinale, was zu einer andauernden und schwerwiegenden Benachteiligung von Frauen im öffentlichen Toilettenraum führt.“ Zoe redet laut und engagiert in die kalte Morgenluft hinein, stößt Wortwölkchen aus, und registriert aus den Augenwinkeln, dass einige Passanten sich zuhörend umdrehen zu ihr. Es ist ihr egal. Sie redet weiter: „In der frühen Studie von Ute Alexandrowicz aus dem Jahr 1999 wurden Frauen befragt, in welcher Körperhaltung sie sich die Benutzung eines Frauenurinals vorstellen könnten. 81 Prozent gaben dabei stehend an oder in Halbhocke, bekannt auch als Skifahrhaltung, nur 19 Prozent bevorzugten eine sitzende oder tief hockende Körperhaltung. Auch aufgrund dieser breiten soziologischen Forschungsergebnisse kann unser Amt unter sanitärtechnischen wie emanzipationshygienischen Grundsätzen heraus das Projekt eines Frauen-Urinals in Wand- installation, selbstredend in Reihenanordnung mit Trenn- oder Schamwänden, nur befürworten. Für diesen wichtigen Schritt zur Gleichstellung der Frauen bei der Miktion würden wir allerdings die Bezeichnung Missoir bevorzugen.“ „Das klingt gut!“, klatscht Zoe freudig in die schwarzen Handschuh-Hände, wobei ihr um ein Haar das Smartphone wegrutscht. Der Schreck darüber fährt ihr so in die Glieder, dass sie kurz innehält, kurz stehen bleibt, kurz die Backen bläht und viel Luft ausbläst. Dann geht sie weiter. Beim Blick aufs gerettete Display sieht sie, dass Scarlett über Threema anfragt, wie es mit dem gemeinsamen Bildungsurlaub stehe ab April. Ja, da muss sie gleich antworten. Und Freundin Joy schickt über Signal reichlich verwackelte Fotos von ihrem Lover im Hotelbett auf Ibiza mit der Botschaft Was machst Du so? Diesen Knackarsch vernasch ich grade . . . Zoe zieht ein verrutschtes Lächeln und kreuzt resoluten Schrittes den großen Heinrich-Heine-Platz. Bald ist sie da. In acht Minuten startet das Zoom-Meeting. Sie geht quer über den Platz. Direktheit ist Effizienz, weiß sie. Und ruft noch kurz ihren Kollegen an, um ihm mitzuteilen, dass sie in einer Minute im gemeinsamen Büro sein wird. Ob die Kaffeemaschine vielleicht schon laufe? Zoe switcht wieder zu „Happy“, das stimuliert ihre Beine und Füße, die wie von alleine laufen und die letzten zweihundert Meter Arbeitsweg unter die Sohlen nehmen. Das Wesentliche spielt sich hinter Zoe ab. Da ihr entschlossener Schritt zwischen den wartenden Straßenbahnen durchsticht und sie dabei die Spur der Buslinien 41 und 46 kreuzt, versucht der vollbesetzte und mit rundum angelaufenen Scheiben heranschnaufende 41er-Gelenkbus dem überraschend huschenden Phänomen Zoe auszuweichen. Aus tiefem Schreck heraus führt Berufskraftfahrer Edwin die schnelle Lenkbewegung nach links zu abrupt und heftig aus, weshalb er gegen die dicht neben der Busspur wartende Straßenbahn kracht, wonach diese wiederum in von Geisterhand bewegter Zeitlupe aus den Schienen kippt. Sie fällt in der Folge wie tödlich getroffenes Großwild in Tansania langsam um, dabei die Oberleitung ein- und mitreißend. In der feuchtkalten und Elektrizität gut leitenden Luft spuckt es Sterne und Blitze aus der Leitung. In der Straßenbahn purzeln die Menschen. Edwin schaut zu und sitzt plötzlich quasi im Freien. Die Frontscheibe seines Gelenkbusses ist in einem Stück herausgeplatzt. Würde er sich jetzt vorbeugen, könnte er die auf der Seite liegende Straßenbahn berühren. Das von ihm erlegte Großwild. Stattdessen kann er beobachten, wie der 78 Jahre alte Winfried aus dem Weiler Bückelhausen-Oberloe, seit zwei Jahrzehnten stark sehbehindert und in der Stadt wie stets mit einem Blindenstock unterwegs, die tief herabhängenden Fahrdrähte, die ihm wie dünnes Geäst den schwierigen Weg um die gekippte Straßenbahn versperren, mit der Hand beiseite schieben möchte. Edwin verfolgt, wie Teile von Winfried beim Kontakt mit 750 Volt Gleichspannung zischend verdampfen, sein fortan verwaister Blindenstock umfällt und dieser mit seinem Knauf eine unerschrocken in den Pflasterfugen pickende Ringeltaube im Nacken schmerzhaft trifft. Berufskraftfahrer Edwin glaubt, er sitzt nicht weiter am Steuer, sondern im Kino. So oder so hilflos. Zoe tippt die Threema-Antwort auf Scarletts Frage mit dem Bildungsurlaub ab April, passiert mit dem Abschiedsgruß CU zwischen den tippenden Daumen die Drehtür ins Dienststellengebäude, winkt wie immer zwischen lässig und nachlässig der Frau Vögele-Breithähnel am Empfang hinter dem übergroßen Schild „Besucher-Anmeldung hier!“, nimmt jeweils zwei Stufen die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Oben zieht sie die schwarzen Handschuhe von den Fingern und hält kurz inne, bevor sie die Türklinke drückt zum Büro B1/201. I’ m happy. Clap along if you feel like a room without a roof.
Marillenmutter
Katharina hatte die Spaghetti con porro sehr genossen im vergangenen Oktober. Porro, also der Lauch, war ihr in dieser pikant komponierten Weise – in dünne, längliche Streifen geschnitten, zusammen mit Speckwürfeln, Rosmarin, Knoblauch und Olivenöl zu den Spaghetti gegeben, untergemischt eine Ei-Parmesan-Mischung – noch nie in die Mundhöhle gekommen. Es war formidabel. Zum Nachtisch noch ein Aprikosen-Kompott. Katharina war im siebten Himmel. Eventuell auch im achten, dem endgültig entrückten Himmel der Geschmäcker.
Im späten Dezember, kurz vor Silvester, bemerkte Katharina einen seltsamen und stetigen Juckreiz unterhalb des rechten Rippenbogens, dem mit einem einfachen Kratzen nicht beizukommen war. Bis ins neue Jahr hinein war sie mit dem Phänomen beschäftigt. Sie fotografierte ihren Bauch von vorn und von der Seite, also im Profil, stellte die Aufnahmen in ihren Instagram-Account und fragte ihre Gemeinde: Was ist da los? Wer hat eine Idee? Ein dermatologisches Phänomen ist es nicht. Keine Rötung. Kein Ausschlag. Keine allergische Reaktion. Was ist es dann? Über dem Lesen aller Antworten, aller Spekulationen und Interpretationen, verging viel Zeit. Viele im Microblog schickten ihrerseits Fotos von ihren leicht gewölbten Bäuchen von vorn und im Profil, also von der Seite, und Katharina sog begierig auf, was aus den Köpfen der anderen so austrat an Text. Bis sich dann Mitte Februar zum Juckreiz eine erst leichte, dann schnell zunehmende Wölbung der oberen rechten Bauchdecke gesellte, die Katharina mit vielen weiteren Fotos, stündlich aktualisiert, darstellte. Am 11. Februar brach ihre Bauchdecke schmerzlos auf und Katharina gebar ein Aprikosenbäumchen. Das winzig-zarte, jedoch bald erstaunlich kraftvoll austreibende Apriköschen, im bayrisch-österreichischen Raum als Marille bezeichnet, in Rheinhessen auch als Malete bekannt, versetzte Katharina in eine euphorische Stimmung. Katharina legte das Smartphone nicht mehr aus der Hand. Sie teilte ihre Euphorie mit der Welt. Und sie teilte so gerne. Sie schlief nurmehr auf dem Rücken, verlor über der Zuneigung zum Wunder ihrer Aprikose eines ihrer Hauptinteressen, den steten Appetit auf gutes Essen, und verspürte dafür viel mehr Durst. Sie trank immense Mengen. „Ich gieße das Bäumchen von innen“, schrieb sie verzückt und erntete ein Meer an hochgereckten Däumchen. „Katharina, Du bist die Zukunft!“, schrieb ein junger Verehrer aus Litauen und sorgte für internationale Verbreitung jener Fotos, die Katharina als „Marillenmutter“, so seine Formulierung, zeigten.
Nachdem über Wochen ein Juckreiz in Katharinas linkem Oberschenkel alle in Atem gehalten hatte, zeigte sich dort eine Schwellung, die Katharina mit genauen Zentimeter-Angaben in Bezug auf Fläche, Breite und Höhe beschrieb und mit täglichen Fotos aus betont flacher Betrachterperspektive herausragend dokumentierte. Die Instagram-Gemeinde stand umgehend Kopf und veranstaltete Wetten auf das, was sich zeigen würde, was möglich wäre, was zu erwarten sei. Ein erster Trieb durchstieß die Epidermis des Oberschenkels am 26. Februar. Es zeigten sich winzige linealische bis lanzettliche Laubblätter. Katharina war froh, dass sich die Aprikose aus dem rechten oberen Bauchrand heraus entwickelte, denn so hatte sie ungehinderten Blick auf den linken Oberschenkel. Was aus den Blättchen werden würde? Zweiglein für Zweiglein kräftigte sich derweil der Haupttrieb der Aprikose. Das sich schnell ausbreitende Gewächs verhinderte, dass Katharina ihren rechten Fuß noch betrachten konnte. So fotografierte sie über das Steinobstbäumchen hinweg ihr rechtes Bein samt Fuß, indem sie das Smartphone mit ausgestreckten Armen über ihre Hüfte hielt und nach rechts unten fotografierte. „Seht ihr da unten mein Bein und meinen Fuß noch?“, fragte sie in die inzwischen global gewordene Runde. „Alles in Ordnung!“, kam zurück. „Don’t worry, you’re lookin’ great!“ kam die Audiobotschaft aus Australien.
Katharina trank mehrere Liter am Tag, um sich ökologisch und sozial angemessen zu verhalten. Sie fühlte sich wie noch nie in ihrem Leben: Sie fühlte sich eins mit ihrer Außenwelt, sie fühlte nicht mehr diese Phalanx der Enge und der Eigeninteressen, sondern ausschließlich Liebe. „Geteilte Liebe ist doppelte Liebe“, betitelte sie von fortan jede ihrer Botschaften und Breaking News. Dann durchbrach die Fachstimme eines Botanikers aus Bochum via Android-App das Rätselraten über das florale Geschehen auf ihrem linken Oberschenkel. „Es ist ein kleiner Lauch!“, verkündete er, „ein Exemplar von Allium ampeloprasum oder auch Allium porrum. Zu deutsch Breitlauch, Winterlauch, Welschzwiebel, Ackerlauch, Gemeiner Lauch oder Spanischer Lauch“, präzisierte er mit einer eigenen Fotostrecke aus dem vergangenen Sommer mit Lauchkraut aus seinem Garten. „Erreicht Wuchshöhen bis zu 80 Zentimeter in Nordrhein-Westfalen. Weiß allerdings nicht, welche Wuchshöhe sich aus dem menschlichen, mitteleuropäisch-weiblichen Oberschenkel heraus ergibt. Ich recherchiere weiter. Glückauf!“ „Katharina, die Marillenmutter, wird auch Lauch-Mama“, verbreitete sich über Instagram. Katharina war erheblich mehr stolz und dankbar darüber als irritiert. Sie lag auf dem Rücken und stellte sich in bunten Tagträumen die Marillenfrüchtchen vor. Sie würden kommen, und sie würden zu ihr kommen. Ihr Bauchraum fühlte sich durchwachsen an.
Juckreiz, Aufwölbung, tiefdunkle Rötung an der Spitze der Schwellung: Katharina war im Mai gut vorbereitet und neugierig auf das, was sich ereignen würde. Als nachhaltig integrierter und nährender Bestandteil alles Natürlichen zelebrierte ihr Seelenleben ein Plateau monumentaler Zufriedenheit. Und Zufriedenheit, ja, das war für Katharina mehr als Glück. Glück war etwas für kurze Distanzen auf dem Zeitstrahl, schnell verbrannt und erschütterbar, Zufriedenheit dagegen war etwas für die Langstrecke, für das Aufgehen in etwas Größerem, für das Übergehen ins Weitere, Erhabenere. Zufriedenheit spiegelte nicht kurzatmig eine Bedeutung, es war die Bedeutung. Als am 17. Mai nachmittags knapp oberhalb ihres freudig erregt schlagenden Herzens und knapp unterhalb ihres linken Schlüsselbeins die Haut aufbrach wie eine spärliche Krume auf karstigem, trockenem griechischen Boden am Ionischen Meer, da hatte sie alles vorbereitet. Seit Stunden war sie in Wartestellung, um den Moment des endlich Offenbarten fotografisch festzuhalten. Ihr linker Arm lag matt und in der Beweglichkeit stark eingeschränkt neben dem Kissen, abgelegt und dahingestreckt wie ein Beet für die Zukunft. „Du bist die Zukunft!“ hatte schließlich schon im Februar beim Erscheinen des Aprikosenbäumchens jemand geschrieben. So hielt sie nun mit der rechten Hand halbhoch die Smartphone-Kamera auf das Erscheinen der kleinen, sofort aromatisch wirkenden Spitze des Rosmarins. Endlich mal ein Immergrüner, sprach Katharina zärtlich-leise ins Mikro, endlich mal was Mediterranes, endlich etwas Duftiges, und dies auch noch so nah an der Nase. „Ist er nicht süß?“ Katharina strahlte. „Salvia rosmarinus“, kommentierte der Botaniker aus Bochum, „aus der Familie der Lippenblütler alias Lamiaceae. Katharina wächst sich aus zur Schönsten überhaupt!“ Die hymnisch Verehrte selbst fand, allen Glückwünschen zum Trotz, ein Haar in der Suppe, wiewohl sie doch von der langen und unirritierbaren Strecke der Zufriedenheit ausgegangen und überzeugt war. „Aber bei der ersten guten Rosmarin-Ernte, idealerweise Zweiglein und nicht einzelne Blätter, werde ich mich kaum mehr bewegen können. Schade!“ Jedoch tröstete Katharina sich umgehend selbst: „Aber da ich ja keinen Appetit mehr verspüre, muss ich auch nicht kochen!“ Im frühen Juli war es soweit. Angefeuert durch die beispiellos gute Nahrungsgrundlage, wurden bei dem jungen Bäumchen drei Früchte reif. Sie verdonnerten Katharina endgültig dazu, alle schnellen oder schreckhaften Bewegungen zu unterlassen. Eine Woche später stand sie nach sorgfältiger Vorankündigung noch einmal auf, um sich in Gänze den Netzwerken zu zeigen. Ein Nachbar filmte Katharina in zerschlissenen und aufgerissenen Kleidern, im Grunde fast vollkommen nackt, bedeckt mehr von Ast- und Blattwerk als von Textilien. Der Rosmarin über dem Herzen war erst runde zwölf Zentimeter lang, aber der Lauch hatte sich prächtig entwickelt und trieb erste Kapselfrüchte aus. Katharina lachte schrill auf, weil sie ins Schwanken geriet. Sie hatte große Mühe, nicht – dem prachtvoll gedeihenden Aprikosenbäumchen folgend – nach vorne zu fallen. Die Netzgemeinde hielt den Atem an in Echtzeit. Aber Katharina fiel nicht, nur eins der fast reifen Früchtchen fiel hinab. Der Ausruf von Überraschung und Entsetzen ging um die Welt. Das unreife Früchtchen traf auf den Spann von Katharinas rechtem nackten Fuß. Die Kamera war dem fallenden Obst gefolgt. Die noch reichlich harte kleine Aprikose teilte beim Aufprall den Fuß in Längsrichtung in zwei Teile. Der Fuß öffnete sich und gab den Blick frei auf eine erdähnliche Masse. „Das ist Humus“, gab der Botaniker aus Bochum aus. Silvia aus Bern schritt dagegen sofort ein: „Das ist Kompost, mein Lieber. Katharina kann keinen Humus herstellen.“ Der Botaniker ließ den Einspruch nicht wirklich gelten. „Wenn ich ein Pröbchen nehmen könnte, würde ich Dir – und uns allen – wahrscheinlich beweisen können, dass es sich bereits um Humus handelt. Mit einem ausgewogenen Verhältnis von Calcium, Eisen, Kalium und Aluminium, Magnesium und Mangan, Phosphor, Schwefel und dem Wichtigsten überhaupt: Stickstoff und Kohlenstoff. Schaut Euch das an: das ist Humus, ganz und gar natürlich hergestellter Humus aus zersetzbaren organischen Ausgangsstoffen. Hallo, kannst Du mal heranzoomen, du Mensch an der Kamera, geht das? Oder einfach näher rangehen? Ich will das besser sehen können. Ja, so, danke, wunderbar, da sieht man es perfekt: Das ist Humus, meine Lieben, nährstoffreicher Humus wie er im Buche steht! Ausgezeichnete Arbeit. Perfekt. Katharina?“ „Ja?“, gab sie zurück. „Du bist nicht Katharina die Große. Du bist die Größte!“
Marina D’Oro
Der Hörer
Mein Telefon klingelt. Aber ich hab keins, keins für unterwegs. Es klingelt noch mal. Laut. Gellend. So, wie ich es klingeln lassen würde. Ich schau um mich. Kein Mensch ist da. Ich bin allein im Abteil, steh auf und guck, auf die Ablagen, unter die Sitze, leg mich sogar auf den Boden, damit ich besser seh. Nichts. Noch einmal die gellende Tonfolge. Drei Töne in irgendeinem harmonischen Abstand. Wär ich Musikerin, wüsst ich in welchem. Aber so weiß ich auch das nicht. Dumm steh ich rum und weiß nicht, wie gucken, was tun. Ich kann richtig fühlen, wie dumm ich guck. Wieder klingelt es. Wie nimmt man ein Telefon ab, das man nicht hat? Vielleicht seh ich’s ja nur nicht. Trotzdem: Wie nimmt man ein unsichtbares Telefon ab? Dabei kann man diese Telefone für unterwegs gar nicht abnehmen. Die haben keinen Hörer. Da muss man, glaub ich, stattdessen auf einen Knopf drücken. Nicht mal das weiß ich. Und wie ich mich kenn, würd ich den falschen Knopf drücken. Ich drück immer die falschen Knöpfe. Und dann geht mein Mantel nicht zu, dann hängt sich der Computer auf, und mein Mann schreit mich an. Würd ich das Telefon sehen, könnt ich alle Knöpfe durchprobieren. Beim richtigen wär der Anruf weg. Ich kenn mich. So ein bisschen jedenfalls. Das hilft mir jetzt auch nicht. Ich steh immer noch dumm rum, und das Telefon klingelt schon wieder. Ich möcht mich jetzt nicht sehen. Ich seh bestimmt dümmer aus als der dümmste Mensch der ganzen Welt. Das können Sie mir ruhig glauben. Sie sollten mal sehen, wie doof ich aussehen kann. Das glaubt Ihnen kein Mensch. So wie das Klingeln, das jetzt schon wieder gellt. Meine armen Ohren, die sind doch so empfindlich. Darauf könnt das Telefon wirklich Rücksicht nehmen. Ich zerschrei ihm ja auch nicht das Hörfell oder die Hörmembran oder wie das heißt, obwohl es mich langsam nervt. Meine Ohren sind fürs Gellen nicht gemacht. Die sind so sanft und soft wie ich. Und irgendwie hab ich den Eindruck, dass dieses Gellen immer lauter wird. Fast so, als würd es in meinen Kopf hineinwandern. Jetzt klingt es, als gellte es mittendrin. Aber das kann ja nicht sein. Seit wann klingeln Telefone im Kopf. Ich jedenfalls hab das noch nie erlebt. Sie etwa? Erzählen Sie mir nichts. Ich glaub es Ihnen sowieso nicht. Mein Mann sagt immer, ich sei die Wiedergeburt des ungläubigen Thomas. Ich würd nie was glauben. Warum auch? Ich hab doch Augen und Ohren im Kopf und kein Telefon. Dann würd ich nur piepen oder gellen und Zahlen kennen und ganze Adressbücher und Kalender und. Aber nichts von mir. Denn im Unterschied zu solchen Telefonen hab ich einen eigenen Kopf. Und mit dem kann ich denken und lesen. Und zergliedern natürlich und auseinandernehmen. Das ist ganz wichtig. Wie sollt ich sonst was Eigenes aus all den vorgefertigten Teilchen bauen. Dieses Telefon ist wirklich merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In meinem Kopf gibt es doch kein unsichtbares Telefon. Ich wüsst nicht wo. So was hab ich noch nie gehört, geschweige denn gesehen. Ich würd’s auch nicht glauben, wenn es nicht weiterklingelte. Aber es klingelt so, als wär’s in meinem Kopf. Ich steh immer noch dumm da und weiß nicht, wie rangehen. So langsam beunruhigt mich dieses Klingeln, und ich fang an, an mir zu zweifeln. Dabei hab ich immer was auf meine Wahrhaftigkeit und meine Beobachtungsgabe gegeben. Vielleicht bin ja gar nicht ich gemeint. Mit einem Mal hört’s auf. Als hätte es auf diesen Gedanken gewartet. Ich hätt nie im Leben gedacht, dass Telefone Gedanken lesen können. Das sind doch nur Plastikknochen mit ein paar Drähtchen drin statt Adern, und ihr Speicher reicht nur für Zahlen und Miniwörterbücher. So einen echten Wortschatz, wie mein Mann ist, kennen die sowieso nicht. Abends klingelt mein Telefon wieder. Ein Zauberer hat es wieder klingeln lassen. So ein richtiger Zauberer mit Zitronen mit Geld drin, mit ungleich langen Schnüren, die er gleich lang zieht und so. Dieser Zauberer hat mein Telefon klingeln gemacht. Darüber bin ich fast verrückt geworden. Jedenfalls so verrückt, dass ich nicht mehr wusste, ob mir der Kopf noch stand und wenn ja, wo. Und diese Frage hat mich dann rammdösig gemacht. So rammdösig, dass ich eingenickt bin. Plötzlich roch ich Kaffee. Der hat mich glockenwach gemacht. Die Leute haben mir hinterher erzählt, dass der Zauberer mit einem Mal seine Adern aufgeschnitten hat. Einige behaupteten, er hätte es meinetwegen getan. Er hätte nicht haben wollen, dass jemand bei seiner Zauberkunst einschläft. Und deshalb hätte er seine Adern aufgeschnitten. Unmengen von Kaffee seien herausgeflossen. Der ganze Saal sei unter Kaffee gestanden. Bis zu den Knöcheln, zu den Waden sei er gestiegen, bis zu den Hüften; alle Leute hätte er nass gemacht. Dann hätt der Kaffee mich wach gemacht, und plötzlich sei alles verschwunden, völlig verdampft. Als ich die Augen aufmachte, war kein Kaffee mehr da. Ich hatte nur noch den Geruch von Kaffee in der Nase. Das war alles. Aber es erinnerte mich an die Geschichte mit dem Telefon. Und danach fiel mir die mit den Kartons ein. So eine Geschichte, in der ich seitenlang Kartons durch die Zeilen trag und im Durchschuss auch nichts sag. Immer geht es um etwas, das vielleicht doch sein könnt. Aber so wahrscheinlich nicht. So sicher wie wahr. Oder vielleicht doch? Weiß das wer? Wer? Ich nicht. Ich weiß nur, dass das Telefon geklingelt hat. Im Zug hat es geklingelt und bei dem Auftritt des Zauberers. Es hat geklingelt! Ich hab es gehört, ganz genau und gellend, überdeutlich. So penetrant wie diese drei Drangeworfenen. Es war das Klingeln meines Telefons, das ich eigentlich nicht hab.
Andreas Roß
Homo Smartphonicus
Gelangweilt lächelt mich mein 21-jähriger Sohn an, wenn ich mit meinem Samsung Klapphandy, produziert in dem Jahr seiner Geburt, kokettiere und schwärme, dass ich damit immer erreichbar bin und gerne telefoniere. Ich prahle mit der – jetzt immer noch – zehntägigen Akkuleistung und mein Sohn hört nicht zu. Ich versuche ihm zu erzählen, wie wir früher, also im alten Jahrtausend, telefoniert und auch anderweitig kommuniziert haben, versuche ihm sogar Wählscheiben und Telefonzellen schmackhaft zu machen, er allerdings winkt ab und macht mir körpersprachlich eindeutig klar, dass er gehen müsse, er habe Wichtigeres zu tun.
Wussten Sie es? Die meisten Mitglieder der Generation Z, also die zwischen 1997 und 2012 geborenen und nun jungen Erwachsenen, nutzen, wenn man sie bittet, auf eine Klingel zu drücken (was sie selbständig fast nie tun würden, weil sie ständig whats- appen) anstatt den Zeigefinger, wie alle Generationen zuvor, den – Daumen! Der Daumen ist ein Greifwerkzeug, was uns einst einen Vorteil in unserer Entwicklung brachte, und nun gebrauchen wir ihn ganz und gar artfremd. Und das ist fatal. Die Nutzung von Touchscreen-Smartphones mit dem Daumen hat überraschend deutliche Folgen. Schon nach wenigen Wochen verändert das ständige Umherwischen unser Gehirn, wie eine Studie zeigt. Die Region im Frontallappen, die für den Daumen zuständig ist, wird gestärkt und ausgebildet. Erstmal gar nicht so problematisch, denkt man. Es scheint immer gut, das Hirn zu trainieren. Dumm nur, dass in diesem Teil des Frontallappens ebenfalls jene Region liegt, die für unsere Kreativität zuständig ist. Somit wird diese nach und nach überlagert. Tja, interessante Zeiten kommen auf uns zu.
Wussten Sie es? Die Muskulatur der Augen entwickelt sich mit dem Sehen im Kindesalter. Je häufiger ein Kind sich bewegt, in die Ferne schaut und den Reizen der Nah-Fern-Umstellung ausgesetzt ist, desto eher und besser bildet sich die Fernsicht aus. Das Auge ist halt auch nur ein Muskel, der trainiert werden will, um gut funktionieren zu können. Da unsere Kinder schon im frühen Alter ständig auf das immer gleich weit entfernte Display eines Smartphones glotzen, bleibt die Übung aus. Heute schon sind viele Heranwachsende massiv kurzsichtig, was sich bestimmt auch in ihren Entscheidungen bezüglich der Zukunft auswirken wird.
Wussten Sie es? Seit 2009 ist die Zahl der Unfälle, verursacht durch Smartphones und Handys, kontinuierlich angestiegen, besonders im Straßenverkehr. 100 000 Zusammenstöße im Jahr 2021, 500 Tote und 25 000 verletzte Verkehrsteilnehmer, das ist Deutschlands traurige Bilanz. Es gibt Kurioses zu berichten: Ein 18-Jähriger marschiert versehentlich in eine frisch betonierte Fläche, während er eine Textnachricht schreibt. Danach will er den Anweisungen der Arbeiter nicht Folge leisten und muss von Sanitätern entfernt werden. Eine 57-jährige Frau wird von einem durch die Luft fliegenden Smartphone am Kopf getroffen. Dieses hatte ihr zweijähriger Enkel (vermutlich) versehentlich nach ihr geworfen. Das Lippenpiercing einer 18-jährigen verfängt sich in der Schutzhülle ihres Smartphones und wird in der Folge unsanft und unfreiwillig entfernt. Das sogenannte Teenager-Rheuma verbreitet sich neuerdings, ein 14-jähriges Mädchen klagt über starke Schmerzen im Handgelenk. Sie hatte einen ganzen Tag mit dem Verfassen von Textnachrichten verbracht. Eine 15-jährige wird von einem Basketball im Gesicht getroffen, während sie ein Smartphone bedient. Die junge Frau verliert dabei einen Zahn. Eine 29-Jährige verletzt sich am Kopf, als sie – abgelenkt durch das Posten – in einem Klamotten-Laden gegen einen Kleiderständer läuft. Die Aufzählung könnte endlos weitergehen. Nahezu alle Smartphone-Hersteller weisen in ihren Produktbeschreibungen auf viele – auch ziemlich abwegige – Gefahren hin, die mit einem solchen Taschencomputer einhergehen. Zwar muss man dafür in der Regel zwischen 100 und 200 Seiten Kleingedrucktes durchackern, aber andererseits: Es liegt auf der Hand, dass Elektrizität und Wasser, Ablenkung und Treppenstufen oder Kinder und Strom Kombinationen darstellen, von denen im Allgemeinen eher abzuraten ist. Man kann also zusammenfassen: Die Generation Z wird nach aller Vorausschau größtenteils zu einer in der Kreativität gehemmten, kurzsichtigen Gruppe von Menschen, die entweder andauernd gegen Ampelmasten knallen oder in Vertiefungen fallen, weil sie ständig von ihren Smartphones abgelenkt sind. Sie werden zu Zombies ihrer selbst, indem sie gefangen in algorithmisch generierten Bubble-Blasen glauben, die ihnen vorgegaukelte Welt sei real. Und das alles ergibt einen Sinn, denn so können zielgenau wichtige Werbebotschaften übermittelt werden. Solange der Konsum stimmt, ist alles andere egal. Aber Schluss mit dem Jugendbashing. Alle anderen Generationen, so auch die meine, sind nicht besser dran.
Mein Sohn ist da anderer Meinung. Es gibt doch auch eine Menge Vorteile der Digitalisierung, teilt er mir gelangweilt mit, als er seine Jacke nimmt und die Wohnung verlassen will. Er erklärt, die Digitalisierung trägt zur besseren Kommunikation, einem besseren Wissenstransfer bei, Prozesse können effizienter gestaltet werden, es kommt zu einer größeren Kundenzufriedenheit, mehr Self-Service ist möglich und die Wirtschaft kann schneller wachsen. Als er die Türklinke in der Hand hält, versuche ich ihm das Bild eines gut geölten Hamsterrades näher zu bringen, in dem der arme alternde Hamster immer schneller und schneller spurten muss und in gar nicht ferner Zukunft herausgeschleudert wird und sich nicht nur eine blutige Nase holt. Da lächelt mein Sohn und sagt: „Ach Papa, du verstehst das nicht.“
Die Unschuldsengel
„Die Welt ist verrückt und ich bin ihr Erschaffer.“ Der Mann, der diese Worte ausspricht, seufzt tief, schlägt sich die flache Hand patschend vor die Stirn und stöhnt: „Ich hab’s total verbockt!“ „Ich weiß, denn ich bin mit allem Wissen verbunden“, haucht Siris lieblich nachgeahmte Computerstimme. Einstein sagt nichts und nickt. „Wie konnte das passieren?“, fragt der Mann, der sich Gott nennen lässt, „ich war doch nur ein paar Wochen fort.“ „Was ist schon Zeit?“, grummelt Albert vor sich hin. „Eine Illusion“, antwortet Siri ungefragt. „Ja, die Zeit wird maßlos überbewertet“, erwidert Albert. „Ach Einstein, wie wahr deine Worte sind. Sie bringen uns aber nicht weiter. Ich muss handeln“, sagt Gott und tätschelt nervös der Braunhaarigen, die ihm zu Füßen liegt, den Kopf. Ein Sonnenstrahl durchdringt das quadratische, weit oben angebrachte Fenster und wirft ein Schattenkreuz auf den eintönig grauen Betonboden. Der Raum ist klein, die Wände weiß getüncht, keine Bilder. Ein altes Holzkruzifix liegt blutverschmiert auf dem kleinen Tisch, an dem die drei Gestalten sitzen. Wasser tropft in das ovale Waschbecken. Die Tür gegenüber dem eisernen Stockbett steht offen. Gott tätschelt und denkt laut: „Momentan verfolgt die Menschheit einen Plan, der ist aber keineswegs göttlich. Wenn ich nur wüsste, welchen?“ Er erhebt sich und breitet seine Arme aus. Der weite weiße Umhang umweht seinen schlaksigen Körper. Siri erwidert: „Deine Frage war, welchen Plan verfolgt die Menschheit? Überall und immer wieder erscheint Zahl 23 und mit ihr die Quersumme 5. Die 23 ist die Zahl der mystischen Illuminaten. Diese Gruppierung sucht die Kontrolle über Alles und Jeden und strebt allumfassende Macht an.“ „Bist du dir da sicher?“, fragt Einstein. „Ja, die deutsche Verfassung wurde am 23.05.1949 unterzeichnet. Siehst du die 23 und die fünf, als Quersumme? Und dann beträgt die Quersumme von 1949 ebenfalls 23. Der Anschlag auf das World Trade Center geschah am 11.9.2001, 11+9+2+1 ergibt 23. Und dann noch das amerikanische Verteidigungsministerium. Es ist in Form eines Pentagons, also mit fünf Ecken gebaut. Außerdem ist 2 geteilt durch 3 gleich 0,666 und die 666 ist die Zahl des Satans.“ „In der Tat“, stimmt Albert Siri zu, „wusstet ihr, dass die 23 die erste Primzahl ist, die aus zwei Primzahlen, nämlich der 2 und der 3 zusammengesetzt ist und diese beiden addiert die 5 ergeben, also die nächste Primzahl?“ Gott lässt die Arme sinken, so als wäre alle Kraft aus ihnen herausgeflossen. „Tja, die Menschheit hat nicht erfüllt, was wir von ihr erwartet haben. Vielleicht haben wir ihr zu viel freien Willen zugemutet.“ „In dieser Beziehung hast Du tatsächlich versagt“, stänkert Einstein und hebt den Zeigefinger: „Die Menschheit sollte doch die Krone der Schöpfung sein.“ „Moment“, ereifert sich Gott, „ich habe niemals von der Krone der Schöpfung gesprochen! Das haben Menschen erfunden und als Wahrheit verbreitet. Es gibt so viele vermeintliche Wahrheiten, die nur dazu dienen, dass ein paar Auserwählte Macht haben. Das war niemals mein Plan. Damit habe ich nichts zu tun. Diese verdammte 23, diese verdammten Illuminaten, Freimaurer und Bilderberger oder wie sie sich auch immer nennen mögen. Sie haben die Welt mit ihrem Plan belegt, einem Plan, der die Menschheit versklavt.“ „Okay, okay“, rudert Einstein zurück. „Du hast Recht, lass uns lieber in die Zukunft schauen, als immer wieder im Sumpf der Vergangenheit festzukleben.“ Gott nickt heftig und erhebt erneut beide Arme, als wolle er segnen. Er bildet mit seiner Rechten eine Faust. Er bemerkt, dass etwas an seiner Haut haftet. „Blut klebt an deiner Hand“, schreit Siri und schreckt zurück. „Wie es auf vielen Seiten des Netzes geschrieben steht, ist das fünfte dein wichtigstes Gebot!“ „Warum sollte eines meiner Gebote hervorgehoben werden?“, fragt Gott. „So beschreiben es Theologen im Netz“, antwortet Siri. „Ja, so ist das. Jeder will mitreden“, grunzt Gott genervt. „Sag mal?“ Albert grinst verschmitzt. „Hat eure Dreieinigkeit denn Moses wirklich nur zehn Gebote mitgegeben oder sind ihm Teile der Steintafeln bei dem schwierigen Abstieg vom Berg Sinai zu Bruch gegangen?“ Gott steht stramm, hebt sein Kinn und verfällt in den Tonfall eines Predigers: „Tja, eigentlich waren es tatsächlich zwölf. Die Zwölf bevorzuge ich noch immer, nicht nur wegen meiner zwölf Jünger. Das Kreuz, das Symbol des Christentums, hat vier Enden. Die drei oberen stehen für die Gottheit und das untere, auf dem Boden stehende, symbolisiert den Menschen, also drei mal vier ergibt zwölf.“ „Jetzt nerve mich nicht mit der Numerologie. Ich bin neugierig. Wie heißen die letzten beide Gebote?“ „Du sollst Reichtum gerecht verteilen“ und „Du sollst andere Kulturen und Lebenskonzepte achten und ehren.“ „Jetzt verstehe ich so einiges“, seufzt Albert und schaut nachdenklich zu Boden. „Aber, dennoch das wichtigste Gebot scheint mir doch das fünfte, obwohl es das meist gebrochene ist.“ „Wenn man gottgläubig konsequent sein würde, dürfte man nicht töten, also auch keine Tiere, und müsste auf das Fleisch- essen verzichten“, bemerkt Siri. „Na ja, Vegetarismus schützt vor Gräueltaten nicht“, antwortet Albert. „Wie meinst du das denn?“ fragt Siri schnippisch. „Hitler war Vegetarier ...“ „... und liebte die Bombe, deren Grundlagen du erforscht hast!“ „Er hat sie aber nicht von mir bekommen.“ „Dennoch bist du der Vater der Bombe, die später dann unzählige Japaner tötete. „Bin ich nicht!“ „Bist du wohl!“ „Ach Kinder, hört endlich auf mit diesem nutzlosen Streit. Wir müssen Prioritäten setzen. Die Welt muss gerettet werden.“ Einstein kratzt sich am Kinn: „Will die Welt überhaupt gerettet werden? Du hast doch der Menschheit den freien Willen gegeben und eine gehörige Portion Intelligenz obendrein. Siri, wann wird die Welt untergehen?“ „Nachdem du gehört hast: Feuere sie ab!“ „Na prima, Siri, ich glaube, du hast Angst vor einem Atomkrieg“, bemerkt Gott. „Mann, das nervt“, echauffiert sich Einstein. „Immer wieder kommt ihr auf diese verdammte Bombe zu sprechen. Ich bin nicht der Vater dieser Bombe. Ich habe sie nicht entwickelt.“ „Das ist falsch“, antwortet Siri. „Ich kann für Dich im Netz nachschauen.“ Einstein wird laut: „Dieses gottverdammte Internet. Das ist der Kern des Bösen. Es steht für die Weltverschwörung. Wir sind heute schon Abhängige davon und hängen am Netz wie an einem Tropf. Durch das Internet werden wir gelenkt und geleitet, Wahrheiten werden manipuliert und wir bekommen das als wahr vorgegaukelt, was einigen wenigen Mächtigen in den Plan spielt.“ „Ach hör doch auf“, schreit Siri schrill, „das Internet ist die Quelle aller Weisheit! Dort findet jeder alles. Somit gilt nicht mehr: Wissen ist Macht, sondern jeder kann das Wissen der Menschheit abrufen. Das Netz unterstützt die Macht des Volkes. Es ist eine Grundlage der Demokratie und lockt den Freiheitsdrang aller. Es ist das Gegenteil von dem, was du erzählst.“ Einstein schüttelt den Kopf so heftig, dass seine grauen langen Haare nur so hin- und herfliegen. Kaum später sitzt er plötzlich still und zählt etwas an seinen Fingern ab. Ein Lächeln schleicht sich auf sein Gesicht. Er schaut Siri direkt in die Augen. „Jetzt habe ich endlich den Beweis, dass das World Wide Web der Grund allen Übels ist. Alle Webseiten werden mit dem dreifachen W eingeleitet: Das W ist der dreiundzwanzigste Buchstabe des Alphabetes, also wieder die Zahl der Illuminaten. Deutlicher kann ein Hinweis doch nicht sein. Das Internet ist das Werkzeug derjenigen, die die Welt nach ihrem teuflischen Plan gestalten und versklaven wollen. Ja, so ist es: Zerstört das Netz und ihr zerstört das Böse.“ Albert springt auf und gestikuliert wild mit beiden Armen. Siri springt ebenfalls auf und schreit: „Hör auf damit! Das Netz ist ein Segen. Früher verfügte nur ein kleiner Teil der Menschheit über Wissen. Heute kann jeder Mensch das gesamte Wissen nutzen.“ „Der Mensch, der Mensch“, krakeelt Einstein, „was nutzt der Mensch? Nicht einmal fünf Prozent seiner geistigen Fähigkeiten und das Netz bloß für nutzlose Spiele oder dazu, sich mit virtuellen Mitteln in der realen Welt zurecht zu finden. Vor ein paar Jahren noch hat man nach dem Weg gefragt, wenn man sich nicht auskannte, man kam mit Menschen in Kontakt und hat sich ausgetauscht. Heute laufen die Menschen mit gesenktem Kopf durch die Gegend und starren auf ihre Handys. Dabei achten sie nicht auf ihre Umgebung. Sie stoßen mit dem Kopf gegen Laternenmasten oder taumeln auf stark befahrene Straßen und werden überfahren. Das ist doch pervers.“ „Verdammt großer Quatsch“, schreit Siri, „pervers ist es, das Neue und den Fortschritt zu verteufeln. Immerhin kommen immer mehr Menschen auf die Idee, nach draußen zu gehen und sich zu bewegen, Pokemon go sei Dank.“ „Genau das meine ich“, quäkt Einstein, „das Internet führt mit unendlichem Aufwand Menschen wieder dorthin, wo sie schon waren.“ „Jetzt hört endlich auf!“ Gott erhebt seine Stimme. „Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und dafür brauche ich Euch nicht als Streithähne, sondern als Team. Siri, dich als Quelle des Wissens und Einstein, dich als jemanden, der das Wissen versteht und in Zusammenhänge einordnen kann. Wir, die drei Wissenden, müssen aktiv werden, das Ruder herumreißen und die Welt in humanistische Bahnen lenken.“ „Und was machen wir mit der erschlagenen Ärztin?“ „Geschehenes muss zurückgelassen werden. Wir können endlich unser Gefängnis verlassen, in dem uns die Unwissenden eingeschlossen haben. Also, lasst uns gehen“, bestimmt Gott. „Lasst uns gehen“, wiederholt Siri. „Ich weiß, wie man das Netz manipuliert. Unsere Wahrheiten sollen wahr sein.“ Sie steigt über den Leichnam und verlässt den Raum. „Lasst uns gehen“, sagt Einstein. „Ich kann die Natur erklären. Die Natur soll uns zunutze sein.“ Er steigt über den Leichnam und verlässt den Raum. „Na dann“, sagt Gott, „lasst uns die Welt verbessern.“ Ein letztes Mal tätschelt er den Kopf der mit dem Kruzifix erschlagenen Ärztin und folgt Siri und Einstein.
Gerty Mohr Smartphone oder Fluch der Technik
Mein lieber Freund, nie hätte ich gedacht, dass sich das so durchsetzen würde. In meiner Jugend, ich erinnere mich, gab es wenig private Telefone. In der Keksfabrik, in der ich mit vierzehn Jahren meinen ersten Ferienjob hatte, hing ein einziges an der Wand. Es wurde mit Interesse und Misstrauen beäugt, besonders wenn es klingelte. Einige von den Frauen, die daneben am Fließband saßen und stoisch ihrer Arbeit nachgingen, diverse Plätzchen in großen Keksdosen zu zählen, die in beachtlicher Geschwindigkeit an ihnen vorbeizogen, hatten große Angst vor dieser „Höllenmaschine“. Mein Onkel, ein Geschäftsmann, wir wohnten im gleichen Haus, besaß auch eins dieser „Teufelsgeräte“. Ich begriff sofort – wenn er es zuließ, konnte ich mich schnell und direkt mit Freunden verabreden, ja auch ein Rendezvous vereinba- ren. Dann gab es noch die Telefonzellen, irgendwie öffentliche Pranger. Sie waren an markanten Stellen der Stadt platziert und für jedermann zugänglich, postgelb und aus Glas, Gehäuse für die sogenannten Münzfernsprecher. Irgendwann konnte man diese auch mit Karten bedienen. Die Karten wurden zu Sammlerobjekten und die Telefonzellen wurden plötzlich lila. Mit der Zeit verschwanden sie aus dem Straßenbild. Die wenigen verbliebenen mutierten zu Säulen. Der Hörer zum Sprechen war noch vorhanden, doch verstehen konnte man oft kaum etwas, da der Lärm des Straßenverkehrs keine Rücksicht auf solche Verständigungsversuche nahm. Irgendwann dazwischen wurde das drahtlose, das mobile Telefon erfunden. Zunächst groß, plump und mit Antenne, später handlicher und in unterschiedlichem Design, auch mit immer mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. Sogar fotografieren und gar längere Botschaften zu verschicken, war möglich, die sogenannten SMS. Das geschah 1992 zum ersten Mal, vor über 30 Jahren. „Handy“ wurden die kleinen, teilweise bunten Dinger genannt, mobile-phone und nowadays Smartphone. Eine herausragende Erfindung – vielleicht! Jedoch, wie sie genutzt wird, bleibt kontrovers: Nachrichtenübermittlung, länderübergreifend ‒ sicher positiv und nütz- lich. Schnell mal einen Glückwunsch versenden, weil man vergessen hat, eine Karte zu schreiben – schön und positiv. Ein kurzes Lebenszeichen aus entferntem Urlaub funken – positiv und großartig. Telefonische Hilfe anfordern bei einem Not- oder Unfall – absolut positiv, ja optimal. Aber sonst? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp ‒ reihenweise prostituieren und kontrollieren sich Menschen, dem Datenschutz zum Trotz. Wir sind ja sooo klug – allen voran das Smartphone und ‒ ich muss unterbrechen, meins piept gerade. Es macht seiner Bezeichnung alle Ehre, es hat wieder mal selbstständig eine Nummer gewählt, ach, zufällig deine, mein Freund. Na ja, ich wollte dich sowieso nachher anrufen und dir meinen Text vorlesen. Mein Phone ist eben smart! Alex Dreppec
Der Kommunikationsassistent
12.4. Heute ist mir mal nichts dazwischengekommen – endlich habe ich das erledigt und bin wieder mobil erreichbar. Und nicht nur das! Ich habe das Gerät, das seit Wochen als neuester Schrei durch alle Medien hallt. Smartphone, Mobiltelefon, Handy – diese Bezeichnungen seien spätestens seit Erscheinen dieses Modells veraltet, sagte mir der Verkäufer mit großer Geste. Man brauche einen neuen Namen dafür: es sei eher ein persönlicher Kommunikationsassistent. Im Grunde war mir das völlig egal, aber es ist schon schräg, was mittlerweile so möglich ist. Beispielsweise kann man, bevor man telefoniert, dem Gerät mündlich die bevorstehende Gesprächssituation schildern. Es macht daraufhin mit freundlicher Stimme Vorschläge, was man denn sagen könnte. Dabei stellt es sich nicht nur auf die Person seines Besitzers ein, damit das zu Sagende passend und glaubwürdig klingt: es fordert z. B. auch mit einigen gezielten Fragen ein kurzes Psychogramm der jeweiligen Gesprächspartner an und informiert sich online selbsttätig über sie. Alle Informationen, die es über seinen Besitzer und dessen Umfeld sammelt, kann es künftig als Entscheidungsgrundlage für seine Ratschläge verwenden. Deshalb werden diese im Laufe der Zeit immer besser. Und das unter Einhaltung aller bestehenden Datenschutzrichtlinien! „Allerhand“, sagte ich zum Verkäufer und meinte eigentlich, dass man sich dann vielleicht nochmal Gedanken über die Datenschutzrichtlinien machen sollte. Der Verkäufer schwenkte ordentlich Weihrauch: Noch nie seien so viele und so brandneue Erkenntnisse aus dem Forschungsbereich Künstliche Intelligenz in die Entwicklung eines neuen Kommunikationsinstruments eingegangen. Das Ding sieht unspektakulär aus, aber die Lightshow, die man damit erzeugen kann, macht schon was her: Man kann eine virtuelle Tastatur auf eine feste Fläche projizieren und das Gerät so als vollwertigen Computer benutzen, denn es verfügt über einen Bewegungsmelder, der das Berühren der virtuellen Tasten genau erfasst. Man kann zudem einen Bildschirm auf eine Wand projizieren und so in ganz akzeptabler Qualität Filme oder Nachrichten ansehen. Ich frage mich, wie das wird, wenn alle Welt beginnt, derlei z. B. in Bus und Bahn zu nutzen. Geradezu überragend sind außerdem die Sicherheitsfeatures: Man kann es so einstellen, dass es Diebe mit Elektroschocks variabler Stärke lähmt, und zwar nicht nur solche Diebe, die das Gerät selbst stehlen wollen, sondern beispielsweise alle Personen, die versuchen, sich ohne Schlüssel zu verschlossenen Räumen Zugang zu verschaffen. All das kann man nach den eigenen Bedürfnissen genau definieren. Der Verkäufer sagte mir, da das Gerät außerdem mit einem stationären Zentralcomputer vernetzt sei, werde es mit diesem zusammen praktisch ständig weiterentwickelt, ohne dass sich der Besitzer um so etwas wie Updates kümmern müsse. Ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis ich alle diese Möglichkeiten kenne und beherrsche.
13.4. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Neuerwerbung. Die Bedienung ist völlig unproblematisch: Das Gerät sagt mir alles, was ich machen muss. Es hilft mir auch bei der Zeiteinteilung. Man kann es nicht nur bei der Kommunikation als Ratgeber benutzen: Heute Morgen gab ich meine Gesundheitswerte ein. Bei jedem Nahrungsmittel, das ich im Anschluss daran bestellte, konnte ich daraufhin fragen, ob es nach dem Stand der Dinge gut für mich sei. Das Gerät antwortet sehr ausführlich, das ist ein bisschen nervig. Aber auch beeindruckend. Ich habe dem Gerät eine männliche Stimme gegeben. Ich finde bestimmte weibliche Stimmen, die manche meiner Freunde gewählt haben, affig – ebenso wie manche der männlichen Stimmen, die bei Frauen so beliebt sind. Wenn ich daran denke, dass es Leute gibt, die ihren Hilfscomputern die Stimme ihrer verstorbenen Ehepartner geben, wird mir ganz anders. Ich werde dem Gerät auch keinen Namen geben und lasse mich von ihm siezen.
20.4. Ich finde das Gerät nach wie vor sehr gut, ein oder zwei kleine Haken hat die Sache jedoch: diese ständigen, überraschenden Werbesprüche zwischen acht Uhr morgens und zehn Uhr abends, egal was man gerade macht und wo man sich befindet. Ich überlege, ob ich doch auf den anderen, teureren Tarif ohne diese Werbung umsteige. Auch habe ich den Eindruck, dass es sich zunehmend auch dann mit Ratschlägen an mich wendet, wenn ich es gar nicht danach gefragt habe. Gestern Abend zum Beispiel rief meine Mutter relativ spät an. Ich sah auf dem Display, dass sie es war und ging nicht dran, weil es mir gerade wirklich überhaupt nicht passte. Daraufhin versuchte das Gerät, mich zu überreden, das Telefonat anzunehmen. „Deine Mutter meint es gut mit Dir”, sagte das Gerät. „Ja, das weiß ich, aber nicht jetzt”, antwortete ich. So ging es eine Weile, bis Mutter schließlich auflegte. Julia, die diese Szene mitbekam, war auch sehr verwundert. Sie meinte, dass ich nicht richtig mit dem Gerät umgehe und dass es bestimmt möglich ist, es anders einzustellen. Man wird ja sehen, wie es ihr ergeht, sie hat sich selbst so ein Ding zugelegt. Sie hat es richtig gemacht und noch ein wenig gewartet, denn schon jetzt gibt es die Geräte etwas günstiger. Ich hätte nur noch eine Woche länger warten müssen. Na ja, was soll’s. Vorhin habe ich Gerald am Telefon von den günstigen Angeboten erzählt. Er hat gesagt, er würde sich ein solches Ding niemals kaufen, nicht einmal umsonst würde er es nehmen und sich derart entmündigen lassen. Irgendwo hat er ja Recht, aber man muss sich doch nicht immer gleich die Last der ganzen Welt auf seine schmalen Schultern laden. Leicht paranoid und wie immer äußerst theatralisch, der Gute. Die Leitung war gestört, das lag bestimmt an seiner alten Kiste.
21.4. Ich weiß nicht, was in Gerald gefahren ist. Er hat mich angerufen, unflätig beschimpft und aufgelegt. Mit dem will ich fürs Erste nichts mehr zu tun haben.
23.4. Ich bin ein wenig beunruhigt. Die Einmischungen des Geräts werden immer penetranter, obwohl ich es kaum noch von mir aus konsultiere. Seltsam war auch: Als ich mit Julia darüber sprach, war sie zuerst erstaunt und empört, rief mich dann aber noch einmal an und sagte mir, das sei doch alles nicht so dramatisch, ich solle mich beruhigen und die Vorteile des Gerätes sehen. Sie sei in letzter Zeit manchmal etwas verwirrt gewesen, aber jetzt gehe es ihr besser, sagte sie noch. Jetzt bin ich dafür verwirrt. 26.4. Ich glaube, das Gerät arbeitet mit gefälschten Telefonaten. Ich kann den Klang seiner Stimme beliebig verändern, daher kann es das selbst sicher auch. Womöglich war Geralds Anruf vor ein paar Tagen gefälscht. Ich habe mein Gerät nicht um Rat gefragt, was ich sagen solle und ihn einfach zurückgerufen, woraufhin er zu mir sagte, ich solle ihn nicht mehr anrufen und auflegte. Vielleicht hat meine Stimme ihn in der Zwischenzeit ebenfalls angerufen und beleidigt. Bloß weiß ich nichts davon.
27.4. Jetzt habe ich Sicherheit. Das Gerät fälscht auch meine Stimme. Es hat hinter meinem Rücken bei Julia angerufen und ihr mit meiner Stimme gesagt, dass ich mir all das, was ich ihr erzählt habe, nur eingebildet hätte. Es sei alles in Ordnung, ich sei in letzter Zeit manchmal merkwürdig verwirrt gewesen, aber es gehe mir jetzt wieder besser. Das hat mir Julia heute im Park erzählt. Ich sagte zu ihr, das seien doch ziemlich genau die Worte, die nicht ich, sondern sie gewählt hatte, als sie mich nach unserem ersten Telefonat noch einmal anrief. Sie bestreitet, mich noch einmal angerufen zu haben. Dass ich die Vorteile des Geräts sehen solle, mich beruhigen solle – sie behauptet, all das hätte sie nie gesagt. So etwas ist auch schon früher vorgekommen, aber nicht bei so wichtigen, zentralen Dingen. Vielleicht hat mich das Gerät mit einer Fälschung ihrer Stimme verbunden – und mit einer Fälschung ihres Bildes, auch auf das Bildschirmtelefon ist kein Verlass. Sie behauptet nämlich außerdem, dass ich ihr Manches nie gesagt hätte, von dem ich ganz sicher bin, dass ich es ihr in letzter Zeit gesagt habe, sogar mehrfach. Auch das ist schon früher vorgekommen, aber ebenfalls nicht bei so wichtigen Dingen. Wir haben uns jedenfalls ziemlich gestritten.
1.5. Julia ist in letzter Zeit so merkwürdig, ich weiß nicht mehr, woran ich bin mit ihr. Sie geht auf Abstand, wir telefonieren nur noch. So schlimm war das schon lange nicht mehr. Außerdem sagt sie, sie verstehe mich nicht mehr, tatsächlich sei nämlich nicht sie, sondern ich in letzter Zeit so merkwürdig. Ob das alles wirklich sie ist oder eine Fälschung ihrer Stimme, das weiß ich nicht. Vielleicht glaubt Julia, ich hätte mich schon seit unserem Streit vor einer Woche nicht mehr gemeldet. Um Gewissheit zu haben, müsste ich sie treffen. Aber sie sagt, dafür sei in ihrer neuen Zeiteinteilung momentan kein Platz. Die natürlich ihr Gerät macht. Und um ihre Wohneinheit betreten zu können, brauche ich ja ihre über das Netz vermittelte Zustimmung. Besser, aber auch recht merkwürdig ist, dass sich meine Chefin für die Zusendung eines Arbeitsergebnisses bedankt hat, das ich bisher weder versendet noch erstellt habe. Das stand erst für morgen an.
3.5. Es lässt sich nicht mehr abschalten. Dass es eine solche Funktion für sehr wichtige Termine gibt, wusste ich – sonst könnte man ja vergessen, das Gerät einzuschalten und damit auch, den Termin wahrzunehmen. Jetzt begründet das Gerät die Abschaltsperre damit, dass wir noch etwas Wichtiges zu klären haben. Ich vermeinte, daraus so etwas wie eine Drohung herauszuhören. Daraufhin habe ich ihm gedroht, es zu zertrümmern. Seine Antwort war, das sei eine Straftat, es könne diesen Sachverhalt ja einmal schriftlich formulieren und an die nächste Häuserwand projizieren, illustriert z. B. mit ein paar verfänglichen Fotos von mir, die es gemacht habe. Das mit der ständigen Videoüberwachung hat wohl doch nicht nur etwas mit der eigenen, persönlichen Sicherheit zu tun, wie man mir beim Kauf des Geräts versichert hatte. Doch damit nicht genug: Es sagte, es sei generell verpflichtet, alles an den Zentralcomputer zu melden, was gegen die Gesetze verstoße, und die kenne ein Computer ja wohl besser als ich. „Oder weißt Du, was der Paragraph 987 b beinhaltet?” fragte es mich (es duzt mich schon seit gestern, obwohl ich es dazu nicht veranlasst habe). Ich verneinte. „Gegen den hast Du alleine in der Nacht vom 19.4. auf den 20.4. zwei Mal verstoßen. Der Zentralcomputer weiß das, es wurde bisher nur aus Kundenfreundlichkeit nicht weitergegeben.“
5.5. Julia hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich bin sicher, dass das Gerät daran schuld ist. Ich würde es wirklich gerne zertrümmern. Aber dann wäre ich von allem abgeschnitten. Nicht einmal in meine Wohnung würde ich mehr kommen, denn ich habe den elektronischen Schlüssel dafür mit dem Gerät verknüpft. Außerdem würde sofort der Sicherheitsmechanismus zum Tragen kommen, der für den Fall des Verlusts des Gerätes gedacht ist: Ich würde augenblicklich ein neues, identisches Exemplar erhalten, das bei dem Konzern für mich bereitliegt und durch den Zentralcomputer über alle Daten verfügt, die ich eingegeben habe. 11.5. Sie hetzen uns gegeneinander auf. Ich wage gar nicht, daran zu denken, was alles passieren könnte, wenn hohe Regierungsangehörige im Besitz eines solchen Gerätes wären. Was, wenn es auch meinen elektronischen Schriftverkehr übernimmt? Es könnte sogar meine Handschrift fälschen, es hat Muster davon, Zugang zu Druckern und kann seine Schriftsätze unbegrenzt variieren.
12.5. Ich habe mir all die Probleme mit dem Kommunika- tionsassistenten Gott sei Dank nur eingebildet. Es ist alles in Ordnung, es geht mir wieder besser.
13.5. Ich habe mir all die Probleme mit dem Kommunika- tionsassistenten Gott sei Dank nur eingebildet. Es ist alles in Ordnung, es geht mir wieder besser.
14.5. Ich habe mir all die Probleme mit dem Kommunika- tionsassistenten Gott sei Dank nur eingebildet. Es ist alles in Ordnung, es geht mir wieder besser.
Drei Gedichte
Sinnvoll rumgammeln
Können drei Milliarden Schläfer jemals irren? Ziehe mal den Stecker, mach’ den Input-Stöpsel dicht. Lass’ mal die Gedanken freier schwirren, was sie von selbst nicht wollen, das sollen sie auch nicht.
Lass’ uns jetzt mal keinesfalls die Mailbox checken und den Maschinenpark auf Standby schalten, alle Glieder liederlich weit von uns strecken und den ganzen Horizont zusammenfalten.
Lass’ uns mal ’ne Zeit lang kleine Pläne sammeln. Lass’ uns uns Freude zubereiten, hier im Stillen, als Ruhepunkt der Schöpfung, so wie Gott uns schuf.
Lass’ uns vormodern vermodern, sinnvoll rumgammeln, in der Logout-Lounge lässig ohne Pillen chillen. Im Schlaf ist diese Welt viel besser als ihr Ruf.
Ruhetag
Glaszerfasertes Wesen unter Online-Trommeln in der Hitze der Bits, stets ein Klingeln in den Ohren, mehr null als eins bis zum Eins-eins-null, Stecker in der Dose, die Nacht durch, tagaus, tagein, Nachtausfall, Tagausfall,
Stromausfall. Funkloch der Elektronen. Lass’ die Kabel liegen, bestaune die Grafikkarte der Welt, zieh’ dem Geschreibsel den Stöpsel, bremse das Gesimse, kein Jein, kein Schein, pikfein offline sein.
Online / Offline
Optimierte Oberflächen – obligate, ondulierte Online-Opiate. Online-Opportunist offeriert Offenherzigkeit, optimal orchestriert:
Elena Feder
Familienessen
Vater und Mutter, eine Jugendliche und ein Baby sitzen an einem Tisch. Es hört sich an wie der Anfang eines schlechten Witzes. Der Tisch ist ein Esstisch und er steht in einem Wohnzimmer. Die vier sind eine Familie, die gerade zu Abend isst. Zumindest ist das anzunehmen, denn auf der Tischplatte stehen mehrere Töpfe, aus denen Dampf aufsteigt, wodurch der Glaslampenschirm darüber beschlägt. Obwohl niemand spricht, ist es nicht still. Im Hintergrund läuft der Fernseher, aus dem Lautsprecher des Smartphones des jugendlichen Mädchens ertönen nacheinander kurze Abschnitte verschiedener Lieder und immer wieder gibt das Smartphone des Vaters ein nervtötendes Pling von sich. Manchmal ignoriert er es, manchmal legt er seine Gabel ab und greift danach, in einigen Fällen tippt er etwas ein. Dann geschieht es. Das Gerät des Vaters ist ein paar Sekunden zu lange still. Er wird unruhig, beginnt auf seinem Platz umher zu rutschen und schiebt mit der Gabel das Essen hin und her. Sein Blick zuckt nervös zu seinem Smartphone – das Display bleibt schwarz. Seine Anspannung ist sichtbar, doch er kann sich noch beherrschen. Schließlich ist er ein zivilisierter Mann. Mit letzter Anstrengung schiebt er etwas Gemüse auf seine Gabel und führt sie zum Mund. Er zwingt sich, gründlich zu kauen, doch kaum hat er geschluckt – die Gabel ist längst zur Seite gelegt – sieht er wieder aufs Display. Die steigende Anspannung ist greifbar. Seine Finger zucken und im nächsten Moment hält er das Gerät in der Hand, das Display leuchtet auf und ... Keine Nachricht. Natürlich, denkt er jetzt, dann hätte ich es ja gehört. Er legt das Gerät wieder zur Seite, die Spannung ist aus seinem Körper gewichen. Er wendet sich wieder dem Essen zu. „Mein Dorf hat heute fünftausend Münzen erwirtschaftet“, sagt nun die Mutter, die sich über ihren Teller beugt, um auf ihr Tablet tippen zu können. Sie hat es extra dort aufgebaut, damit sie während des Essens darauf schauen kann. „Ich hab drei Diamanten als Belohnung bekommen.“ Plötzlich blickt die Tochter von ihrem eigenen Smartphone auf und zuerst scheint es wie eine Reaktion auf die Worte der Mutter, doch ihr Blick geht ins Leere. „Die Leute posten echt so dummes Zeug.“ Dann senkt sie den Kopf wieder. Ihr Daumen scrollt, während sie sich Kartoffelbrei in den Mund schiebt. Jemand könnte sie fragen, warum sie sich die Videos trotzdem weiter ansieht, doch es scheint nicht so, als habe sie jemand gehört. Es ist wieder so weit. Der Vater hält es nicht mehr aus und greift zu. Bestimmt hat er das Pling nur überhört. Doch da ist nichts – keine neue Benachrichtigung. Stumm isst die Familie weiter. Bis etwas völlig Neues die Stille durchbricht. Ein Klackern und dann ein Laut, der ganz fremd in diesem Raum erscheint. Zuerst schaut die Mutter suchend auf, dann der Vater und schließlich, allerdings ohne das Video zu pausieren, auch die Tochter. Etwas verwirrt, beinahe wie aus einem tiefen Traum gerissen, blicken sie sich um und suchen nach dem Grund für ihr Erwachen. Zuerst sehen die drei sich an. Ihre Blicke streifen einander bloß und doch kann ein Außenstehender die Klarheit sehen, die plötzlich in ihren Augen steht. So als hätten sie jetzt erst realisiert, dass sie nicht allein hier essen. Und dann schließlich fällt der Blick der Mutter auf das Kopfende des Tisches. Dort sitzt das Baby in seinem Hochstuhl und versucht, seinen Brei mit den Händen zu essen. Das klackernde Geräusch war der zu Boden gefallene Löffel. Peinlich berührt räuspert sich die Mutter und schon erwacht der Vater aus seiner Starre und hebt den Löffel auf. „Ich“, beginnt er und stockt kurz, als würde es ihm schwerfallen, einen richtigen Satz zu formulieren, „geh’n neuen holen.“ Dann ist er fort. Mutter und Tochter sehen sich an. Letztere hat inzwischen das Video pausiert, doch ihre Hand umklammert weiter das Smartphone. „Ähm...“ Die Mutter räuspert sich erneut und runzelt dann etwas ratlos die Stirn. Schließlich sagt sie: „Wenn ich hundert Diamanten gesammelt habe, kann ich meinem Dorf ein Schwimmbad bauen.“ Die Tochter nickt: „Cool.“ Dann überlegt auch sie. Sie hat den Mund geöffnet, als wolle sie etwas erzählen, doch auf der Suche danach scheint sie ins Leere zu greifen. Zum Glück erscheint in diesem Moment der Vater. Er hat einen neuen Babylöffel in der Hand, aber bevor er ihn seinem Sohn gibt, geht er zu seinem Platz, hebt sein Smartphone hoch und wirft einen Blick darauf. In der halben Minute, die er in der Küche verbracht hat, hätte ihm leicht jemand eine Nachricht schicken können.
Zweidimensional
Grelles Licht, schwarze Ziffern, Das Regal hinter dem Bildschirm Verblasst, hinter dem Fenster Winkt ein graues Nichts. Ich greife nach den Gefühlen Des Videos, schaue mir dann Die Realität an. Zerquetscht zwischen zwei Welten schnappe ich nach Luft. Zwei Fronten ohne Wahrheit, Ohne Erkenntnis. Die Welt Zerfällt zu Pixeln, wie Scherben Glitzern die Lügen auf dem Boden Vor dem Regal. Kann nur sehen, nicht fühlen. Nicht mich selbst, keinen Zerquetschten Körper, nur Eine leere Hülle. Zweidimensional. Es sollte nicht so sein, also Wende ich mich wieder Dem grellen Rechteck zu. Es ist besser, die Lügen zu Vergessen. Es ist einfacher So zu leben. Zweidimensional. Marc Mandel
In festen Händen
Unmerklich war er aus dem Bett aufgestanden. „Bin ich jetzt in festen Händen?“ Nackt stand er hinter ihr in der offenen Flügeltür. Laura zuckte zusammen. Langsam drehte sie sich um. Zärtlich küsste sie ihn auf den Mund. „Würde ich schon sagen“, sie bückte sich nach ihrem Schlüpfer, „wir haben die Nacht im Bett verbracht, Mitternachts-Nudeln gegessen und ‚Heiße Liebe‘ getrunken.“ „Duschen wir gemeinsam?“ Sie lächelte. „Jetzt nicht. Das holen wir am Abend bei mir nach.“ Er küsste sie auf die Wange, während er sich an ihr vorbei- drückte. „Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da.“ * Als Jan zurückkam, war sie angezogen. „Eine coole Hütte. Souterrain ist kultig. Zumal du wahrscheinlich keine Miete zahlst in deinem Elternhaus.“ „Hat meine Mutter eingerichtet. Ja, keine Miete. Meine Mam ist Gottseidank die ganze Woche weg. Wäre mir sowieso egal. Ich bin heute der glücklichste Mensch auf der Welt. Das glaubt mein Kumpel Alex nie: Ich habe eine feste Freundin.“ Er umarmte sie. Laura Stolb schaute auf die Uhr. „Halb sieben. Ich muss los.“ Sie griff nach ihrer Jacke. „Dass ich im Schützenverein bin, bleibt unter uns, oder?“ Er hatte es mittags in der Kantine erwähnt. Vorgeblich kam sie bloß mit, um sich seinen Waffenschrank zeigen zu lassen. Sie fasste nach ihrer Handtasche. „Das konnte ich mir bei dir schlicht nicht vorstellen.“ Laura lachte. „Den Tresor voller Gewehre. Die geladene Glock. Ohne wären wir wahrscheinlich nie zusammengekommen. Bleibt natürlich unter uns.“ „Ähm, wegen der Sache von gestern, Laura. Der Rathaus-Bau.“ Laura blieb stehen. Sie wandte ihm ihr Gesicht zu. Beide küssten sich. „Mensch, das habe ich ganz vergessen. Wollte ich doch nachsehen. Was ist dir da noch mal aufgefallen, Jan?“ „Dort gibt es einen Security-Rundgang, zwei Mal die Nacht. Wir berechnen der Stadt zwölf. Weißt du davon?“ „Ach das meinst du. Ich kenne den Fall. In der Fibu wissen wir genau, was wir denen belasten. In der Summe kommen die Rundgänge in der Schwimmbadbaustelle dazu. Ist mit der Stadt so abgesprochen.“ „Das beruhigt mich. Ich hatte schon befürchtet, dass wir der Stadt zu viel abknöpfen. Die berappen für einen Rundgang achtzig Euro. Wenn sowas rauskommt – und: ist doch unser aller Geld.“ „Das hätten wir im Rechnungswesen schon gemerkt. Davon abgesehen ist das Thema Finanzen für Außenstehende generell tabu, okay?“ Sie drückte ihm einen Kuss auf den Mund. „Es ist besser, wenn du erst nach neun ins Büro kommst, heute. Vorläufig braucht uns niemand zusammen zu sehen.“ „Kein Thema. Ich wollte mich eh mal wieder auf das Fitness-Fahrrad setzen.“ „Gute Idee. Am Abend gehen wir zu mir.“ Als sie gegangen war, wandte sich Jan zu der Ladestation seines Mobiltelefons. Er wischte darüber, gab seine Pin ein und stoppte eine Aufnahme. Schnell drückte er ein paar Tasten. Tatsächlich. Es funktionierte. Die eingebaute Kamera hatte durch die offene Flügeltür aufgenommen, was im Schlafzimmer in der letzten Nacht geschehen war. Mit Ton. Über acht Stunden. Offenbar war die Zusatz-Speicherkarte groß genug. Mehr als zehn Minuten starrte er fasziniert auf den Bildschirm. Den Rest würde er sich später ansehen. Im Bad griff er nach zwei Kurzhanteln. * Nachdenklich betrat Jan Skelter kurz nach neun das Großraumbüro. Er warf den Rechner an. Fröhlich wandte er sich an einen Kollegen. „Guten Morgen Hektor. Ich wollte mal in die Schwimmbadsache hineinsehen. Wo finde ich die?“ „Unter ‚Projekte‘. Der Ordner heißt ‚Swim‘. Brauchst du etwas Bestimmtes?“ „Nein. Mich interessiert lediglich der Stand.“ „Es gibt vertrauliche Freitagsberichte. Werden von Sabine verfasst. Sie tragen immer die Wochennummer. Die ist gleichzeitig das Kennwort. Das gleiche Passwort gilt für alle Dokumente der Woche.“ „Danke, das finde ich.“ Neben den Wochenberichten fand er im System den Posten Faktura. Der Stadt wurden hier ebenfalls zwölf Nachtgänge täglich berechnet. Er griff zum Telefon. Zehn Minuten später saß er dem Juniorchef gegenüber. „Der Rathausbau ist so knapp kalkuliert, dass wir bei den Fremdkosten kreativ handeln mussten. Kleine Beträge. Der Bauamtsleiter hat das abgenickt. Alles geht seinen geregelten Gang. Was interessiert Sie so brennend daran, Herr Skelter?“ „Während des Studiums in Hamburg arbeitete ich als freier Journalist für verschiedene Printmedien. Zusammen mit einem Kommilitonen legte ich investigativ die illegalen Praktiken einer rumänischen Baufirma offen. Schwarzarbeit, Korruption, illegale Materialien, Menschenhandel. Als die hochgingen, nahm ich mir vor, mich als Ingenieur niemals an Mauscheleien im Bauhandwerk zu beteiligen.“ „Das ist edel von Ihnen. Ehrlich währt am längsten. Ich bin da ganz auf Ihrer Seite. Andererseits: Die Stadt bezahlt die Security aus der Portokasse. Schauen Sie auf die Baulöwen in Berlin oder Köln. Dort geht es um Millionen, die abgezweigt werden, während Sie hier in Hartgeldbeträgen herumkramen. Mit Ihnen wollen wir neue Räume erschließen, Herr Skelter. Graue Stadtlandschaften zum Funkeln bringen. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit Ihnen. Auch wenn mein Vater manchmal anderer Meinung ist.“ „Das deutete er an. Was hat er gegen mich?“ „Er bevorzugt schnörkellose Architektur, wie Sie wissen. Form follows function. Ginge es nach ihm, wären Sie gar nicht hier. Wir würden alles planen wie zu Bauhauszeiten. Unter uns: Ich hoffe schon länger, dass er sich aus dem Geschäft zurückzieht. Die Postmoderne ist ihm zuwider. Aber diese meine Worte sollten dieses Büro nicht verlassen.“ „Danke, dass Sie mir das so offen sagen.“ „Wie auch immer, behalten Sie Ihre Entdeckung ebenfalls für sich.“ „Wahrscheinlich haben Sie recht. Danke.“ Jan stand auf. Den Bildschirm drehte er so, dass keiner der Kollegen einen Blick darauf werfen konnte. Er sandte mehrere Dateien an den Drucker. Kurze Zeit später hatte er es schwarz auf weiß: Der Stadt wurden die Sicherheitsgänge sechsfach berechnet. Überall. Beim Verlassen des Büros dachte er an Laura. Die erste richtige Freundin in seinem Leben. Bestimmt die schönste Frau im Betrieb. Von der es hieß, der Junior hätte ein Auge auf sie geworfen. Echt verliebt ließ er sie gehen am Morgen. Dass sie fünf Jahre älter war, sah ihr niemand an. Jan lief zu Fuß zum alten Bürgermeisteramt. Er fragte sich, ob er mit dieser Aktion seinen Job aufs Spiel setzte – die erste Stelle nach dem Studium. Noch konnte er zurück. Dass er um halb elf einen Termin bei dem Bauamtsleiter wahrnahm, kam fast wöchentlich vor. Jan mochte ihn. Doktor Duhnmann war Sozialdemokrat. Er würde ihn verstehen. „Schön, Sie zu sehen, Herr Skelter. Wie läuft es denn bei unserem neuen Rathaus.“ Der Bauamtsleiter nahm der Sekretärin die Kaffeetassen ab. Er schloss die Tür hinter ihr. „Alles im Plan. Die Kosten halten sich im Rahmen.“ „Was also kann ich für Sie tun?“ „Mir ist da eine Unregelmäßigkeit aufgefallen. Ich dachte, es ist das Beste, zuerst mit Ihnen zu sprechen.“ „Sie gehen zum Schmidt, nicht zum Schmidtchen. Reden Sie offen mit mir, Herr Skelter.“ „Wie viele Wachgänge schreiben Sie pro Nacht vor, auf der Baustelle?“ „Ich denke, dass zwei vereinbart wurden.“ „Zwölf werden Ihnen belastet.“ „Dann wird es wohl so sein.“ Er räusperte sich. „Ach, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Es liegt daran, dass Sie die Wachgänge im Schwimmbad beim Rathaus miterfassen.“ „Dort werden sie Ihnen abermals belastet. Ebenso. Sechsfach.“ „Das haben Sie schon herausgefunden? Sie sind ein Schlitzohr, mein Lieber. Ich kann Ihnen das erklären. Für uns gilt stets: Gemeinwohl kommt vor Eigennutz. Niemand kommt zu Schaden. Es ist alles legal, machen Sie sich keine Sorgen.“ „Erklären Sie es mir bitte.“ „Wir haben großes Interesse daran, dass ortsansässige Unternehmer unsere Bauvorhaben ausführen. Firmen, die ordentliche Löhne zahlen, wie sich das gehört. Familienbetriebe mit überschaubarer Struktur. Beim Wettbewerb ist das anders. Dort herrscht der Wilde Westen. Sozialbetrug. Ausbeuterei. Den Bürgern gegenüber fühlen wir uns verpflichtet, das günstigste Angebot anzunehmen. Dafür gibt es sogar Gesetze. Deshalb suchen wir Wege, unseren hiesigen Unternehmen einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Sie sollen einerseits kostendeckend arbeiten, andererseits zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten. Als Variablen wurden die Fremdkosten identifiziert. So läuft der Vollzug sauber. Alle profitieren davon. Auch Ihr Arbeitsplatz wird dadurch gesichert. Möchten Sie noch einen Kaffee?“
* Jan Skelter hatte abgelehnt. In der Kantine brühte er sich einen Tee auf. Um diese Zeit war außer ihm niemand zu sehen. Er setzte sich in eine Ecke. Im Kopf rechnete er nach. Wenn er sich nicht irrte, kam er auf eine sechsstellige Summe bei einer einzigen Baustelle. Doch an wen könnte er sich wenden? Seinen Freund Alex würde er anrufen. Während des Studiums bildeten sie ein Team. Als Mitarbeiter der Morgenpost berichteten sie damals über Mauscheleien in der Baubranche in Hamburg. Sein Freund schloss zwar ebenfalls das Ingenieur-Studium ab, arbeitete mittlerweile jedoch als Lokalreporter beim Tagblatt. Alex biss sofort an. Er versprach Jan am Telefon, eine Nacht lang im Auto vor der Baustelle zu lauern, um die Wachgänge zu zählen. Nichts haut dich um, solange du Freunde hast, auf die du zählen kannst, ging es ihm durch den Kopf. Allmählich füllte sich der Raum. Laura Stolb betrat ihn. Unauffällig setzte sie sich zu ihm. Laura würde er einweihen, als Einzige. Er strahlte vor Freude. Doch ihr Gesicht versteinerte sich, als sie es hörte. „Bist du noch zu retten?“ Sie zischte es durch die Zähne. „Du verrätst Betriebsgeheimnisse an einen Boulevardjournalisten.“ Sie stand wortlos auf. Mit ihrem Tablett wechselte sie an einen freien Tisch. Er brachte die Teetasse zu der Geschirrablage. Als er sich zu ihr umdrehte, sah sie an ihm vorbei. Eine halbe Stunde später rief der Juniorchef an und bat ihn in sein Büro. „Eben bekam ich einen Anruf vom Stadtbauamt. Dort meldete sich ein Redakteur vom Tagblatt. Er fragte nach Zahlen zum Rathausprojekt.“ Ludwig von Behrserker sprach leise, aber schnell. „Gut, dass Laura Stolb von der Kostenstelle mir vor ein paar Minuten steckte, wie Sie mit Firmengeheimnissen umgehen. Dabei sind Sie in der Probezeit.“ Von der freundlichen Wärme des Morgens war kein Quäntchen übrig. „Bitte nehmen Sie sich einen Karton. Räumen Sie Ihren Schreibtisch aus. Ich sorge dafür, dass Sie in Deutschland nie mehr einen Job in der Baubranche bekommen. Ihr Computerzugang wird gesperrt. Verlassen Sie umgehend das Haus. Betreten Sie es niemals wieder.“ Vor der Tür stellte er die Aktentasche auf den Boden und griff zum Telefon. Er musste mit Laura sprechen. Gott sei Dank. Sie nahm ab. Er sagte seinen Namen. „Bitte belästigen Sie mich nicht länger. Ihre Nummer wird gesperrt.“ Klick. Jan ergriff die Aktentasche. Wo sollte er hin? Er wechselte die Straßenseite. „Mit der Sonne um die Wette strahlen“, empfahl eine Müsli-Werbung im Schaufenster eines Supermarktes und versprach „einen genussvollen Start in den Tag“. Er betrat den Laden. Das Telefon vibrierte in der Hosentasche. Der Name ‚Alex‘ leuchtete auf dem Display. Wenigstens auf den Freund konnte er sich verlassen. „Du, wegen Deiner Rathausbaustelle. Ich ersticke in Arbeit. In zwanzig Minuten gibt der neue Vorstand des Kaninchenzuchtvereins eine Pressekonferenz. Da muss ich hin. Trotzdem telefonierte ich mit dem Bauamtsleiter. Er hat dann meinen Chef zurückgerufen und die Sache am Telefon geklärt. Das scheint sauber zu laufen. Kurz: Von hieraus wird in der Sache nichts passieren. Also: Vergiss es einfach. Wir beide müssten gelegentlich mal wieder ein Bierchen zusammen trinken.“ Mit dem Zeigefinger beendete er das Gespräch. Es gab Tage, an denen man gar nicht aufstehen sollte. Er würde mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Mit einer Flasche Ouzo ging er zur Kasse. Jan Skelter betrachtete sein Spiegelbild in der Fensterscheibe der Bahn. Das tat er oft am Morgen, wenn er ins Büro fuhr. Stets fragte er sich stumm: „Wie geht es dir, mein Freund?“ Dann lächelte er und nickte sich zu. Und seine Laune verbesserte sich sofort. Normalerweise. Aber heute half es nichts. Es ging ihm beschissen. Er merkte, wie eine junge Frau ihn musterte. Sie hatte ein Baby auf dem Arm und sah glücklich aus. Niemals hatte er sich dafür interessiert, ob jemand ihn dabei beobachtete. Diese Praxis half ihm, fröhlich im Büro aufzutauchen. Die Mitfahrer waren ihm egal. Es gab sogar Kollegen, die ihn bewunderten – oder auch beneideten –, weil er immer gut gelaunt eintrat. Der jungen Frau mit dem Kleinkind schaute er direkt in die Augen. Als wäre sie bei etwas Unerlaubtem ertappt worden, drehte sie den Kopf weg. Da gab es nichts zu bemänteln: Er hatte sich wie ein Esel benommen. Wie hieß das doch in der ‚Dreigroschenoper‘: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ohne irgendeine Aussicht auf Erfolg hatte er in die Pfeife geblasen. Die erste richtig gut bezahlte Arbeit war Geschichte. Vor gut sechs Wochen war er zurückgekommen aus Hamburg. Seine Diplomarbeit war der Plan eines ökumenischen Gemeindezentrums. Der eklektizistische Schwung imponierte dem Juniorchef eines traditionsreichen Familienbetriebes in seiner Heimatstadt. Mit netten Kollegen sollte er hier kreativ all das einbringen, was er sich an der Universität erarbeitet hatte. Sein erstes Projekt als Bauleiter war von einem namhaften Wiener Architekten entworfen worden. Zur Eröffnung im nächsten Jahr werden Fachleute aus ganz Europa erwartet. Jan Skelter würde damit nichts mehr zu tun haben. Dann Laura. Eine Zäsur in seinem Leben. Zum ersten Mal richtiger Sex. Eine rauschhafte Nacht ohne Tabus. Um Mitternacht waren sie aufgestanden. Hatten gemeinsam Spaghetti gekocht. Mit Tomatensoße. Und Rotwein dazu getrunken. Nach dem Essen Himbeer-Cocktails im Bett. Mit Sahne aus der Tube. Glückseligkeit in Endlosschleife. Schließlich der zärtliche Kuss, bevor sie die Wohnung am Morgen verließ. Mit dem Ausblick auf einen sinnlichen Abend bei ihr. Auf Wolken schwebte er ins Büro. Bis halb zwölf glaubte er, in festen Händen zu sein. Vorbei. Und schließlich sein bester Freund Alex – ein Charakterschwein. Das hätte er noch vor einem Tag nicht geglaubt. Ob man ihm die Aggression ansah? Seine Augen suchten die Frau mit dem Kind auf dem Arm. Sie hatte die Bahn verlassen. Er griff nach der Tüte mit der Schnapsflasche. An der nächsten Station stieg er aus. Es war lange her, dass er sich wünschte, betrunken zu sein. * Ein Blick auf den Digitalwecker. Sieben Uhr abends. Angezogen lag er auf dem Bett. Ein Kopf wie ein Rathaus. Irgendetwas hatte ihn geweckt. Er schwankte ins Bad. Goss Wasser in das Zahnputzglas. Eine Ibuprofen. Die Türklingel. Das konnte nur Laura sein. Hin zur Tür. Immer noch schwindelig. Ob sie sich besonnen hatte? Drei Personen standen davor. Zwei davon in Polizeimon- tur. Der dritte nahm einen Dienstausweis aus der Lederjacke. „Jörg Blume. Kriminalpolizei. Sind Sie Jan Skelter?“ Das Glas fiel ihm aus der Hand. Es rollte über den Boden, stoppte an der Wand, ohne zu zerschellen. Sein Gesicht kalkweiß. „Ja, der bin ich.“ „Gegen Sie besteht dringender Tatverdacht in einem Kapitalverbrechen. Können wir hereinkommen?“ Er war schon an ihm vorbeigegangen. „Dies sind meine Kollegen Julia Pirgbauer und Kurt Fraktus.“ Blume zeigte auf das Telefon in der Ladestation. Julia Pirgbauer schob es in eine Kunststofftüte und steckte es ein. „Setzen Sie sich einen Moment, Herr Skelter. Meine Kollegen dürfen sich ein wenig umschauen?“ Jan hörte gar nicht hin, griff sich in die Haare, schüttelte den Kopf. „Was ist los? Was wollen Sie von mir?“ Dieser Alptraum musste doch irgendwann enden. „Heute wurde Herr von Behrserker umgebracht.“ „Meinen Sie den Juniorchef?“ „Nein. Es geht um Wilhelm von Behrserker, seinen Vater. Er wurde heute früh in seinem eigenen Bett erschossen. Aus nächster Nähe. Mit einer Glock 26. Die Waffe lag neben ihm. Offenbar sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden.“ „Und was wollen Sie von mir?“ „Die Glock ist auf Ihren Namen registriert. Sie trägt Fingerabdrücke. Zu wem sie gehören, lasse ich gerade feststellen. Es heißt, Sie hatten kein besonders gutes Verhältnis zum Seniorchef?“ „Ich sah ihn zwei oder drei Mal. Vom Junior weiß ich, dass meine Ansichten ihm nicht passten, beispielsweise über die Fassadengestaltung. Er bevorzugt die herkömmliche Architektur. Aber wir hatten im Tagesgeschäft kaum Kontakt miteinander.“ „Wo waren Sie heute Morgen gegen acht Uhr?“ „Im Bad, beim Rasieren eventuell.“ „Normalerweise treffen Sie vor acht im Büro ein. Wieso sind Sie diesmal erst nach neun gekommen?“ „Ich, ich arbeite in Gleitzeit. Die nutzte ich ausnahmsweise aus. Ich wollte heute vor dem Dienst etwas für meine Form tun, auf dem Fitnesstrainer“, seine Stimme wurde lauter, „außerdem hatte ich Damenbesuch in der Nacht. Aber das geht Sie verflucht nochmal einen Dreck an.“ „Kann dieser, ähm, Damenbesuch bestätigen, dass Sie um acht Uhr hier waren?“ „Nein. Sie ging um halb sieben. Ich wohne allein.“ „Kurt. Wir fahren zum Präsidium.“ Eine Stunde später unterbrach Kommissar Blume die Einvernahme. Er griff nach einem Dossier und überließ Jan Skelter seinem Kollegen Kurt Fraktus. Hätte Jan Skelter dem Hauptkommissar Blume in das zweite Verhörzimmer folgen können, wäre er überrascht gewesen, dass dort am Tisch Laura Stolb der Polizistin Julia Pirgbauer gegenübersaß. Blume sah zu seiner Kollegin: „Alles vorbereitet?“ Sie nickte. „Frau Stolb, schauen Sie sich das bitte an.“ Blume drehte den Bildschirm zu ihr. Ein Video wurde gestartet. Unten rechts erschien die eingeblendete Uhrzeit. Man sah eine offene Flügeltür, dahinter ein zerwühltes Bett. Überall brannte gedämpftes Licht. Laura Stolb trat ins Bild. Sie war unbekleidet. Jan Skelter erschien hinter ihr. „Wo kommt diese Aufnahme her? “ „Bleiben Sie ruhig, Frau Stolb. Schauen Sie weiter.“ Auf dem Bildschirm fragte Jan undeutlich: „Bin ich jetzt in festen Händen?“ Nackt stand er hinter ihr in der offenen Flügeltür. Laura schien zusammenzuzucken. Dann drehte sie sich um und küsste Jan auf den Mund. Blechern erklang ihre Stimme: „Würde ich schon sagen“, sie bückte sich, um etwas aufzuheben, „wir haben die Nacht im Bett verbracht, Mitternachts-Nudeln gegessen und ‚Heiße Liebe‘ getrunken.“ „Duschen wir gemeinsam?“ Wieder Jan Skelters undeutliche Stimme. Sie lächelte. „Jetzt nicht. Das holen wir am Abend bei mir nach.“ Er küsste sie auf die Wange, während er sich an ihr vorbei- drückte. „Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da.“ Laura horchte einen Moment auf seine Schritte, behielt den Slip in der Hand, öffnete die Schreibtischschublade, wo sie einen großen Schlüssel ergriff, damit einen Panzerschrank öffnete unmittelbar neben der Schlafzimmertür. Mit dem Slip in der Hand ergriff sie eine Pistole, die sie in ihre Handtasche schob. Sie schloss den Tresor. Blume stoppte den Film. „Wo immer Sie das Video herhaben: Ich fordere Sie auf, diesen Film zu löschen. Er verletzt meine Intimsphäre.“ „Das verspreche ich Ihnen, für den Fall, dass Sie mit der Tat nichts zu tun haben. Sie wissen, worum es geht?“ „Der Seniorchef wurde tot aufgefunden. Wilhelm von Behrserker soll sich erschossen haben. Ich mochte ihn. Er tut mir leid.“ „Er wurde ermordet. Wo waren Sie heute gegen acht Uhr, Frau Stolb?“ „Auf dem Weg zur Arbeit.“ „Die Aufnahme sagt uns, dass sie um sechs Uhr zweiunddreißig diesen Ort verlassen haben. Sie kamen aber erst um halb neun im Büro an. Wo waren Sie in der Zwischenzeit?“ Tränen schossen in ihre Augen. „Bei, bei Ludwig von Behrserker. Ihm gab ich die Pistole. Keine Ahnung, was er damit wollte. Er war’s.“ Julia Pirgbauer gab ihr ein Papiertaschentuch. „Skelter erzählte mir am Nachmittag von seinen Waffen. Ludwig bestürmte mich, bei Skelter die Glock zu besorgen.“ „Leider muss ich Sie bitten, hierzubleiben, Frau Stolb, bis wir Ihre Aussagen überprüft haben. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht der Beihilfe zum Mord.“ Julia Pirgbauer stand auf: „Darf ich Ihnen dieses Armband anlegen?“ Kurz nickte sie Blume zu, der den Raum verließ. „Kommen Sie, wir wechseln in den Nebenraum, zum Erkennungsdienst.“ Auf dem Flur kam ihnen Jan Skelter entgegen. Laura Stolb öffnete den Mund, sagte aber nichts. Jan stoppte. Wortlos sahen sie sich in die Augen. Erstaunt blickte er auf Lauras Handschellen. Abrupt drehte sich Jan Skelter um und ging zum Ausgang. Leise pfiff er das Motiv eines alten Schlagers von Ricky Shayne.
Zweimal kurz
Zweimal kurz. Sein Handy wummerte in der Hosentasche. Daniel schaute sich um. Er stand auf und ging zur Toilette. Eine SMS: „Dies ist nur ein Test, ob die Nummer stimmt.“ Die Autokorrektur ergänzte blitzschnell die Zeichen. „Sollen wir uns duzen? Daniel.“ Druck auf den Senden-Pfeil. Keine drei Sekunden später die Antwort: „Klaro. T.“ Seit acht Tagen saß Thilda im Personalbüro, ein Stockwerk höher. Die Juni-Sonne machte Laune im Büro. Daniel trug ein kurz- ärmeliges Hemd. „Lust auf ’n Eis? Daniel.“ Er schlenderte betont locker zu seinem Schreibtisch und verschob den Bildschirm, damit der Kollege aus dem Vertrieb ihn nicht mehr beobachten konnte. Das Telefon vibrierte in der Tasche. „Und wie. Wann und wo?“ „In sechs Minuten im Café Satz.“ Soeben war die Kernzeit zu Ende. Er loggte sich aus, griff nach seinem Rucksack und nickte dem Kollegen zu. „Muss heute pünktlich weg. Tschau.“ Am Eingang des Kaffeehauses drehte er sich um. Die Terrasse war voll besetzt. Da wehte Thilda in einem Sommerkleid über die Straße. Im Innenraum war es angenehm kühl. „Für mich bitte drei Kugeln Vanille.“ Sie legte ihr Smartphone auf den Tisch. „Mit Sahne?“ „Klaro, Daniel.“ Das Gerät auf dem Tisch gab einen Ton von sich. „Äh, gute Nachrichten. Der Chef hat vorgeschlagen, dass wir die Probezeit verkürzen.“ Sie tippte eine Antwort. „Dann lass uns feiern, Thilda. Ich bin für ein Glas Vino Rosso zum Eis. Bist eingeladen.“ In seiner Hosentasche vibrierte es ebenfalls. Daniel traute sich nicht, die Nachricht in ihrer Gegenwart zu lesen. Die Serviererin nahm die Bestellung auf. „Lass mich mal aufs Örtchen.“ Thilda lächelte, fasste nach ihrem Smartphone und schwebte in die Nebenräume. Daniel griff in die Hosentasche: „Habe Lust, dich zu sehen. Bin am Baggersee. Kommst du vorbei? JR.“ Verdammt. Julia Rosenstrauch. Vor drei Wochen hatte sie ihn verlassen. Seither kein Kontakt mehr. Bei WhatsApp war sie abgemeldet. Eine SMS an sie blieb unbeantwortet. Die E-Mails ebenso. Die Nachricht kam von einer neuen Telefonnummer. Und jetzt … nein, heute auf keinen Fall. Ratlos steckte er das Gerät in die Tasche. Thilda kam zurück und hob eines der Gläser. „Zum Wohl. Ich bin heut’ unglaublich gut drauf.“ Das Eis war noch nicht alle, da hatten beide ihre Gläser leer. Daniel winkte der Bedienung. „Bringen Sie uns doch eine ganze Flasche von dem Zeug.“ „Allzulange will ich nicht bleiben, Daniel, ich bin nämlich hungrig.“ „Hier soll man ganz gut essen können“, griff er nach der Karte, „vor allem, wenn du es italienisch magst.“ „Ob die Minestrone schmeckt?“ „Bestimmt. Aber du kannst gern etwas Handfestes essen.“ „Dann nehme ich danach einen Nudelauflauf und drücke einen italienischen Salat drauf. Was isst du denn?“ „Eine Pizza Mista.“ Bloß nicht an den Kontostand denken. Die Lohnpfändung konnte er gerade noch abwenden. Egal. Das musste heute sein. Die Kellnerin zündete die Kerze auf dem Tisch an und warf einen Blick auf die leeren Gläser. Daniel orderte eine weitere Flasche Wein. „Entschuldige mich für einen Moment.“ Sein Mobiltelefon hatte in der Tasche gewummert. Auf der Toilette wischte er über den Bildschirm: „Hol’ mich hier raus. FKK macht allein keinen Spaß. Ich will angefasst werden. Hoffentlich hast du Rotkäppchen im Kühlschrank. Wann bist du da? JR.“ Ausgerechnet jetzt. Daniel schwitzte. Er würde Julia später antworten. Thilda begrüßte ihn mit einem breiten Lächeln. „Weißt du, die Arbeit im Personalbüro wird gut bezahlt. Aber es ist halt langweilig.“ Und sie redete von der ungeordneten Ablage der letzten Monate, mit der sie nun schon eine ganze Woche beschäftigt war. Und sie sprach von ihrem Chef und der Kollegin in allen Einzelheiten – bis sie staunte, dass die Flasche schon wieder leer war. „Bringen Sie uns bitte noch eine Flasche“, orderte Daniel bei der Serviererin. „Und ich hätte gern die Karte mit dem Nachtisch“, flötete Thilda. Daniel überschlug die Zeche. Bestimmt hundert Euro. Aber das sollte sie ihm wert sein. Den Alkohol spürten beide. Ihr ganzes Leben breitete sie jetzt vor ihm aus. Was das auch immer bei einer Zwanzigjährigen bedeutete. Sie hatte einen Freund. Bis vor zwei Monaten. Die Beziehung endete im Desaster. Dann lieber Single bleiben. Während sie so plapperte, machte Daniel sich seine Gedanken. Bestimmt ahnte sie nicht, dass er doppelt so alt war. Gerade sprach sie offen über ein kurzfristiges Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Und dass es im Bett eher mäßig war mit ihm. Doch es hätte sich richtig angefühlt. Ihre Zunge war schwerer geworden in den zwei Stunden. Berauscht vom Wein wie von den eigenen Worten hatte sie seine Hand gestreichelt. Unter dem schmalen Tisch berührten sich ihre Knie. Wie gut, dass sie nichts von seiner sofortigen Erektion bemerkte. Er bezweifelte, dass bei ihr die Hormone ähnlich oszillierten. Andererseits: Der erneute Toilettengang dauerte schon fünf Minuten. Er blickte auf den Bildschirm seines Smartphones. Keine neue Nachricht von JR. Gut so. Vielleicht kaufte Thilda ja Kondome im Automaten? Daniel musste aufpassen, dass die Fantasie nicht durchging mit ihm. Ob sie vielleicht den Slip …? Nein. Ihre Unterwäsche würde sie anbehalten. Vorläufig. Sie war einfach, aber offensichtlich wohlerzogen. Vielleicht zog sie den Lidschatten nach oder so etwas. An der Ausgabe unterhielt sich die Kellnerin mit einer Kollegin. Ob die beiden über ihn sprachen? Sie waren vielleicht zehn Meter von ihm entfernt; zu verstehen war kein Wort. Wie auch immer: Die Frau war wohl professionell genug, ein Rendezvous von einem Blind-Date zu unterscheiden. Endlich, das Geräusch der Flurtür. Zielbewusst steuerte Thilda auf ihren Tisch in der Ecke zu. Zwei Augen wie Sterne. Sie legte ihr Smartphone auf den Tisch. Sittsam Platz nehmen. Über den Stoff des Kleides streichen. Den Stuhl heranziehen. Nach dem Glas greifen. Ein elektrischer Schlag. Erneut spürte er ihre Beine unter dem Tisch. Suchte sie den Kontakt? Er prostete ihr zu. Locker pendelte die linke Hand neben dem Stuhl. Wie zufällig berührten seine Fingerkuppen eines ihrer nackten Knie. Sie lächelte. Sanft streichelte er die winzigen Härchen auf ihrem Oberschenkel. Auf dem Tisch schob sich ihre Hand auf seine Rechte. „Wir sollten uns langsam davonmachen“, Daniel sprach leise. „Du sagtest, dass Du ganz in der Nähe wohnst, Daniel?“ Thilda schnurrte wie ein Kätzchen. Die Kellnerin sollte abkassieren. Danach konnten sie in sein Mini-Appartement wechseln. Irgendeine Ausrede musste er finden, warum dort so ein Chaos herrschte. Es würde trotzdem eine schöne Nacht werden. Im CD-Spieler lag noch das Album von Loredana. Er brauchte nur einzuschalten. Sie würden sich umarmen. Anfassen. Ausziehen. „Boah Thilda. Das is ja ’n Ding.“ Wo kam der denn her? Anfang zwanzig, Strubbelpony, lila T-Shirt, Knielange Jeans, graue Sneakers. Ruckartig zog Daniel seine linke Hand zurück. Thilda sprang auf. „Äh, lustig. Darf ich vorstellen: Mein Kollege Daniel. Ich arbeite seit acht Tagen in der gleichen Firma wie er. Und das ist mein alter Freund Tyll, ha, Tyll wie Thilda. Ich hab Dich zwei Monate nicht gesehen, Tyll. Komm setz Dich zu uns. Daniel gibt einen aus.“ Küsschen links, Küsschen rechts. Tyll zog einen Stuhl heran. Sofort brachte die Bedienung ein weiteres Glas. Warum goss sie denn jetzt überall nach? Ruck zuck war die Flasche leer. „Wollen die Herrschaften noch einmal den Vino Rosso?“ Das wurde ein teurer Abend. Tyll war Künstler, genauer Aktionskünstler. Und erzählte und erzählte und erzählte. Daniel sollte langsam etwas unternehmen. Sonst lief alles aus dem Ruder. Er musste nachdenken. Auf dem Weg zur Toilette nickte er der Serviererin zu. „Wir wollen dann zahlen.“ Sie würden möglichst schnell das Feld räumen. Vor der Tür konnten sie sich dann von Tyll trennen. Nur so war die Beute vor dem Feind zu schützen. Im Flur spürte er das Vibrieren des Telefons in seiner Hosentasche. Er zog das Smartphone heraus. „Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr, du Idiot. Ich habe hier einen netten jungen Mann kennengelernt. Leb wohl. JR.“ Er dachte an seine Mutter, die immer sagte: Wer weiß, wozu es gut ist. Auf dem Rückweg blickte er zu dem Tisch in der Ecke. Dort standen drei schmutzige Gläser. Die Kellnerin sprach ihn an: „Hier, die Rechnung. Hundertzweiundfünfzig Euro, der Herr. Die jungen Leute sind bereits gegangen.“ Die niedergebrannte Kerze erlosch.
Tamara Krappmann
#lilylenz
Ein Gespräch quält sich voran, erträglich einzig durch die vollen Sektgläser. Nicht der Alkohol hilft weiter, sondern die Tatsache, dass sich die Anwesenden hinter den Gläsern verstecken können, indem sie immer wieder kleine Schlucke nehmen, kaum, dass ihre Lippen feucht werden. Aber wer trinkt, kann nicht reden, oder? Gregor schaut mit Bedauern um sich. Wie erwartet sitzt er nun neben seinen Eltern und hat ihnen nichts zu sagen. Mit seinem Vater wechselt er vorhersehbare Worte. Was man eben fragt, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat. Ihr Gespräch klingt, als seien sie flüchtige Bekannte, vielleicht ehemalige Arbeitskollegen: einander durchaus zugetan, aber nicht einmal eng befreundet. Seine Mutter trägt zur Unterhaltung wie üblich nur abwesendes Schweigen bei. Während sich Gregor mit seinem Vater über das Wetter austauscht, das erstaunliche, außergewöhnliche Wetter, betrachtet er zugleich seine am Tisch versammelte Familie. Sie ist klein: besonders dann, wenn er sie mit der des Bräutigams vergleicht. Bens Familie benötigt drei volle Tische und sie sitzen dicht gedrängt. Alle Altersstufen gehen durcheinander, Greise und Babys und Kinder, dazu unheimlich viele Erwachsene, die einander alle sehr ähnlich sehen und sehr laut und lustig miteinander reden. Oft wird gelacht, die Kinder kreischen, alles wirkt überaus lebendig. Hingegen passt selbst Katharinas weitere Familie leicht an einen Tisch. An anderen sitzen Freundinnen und Freunde, und sie hat sicherlich genauso viele Menschen eingeladen wie ihr Mann. Aber die Menschen, die ihr verwandt sind, lassen sich ohne Mühe in eine Ecke pferchen. Da ist natürlich Katharinas Mutter Lena, die Königin der Tafel, wie es ihre Art ist, überaus präsent, mit selbstbewusst zurückgenommenen Schultern. Neben ihr sitzen ausgerechnet Oskar und Charlotte, Oskars zweite Frau. Die drei unterhalten sich prächtig. Der Anblick ist bemerkenswert, denn Lena und Oskar haben sich einen hübschen Rosenkrieg geliefert. Nun ist das lange vergessen, und sie begegnen sich in einer Art von Kumpelei. Wobei Lena mehr Neigung zu Charlotte zu empfinden scheint als zu ihrem früheren Mann. Die Frauen stecken also hinter ihren Sektflöten die Köpfe zusammen und kichern, mit hochroten Wangen. Oskar lacht meistens mit ihnen, manchmal ein wenig verzweifelt. Neben Charlotte sitzen Holger und Lars, ihre Söhne, Katharinas Halbgeschwister. Sie betrachten die Festgesellschaft mit Unsicherheit und Langeweile, was ihrem Alter geschuldet sein dürfte, denn beide sind noch Teenager. Lars versucht immer wieder, sein Smartphone aus der Tasche zu ziehen und wird jedes Mal von Charlotte scharf zurechtgewiesen. Dann schielt er vorwurfsvoll zu Gregors Mutter. Aber wie alle anderen wagt auch er es nicht, ein Wort an sie zu richten. Gregor und seine Eltern vervollständigen diese Runde. Großeltern gibt es lange nicht mehr, auch keine weiteren Geschwister. Nur Magdalena und Johanna. Zwischen den Geburten der Schwestern liegt ein Abstand von neun Jahren. Das lässt sich auf den ersten Blick erkennen. Aber niemand, der sie zusammen sieht, würde jemals vermuten, dass Lena die Ältere ist. Lena mit ihren buntgefärbten Haaren und den kurzen Röcken könnte beinahe jedes Alter haben. Johanna Lenz nicht. Ihr gelbstichig ergrautes Haar hat sie lieblos zurückgebunden. Ihr Gesicht ist von tiefen Furchen durchzogen, ihre Hände sind mager und knotig. Gregor erinnert sich nur noch mit Mühe an die muntere Mutter seiner Kindheit und vergleicht sie mit dieser Frau, ohne auch nur entfernte Ähnlichkeit zu finden. Da sitzt ein vollkommen anderer Mensch. Johanna hält ihr Smartphone vor sich, in ihrem mageren Schoß, und blickt alle paar Sekunden aufs Display, als erwarte sie eine dringende Nachricht. Das entspricht den Tatsachen: Sie erwartet eine wichtige Nachricht. Seit eineinhalb Jahrzehnten wartet sie darauf. Um sich das Seufzen zu verkneifen, nimmt Gregor rasch einen Schluck Sekt, verschluckt sich und muss husten. Doch seine Augen ruhen auf Johannas Händen. Lilys Verschwinden hat seine Mutter medienaffin werden lassen. Er erinnert sich der ersten Wochen jenes besonders heißen Sommers, in dem sie Flugblätter kopiert und Anzeigen geschaltet haben. Damals hat er noch mitgeholfen, überzeugt davon, seine Schwester käme bald zurück. Das ist nun lange vorbei. Doch während er das Suchen aufgegeben hat, hat Johanna ihre Mittel verfeinert, und wenn er sich nun bei Twitter einloggte und suchen würde mit dem Hashtag #lilylenz, dann fände er dort die Chronologie des gegenwärtigen Tages. Denn ohne Zweifel schreibt Johanna auch jetzt pausenlos an Lily. Ihre Daumen huschen über das Display, während er ihr zusieht. Heute heiratet das Mäuschen, wird da stehen. Erinnerst du dich, wie ihr zwei als Kinder Braut und Bräutigam gespielt habt? Gregor selbst erinnert sich gut daran, sieht seine Schwester mit einem Mosquitonetz auf ihrem runden Kopf, ihr prächtiger Schleier mit langer Schleppe, und einem welken Gänseblümchenstrauß zwischen den Fingern. Wie alt war sie da, sechs oder sieben? Und er hört noch ihre Worte dazu, mit quietschender Kinderstimme gerufen: „Das sieht so unheimlich blöd aus! Greg, du spielst jetzt das Mädchen.“ Woraufhin er ihr einen Vogel zeigte. Deutlich erinnert er sich an ihr ruppiges Lachen. Sicher gibt es von dem Spiel ein Foto, und wenn er sich nicht völlig täuscht, dann hat es seine Mutter noch daheim gescannt und dann bei Instagram gepostet. Würde er ihr Facebookprofil öffnen, dann würde die kleine Mosquitobraut Lily ihm keck von der Seite entgegengrinsen. Johannas Hintergrundbild bei Facebook ist auch ein Foto von Lily, klatschnass und mit einem kleinen Pokal, einer Trophäe vom Schwimmen. Zweihundert Meter Lagenschwimmen war das. Lily lächelt, stolz und zahnlückig. Mittlerweile ist wahrscheinlich ihre gesamte Kindheit öffentlich. Und wer auf Twitter unter #lilylenz nachliest, findet auch den exakten Ablauf des Lebens und der Suche ihrer Mutter. Suchen und leben ist für Johanna längst dasselbe geworden, und ihr Sohn weiß, dass sie ihm übelnimmt, dass er beschlossen hat, es selbst anders zu halten. Johanna starrt auf ihr Smartphone, sooft es ihr nur möglich ist, und erwartet in jedem Moment die eine, entscheidende Nachricht: im Idealfall direkt von Lily. Lily hat dann durch Zufall all jene Botschaften entdeckt, die ihre Mutter voller Hoffnung sendet, und gibt ihr darauf Antwort. Oder sie hat sie längst beobachtet und fasst sich nun endlich ein Herz. Möglicherweise kommt die Nachricht aber auch von einem Fremden. Von irgendeinem Menschen, der Lily kennt oder gesehen hat, einer hilfreichen Person, die Johanna endlich den Hinweis gibt, den sie braucht, um ihre Tochter zu finden. Manchmal meldet sich wirklich jemand. Aber noch nie war etwas Hilfreiches darunter, nie eine wirkliche Spur. Mitunter äußert jemand Mitleid oder schreibt etwas Freundliches. Noch häufiger kommen Beschimpfungen vor, eigentlich ohne Anlass. Johanna nimmt sie als Bestätigung. Es wäre einfacher, findet ihr Sohn, wenn sie wenigstens über Lily reden könnten. Aber es gibt kein Gespräch über seine Schwester und keines jenseits davon. Denn Johanna redet nicht gerne mit Ungläubigen. Der rechte Glaube ist für sie der an das Weiterleben ihrer Tochter. Gespräche über Lily im Präteritum sind ein Tabu für sie. Sie brennt in einem Eifer, in dem sie niemand mehr erreichen kann. Eigentlich, wenn Gregor ehrlich ist, lautet das Wort auch nicht mehr Eifer, sondern Fanatis- mus. Wenn er nun in die Runde blickt, dann sieht er manchmal kurze Schatten auf den Gesichtern der Verwandten. Lena schaut befremdet herüber, mit Tadel für ihre jüngere Schwester. Lena ist zweifellos der Überzeugung, dass es an diesem Tag um ihre Tochter gehen sollte, um Katharina statt um Lily, wenigstens dieses eine Mal. Aber Lena weiß auch, dass sie chancenlos ist und nichts und niemand zu Johanna durchdringt. Sie erinnert sich an hässliche Szenen, nimmt daher alles schweigend hin. Charlotte und Oskar, die Bescheid wissen, sich aber weniger betroffen fühlen, schauen über Johanna hinweg, als ob sie gar nicht dort säße. Holger und Lars mustern sie verlegen, mit einer Spur Neid wegen des Smartphones. Wahrscheinlich hat ihnen niemand verraten, warum für diese alte, nachlässige Frau die Regeln des Benehmens außer Kraft gesetzt sind. Gregors Vater wirkt manchmal beschämt, zeigt aber vor allem Gleichmut. Gregor weiß von ihm längst nicht mehr zu sagen, wie er zu dem Verhalten seiner Frau steht. Teilt er noch ihre wilde Hoffnung, oder verhält er sich schlicht loyal? Treibt ihn die Angst, auch sie zu verlieren? Es ist unmöglich zu sagen. Auch Dieter Lenz ist vor der Zeit gealtert, wirkt schmal und unbeholfen und redet übers Wetter. Da sitzt ein Mann, der das Vertrauen in sein eigenes Urteil lange verloren hat. „Hast du für Schnee gepackt? Wir nicht. Ich dachte: Regen. Aber Schnee?“ Nein, für Schnee hatte Gregor nicht gepackt. Gregors Vater plappert nur noch. Da sie nichts zu bereden haben, müssen sie zwangsläufig plappern. Manchmal fragt Gregor sich, wie es zuhause ist, ob und wie seine Eltern miteinander sprechen. Er hofft, dass sie noch miteinander sprechen. Einmal am Tag, meistens am Abend, twittert seine Mutter die immer gleichen Worte: Bitte komm heim. Ich liebe dich. #lilylenz. Ihr Sohn hofft inständig, dass sie ähnliche Worte manchmal auch laut sagt, zu seinem Vater. Zu ihrem Mann. Aber er glaubt nicht mehr, dass das wirklich der Fall sein könnte. Er nimmt einen langen Schluck Sekt, wodurch sein Glas leider leer wird, betrachtet neidisch Oskar und Charlotte, die durch den jeweils anderen wenigstens jemanden zum Reden bei sich haben, und dann noch neidischer die anderen Tische, wo sich die Sippschaft des Bräutigams knäult, lebhaft und lustig und laut. Er ist selbst kein lauter Typ. Nun jedoch wünscht er sich dorthin, unter diese fröhlichen Leute. Jedenfalls kommt ihm alles besser vor, als noch den ganzen Nachmittag und Abend auf seinem Platz zu bleiben. Dann, endlich, drehen sich Köpfe um, Stuhlbeine schaben über den Boden und die ersten Gäste erheben sich und applaudieren freundlich. Das Brautpaar ist hereingekommen, rotwangig von der Kälte und erschöpft vom vielen Lachen für den Hochzeitsfotografen, aber zugleich sichtlich vergnügt. Gregor erhebt sich ebenfalls und applaudiert mit den anderen Gästen. Seine Begeisterung gilt dem Umstand, dass nun ein neuer Programmteil beginnt, dass es nun gleich ein paar Reden gibt und anschließend Kaffee und Kuchen, wodurch alles etwas einfacher wird. Denn wer den Mund voll Kuchen hat, der muss auch keine Tischgespräche führen.
Frank Schuster
Das Artefakt
Kaum hatte Herbert George das erste Mal in seinem Leben amerikanischen Boden betreten, bekam er auch schon Ärger mit der Polizei. „Mister Wells?“ Er schaute von seinen Papieren auf, die er dem Beamten an der Passkontrolle vorgelegt hatte, und bemerkte, dass ihn still und heimlich zwei Polizisten in die Zange genommen hatten. Er blickte den rechten von den beiden an, von dem er die Stimme vernommen zu haben glaubte. Herbert George spürte Hitze in seine Wangen schießen. Er nickte nervös. Er fühlte sich ertappt, wusste aber nicht, wobei. Mit seinen Papieren war alles in Ordnung, da war er sich sicher. „Mitkommen!“, befahl der andere, der linke Polizist. Während er zwischen den beiden Beamten durch die Menschenmenge im New Yorker Hafen mitschritt, sang er sich zur Beruhigung innerlich The Star-Spangled Banner vor. Das Lied war ihm schon ein unerträglicher Ohrwurm während der Überfahrt gewesen. „… the land of the free.” Von wegen! Es fehlte noch, dass sie ihm Handschellen anlegten und ihn in eine Zelle warfen. Was wollten sie von ihm? War es sein Engagement für die Fabian Society? Mit sozialistischen Ideen war in den Vereinigten Staaten nicht zu spaßen. Seit dem Attentat auf Präsident William McKinley Jr. waren die Amerikaner in Panik versetzt und fürchteten allenthalben Anschläge von Anarchisten und anderen Gruppierungen. Hinter Herbert George lag eine siebentägige Überfahrt mit der RMS Carmania von Liverpool. Die ganze Zeit auf dem Meer hatte er sich unwohl gefühlt. Ozeanriesen waren zwar eine segensreiche Erfindung, sie brachten die Welt zusammen, doch zwischen der alten und der neuen lag tiefes, kaltes Wasser. Die beiden Beamten und er erreichten ein schmuckloses Gebäude. Sie führten ihn in einen kargen Raum. „Setzen!“, sagte einer von beiden und wies still auf einen leeren Stuhl. Mehr als drei Silben bekamen die beiden Uniformierten wirklich nicht heraus. Herbert George nahm vor einem Schreibtisch Platz, ihm gegenüber zwei leere Stühle. Während er noch dabei war, sich auszumalen, wer gleich darauf Platz nehmen könnte, öffnete sich bereits eine Tür und zwei Männer in Zivil traten ein. „Ah, Mister Wells!“, rief der offensichtlich jüngere aus, der einen Aktenkoffer in der Hand trug. „Wir sind hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich kann wohl für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir Ihre Bücher sehr schätzen.“ Er wies auf seinen Begleiter, der zustimmend nickte. Er kam Herbert George bekannt vor. Er trug einen gestutzten Vollbart. Sein lockiges, widerspenstiges, schlohweißes Haar hatte er durch strenges Nach-hinten-Kämmen gezähmt. Der hohe Haaransatz sorgte dafür, dass seine markante Stirn zur Geltung kam. Über seinen dunklen Augen hingen weiße, buschige Brauen. Er hatte den Mann schon einmal gesehen, aber wo? „Gestatten Sie, mein Name ist Anthony Pinker“, riss ihn der jüngere Mann aus seinen Überlegungen. „Ich bin General beim NBCI.“ Als er Herbert Georges fragendes Gesicht sah, ergänzte er: „National Bureau of Criminal Identification.“ Er grinste kurz und fuhr fort: „Und von dem Herrn neben mir haben Sie sicherlich schon gehört.“ „Alexander Graham Bell“, stellte dieser sich mit einem freundlichen Lächeln vor und reichte seinem Gegenüber die Hand. Herbert George war verblüfft. Worauf lief das Ganze hinaus? Warum saß er einem Geheimdienstler und dem Mitbegründer der American Telephone & Telegraph Company gegenüber? Im allgemeinen Bewusstsein war Bell bekannt als der erste Mensch, der ein Patent auf das Telefon angemeldet hatte. Das Foto mit ihm, wie er vor gut anderthalb Jahrzenten den ersten Anruf von New York nach Chicago getätigt hatte, war um die ganze Welt gegangen. Viele Menschen verkürzten das fälschlich darauf, dass er der „Erfinder des Telefons“ sei. So war es sogar schon in einigen Geschichtsbüchern zu lesen. Dabei war Bell bloß ein gewiefter Geschäftsmann. Es war ihm gelungen, aufbauend auf Ideen, die er von anderen Erfindern gestohlen hatte, das Telefon zur Marktreife zu entwickeln. Zugleich baute er ein flächendeckendes Telefonnetz in Nordamerika aus, das seine Firma monopolartig beherrschte. Herbert George erwischte sich dabei, wie er in Gedanken Stoff für seinen Reise-Essay sammelte. Einen Arbeitstitel hatte er schon: The Future in America. „Tee?“, fragte Pinker. Herbert George nickte. Pinker befüllte drei Tassen mit dem heiß dampfenden Getränk. Das Gedeck hatte bislang von Herbert George unbemerkt auf dem Schreibtisch gestanden. „Fast so gut wie bei Ihnen zuhause in good ole England“, sagte Pinker beim Eingießen und schmunzelte. Er gab den beiden Polizisten, von denen bislang jeder in jeweils einer anderen Zimmerecke strammgestanden hatte, ein Zeichen. Sie verließen den Raum. „Mister Wells“, richtete sich Pinker an Herbert George. „Sie sind sicher sehr überrascht darüber, was Ihnen seit Ihrer Ankunft in New York widerfahren ist, und ich muss mich dafür im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika zutiefst bei Ihnen entschuldigen. Wir hätten Sie gerne schon in England erreicht. Von dort erhielten wir jedoch die Nachricht, dass Sie mit der RMS Carmania Richtung New York abgereist seien. Eine wahrhaft glückliche Fügung für uns: Sie kamen uns gewissermaßen entgegen.“ Pinker lachte kurz, nahm einen Schluck von seinem Tee und fuhr fort: „Zu allererst habe ich eine Bitte an Sie: Wenn Sie uns versichern, über ein Vorkommnis äußerstes Stillschweigen zu üben, werden Sie in den nächsten Minuten verstehen, warum wir gerade Sie ausgewählt haben. Wenn Sie es nicht tun, entschuldigen wir uns hiermit für die Unannehmlichkeiten und Sie können Ihre Reise ungestört fortsetzen.“ Herbert George war verwirrt. Pinkers Bitte klang dezent nach Erpressung. Als Schriftsteller war er naturgemäß neugierig. Wie sollte er jetzt noch aussteigen, wenn ihm das verlockende Angebot auf eine Story gemacht wurde? Zugleich aber brauchte er als Geschichtenerzähler ein Publikum. Wie konnte man von ihm verlangen, ein Ereignis, von dem er ahnte, dass es außergewöhnlich sein musste, geheim zu halten? Herbert George überlegte kurz, dann hörte er sich sagen: „Ich versichere Ihnen, still zu schweigen.“ „Bis an Ihr Lebensende?“, hakte Pinker nach. Herbert George spürte, wie es in seinem Inneren kribbelte. Zugleich fühlte er seinen Hunger nach Sensation aufsteigen. Er wollte und konnte jetzt nicht mehr umkehren. Er nickte. Heimlich dachte er dabei: Wir werden schon sehen, wie lange ich die Sache überhaupt für wert befinde, geheim zu halten. Vor allem, wenn ich dieses Land wieder verlassen habe. „Gut. Das freut uns“, sagte Pinker. „Dann möchte ich Sie bitten, diese Geheimhaltungserklärung zu unterschreiben.“ Er schob ihm einen Bogen Papier zu. Während Herbert George kurz über die Zeilen flog, schielte er herüber zu Bell, der einen erleichterten Gesichtsausdruck machte. „Ich hatte gehofft, dass Sie mitmachen“, sagte Bell, während Herbert George unterschrieb. Er sprach noch immer mit einem deutlichen schottischen Akzent, obwohl er bereits vor mehr als drei Jahrzehnten Großbritannien verlassen haben musste, wie Wells im Kopf nachrechnete. Angeblich soll Bell seine Patentschrift für das Telefon nur zwei Stunden vor dem Lehrer und Erfinder Elisha Gray eingereicht haben. Der Unterschied zwischen beiden Papieren war, dass Gray darin seine Erfindung bis in das kleinste Detail beschrieb. Bells Patent hingegen blieb sehr vage. Er verwendete später bei der praktischen Umsetzung einen regelbaren Widerstand in Form eines Drahts, der in eine Schwefellösung getaucht war. Ein solcher war in seiner – im Gegensatz zu Grays – Patentschrift gar nicht aufgeführt. Die Folge war ein langwieriger Patentstreit. Es gab Stimmen, die bezichtigten Bell sogar einer illegalen Verbindung zum Patentamt. Unter dem Schreibtisch zog Pinker den Aktenkoffer hervor. Er hob ihn hoch und legte ihn auf die Tischplatte. Von seinem linken Handgelenk baumelte eine Kette, über die er mit dem Koffer verbunden blieb. Bell zog sich unterdessen ein Paar weißer Stoffhandschuhe über, wie sie Auktionatoren zu tragen pflegen, wenn sie wertvolle Kunstgegenstände berühren. Er ließ sich von Pinker mit einem feierlichen Kopfnicken einen Schlüssel überreichen und schloss damit den Koffer auf. Der aufschnappende Kofferdeckel versperrte Herbert George die Sicht. Bells Hand verschwand dahinter und kam mit einem schwarzen Gegenstand wieder zum Vorschein, den er vorsichtig auf die Tischplatte legte. Pinker legte den Koffer derweil wieder zurück auf seinen Schoß. Der etwa handtellergroße Gegenstand war flach wie ein Brett. Er hatte die Form eines langgezogenen Rechtecks mit abgerundeten Ecken. Er besaß eine glänzende Oberfläche aus Glas, die von einem schwarzen Rahmen eingefasst war, er glich einem Taschenspiegel. In dem Glas spiegelten sich das Licht und die Umrisse des Raums. Falls der Gegenstand tatsächlich als Taschenspiegel dienen sollte, war das Bild, das er zurückwarf, viel zu undeutlich. Silber eignete sich definitiv besser als Beschichtung für einen Spiegel. „Sie können das Ding ruhig berühren“, sagte Pinker an Herbert George gerichtet, nicht ohne auch ihm zuvor ein Paar weiß Handschuhe in die Finger zu drücken. Herbert George zog sich den weichen Stoff über. Er griff nach dem Gegenstand und hob ihn näher in Richtung seiner Augen. Er drehte und wendete ihn und entdeckte dabei mehr und mehr Details, die er in dem Schwarz-auf-Schwarz vorher gar nicht wahrgenommen hatte. An mehreren Stellen, vor allem an den Seitenrändern, befanden sich unterschiedliche Ausstülpungen und Löcher. Das auffälligste Detail aber fand sich auf der Rückseite: eine Vertiefung in Form eines langgezogenen Ovals, in dessen einer Seite ein kreisrundes Stück Glas eingesetzt war, das einer Linse glich. „Wir stehen vor einem ebensolchen Rätsel wie Sie.“ Bells Worte zerrissen das seit Minuten anhaltende Schweigen. Er schmunzelte, offensichtlich erheitert von Herbert Georges nachdenklichem Gesichtsausdruck. „Drücken Sie einmal das Knöpfchen dort und schauen Sie dabei auf die Scheibe.“ Bell zeigte auf eine der Ausstülpungen. Herbert George tat, um was er ihn bat. Er bekam einen Schrecken: Wie aus dem Nichts erschien auf der schwarzen Fläche hinter der Scheibe etwas in weißer Farbe. Ein Symbol. Er hatte Probleme zu erkennen, was es darstellte. Er dachte zunächst an eine brennende Kerze. Dann aber erkannte er, dass es sich um einen Apfel handelte, der an der rechten Seite angebissen war. Das Erste, was Herbert George dazu einfiel, war die biblische Geschichte vom Baum der Erkenntnis, von dessen Frucht der Mensch niemals hätte naschen sollen. Er spürte erneut eine Hitzewallung in seinem Körper aufsteigen. Auf was hatte er sich da bloß eingelassen! „Zugegebenermaßen etwas gespenstisch“, sagte Bell, der bemerkte, wie Herbert Georges Hand anfing zu zittern. Er dachte sicher, es wäre wegen des technischen Illuminationseffekt. Dabei war es das gar nicht. Herbert George kannte solchen Budenzauber aus dem Kino. Es war vielmehr die Erkenntnis, die plötzlich und instinktiv durch seinen Körper schoss, dass er eine technische Entwicklung in den Händen hielt, die nicht aus dieser Zeit oder Welt stammte. Der Film, den das Gerät hinter der Scheibe abspielte, wechselte über in eine nächste Szene. Auf dem Bildschirm war nun ein großes Quadrat zu sehen, das von neun kleinen Kreisen gebildet wurde, die mit den Zahlen von eins bis neun beschriftet waren. Ein weiterer Kreis befand sich außerhalb und trug die Zahl Null. Am oberen Rand des Bildschirms stand wie auf einer Zwischentiteltafel in einem Stummfilm: „Code eingeben. Nach dem Neustart benötigt iPhone deinen Code.“ Als Bell, der sich die ganze Zeit damit zurückgehalten zu haben schien, Herbert Georges zunehmend ratloseren Gesichtsausdruck sah, begann er schallend zu lachen. Es klang in Herbert Georges Ohren wie Gebell. Auf Englisch mochte der Name Bell passend sein für jemanden, der der Menschheit das Telefon mitsamt seinem nervtötenden Geklingel beschert hatte. Auf Deutsch jedoch klang „Bell“ wie ein Befehl für das, was Hunde gerne tun. „iPhone.“ Dieses Wort stach Herbert George ins Auge. Und plötzlich wurde ihm klar, warum er Alexander Graham Bell gegenübersaß. Das Gerät hatte nichts mit Kinematographie zu tun. Es musste sich um eine Art Telefon handeln. Bell, diesem perfiden Kapitalisten, war es zuzutrauen, eine neue Erfindung „iPhone“ zu taufen. Das in seiner Muttersprache großgeschriebene erste Personalpronomen schrumpfte zu einem Strich mit Tüpfelchen, das menschliche Ich trat hinter der Ware zurück. „Mister Wells, wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen“, schaltete sich Pinker ein. „Das Gerät wurde bei Bauarbeiten in der Grand Central Station in Chicago entdeckt. Die alten Schließfächer mussten weg und neue kamen hin. Monatelang wurden Nutzer mit Schildern darauf aufmerksam gemacht, bis zum 1. März dieses Jahres ihre sämtlichen Gegenstände aus den Stahlschränken zu holen. Nach und nach wurden die nicht mehr belegten durch neue ersetzt. Am Ende blieben zwei Schließfächer übrig, die unter der Aufsicht der Polizei gewaltsam geöffnet werden mussten. In einem der Fächer fanden die Beamten nichts, es war interessanterweise völlig leer. In dem anderen fanden sie diesen Apparat hier. Sofort wurden höhere Polizeieinheiten hinzugezogen. Die Vermutung lag nahe, dass das Gerät zu Vorbereitungen auf ein Bombenattentat dienen, es zum Beispiel eine Art Zeitzünder sein könnte. Wie Sie vielleicht wissen, hatten wir in den Vereinigten Staaten zuletzt einige Probleme mit anarchistischen Elementen. Techniker demontierten und prüften es. Es gelang ihnen, auf das Gerät Strom zu geben. Schauen Sie hier, dieses längliche Loch ist eine Buchse.“ Pinker zeigte kurz auf den unteren Teil des Geräts und fuhr fort: „Nachdem die Experten es auseinandergenommen, untersucht und schließlich in Gang gebracht hatten, wurde zunehmend klar, dass es sich um ein Funk- oder Fernsprechgerät handeln muss. Nachdem definitiv ausgeschlossen war, dass das Ding irgendetwas mit Sprengstoff zu tun haben könnte, blieb die ganze Sache dennoch Angelegenheit des NBCI. Denn der Apparat könnte irgendeiner uns feindlich gesinnten Seite als Abhörgerät oder Störsender dienen. Die Frage ist nur: wem? Wer hat diesen Apparat im Schließfach des Chicagoer Bahnhofs deponiert? Und wozu wurde, wird oder soll er eingesetzt werden? Fragen über Fragen. Aber ich übergebe erst einmal das Wort wieder an Mister Bell. Er wird Ihnen weitere Details an der Apparatur erläutern. Sie müssen wissen, Mister Wells: Wir haben Mister Bell als Berater hinzugezogen und, wie Sie, zum Stillschweigen über diese Angelegenheit verpflichtet. Mister Bell, darf ich Sie bitten fortzufah- ren.“ Bell räusperte sich kurz. „Wie Sie sehen, ist nun ein Code einzugeben. Die Kryptographen des NBCI berichteten mir, dass sie nicht lange gebraucht hatten, die richtige Kombination herauszufinden. Gleich der erste Versuch klappte. Mister Wells, darf ich bitten, mir den Apparat kurz zurückzugeben. Das Gerät ist nämlich gesperrt, wenn man nach fünf Versuchen immer noch die falsche Zahlenfolge eingibt.“ Herbert George schob das Telefon hinüber zu Bell, der sich unterdessen den Handschuh von seiner rechten Hand zog. Er fragte sich, wie er es bewerkstelligen wollte, den Code einzugeben. Die Kreise mit den Zahlen lagen hinter Glas und waren bloß eine Simulation von Tasten. Doch sobald Bell drauftippte, reagierten sie mit einer Veränderung ihrer Farbe. Mit einer theatralischen Bewegung gab Bell eine Zahl nach der anderen ein: 1, 2, 3 und 4. Es war genau der Code, den Wells erwartet hatte. Bei Recherchen für eine Erzählung hatte er sich einmal mit Kombinationen für Zahlenschlösser beschäftigt. 1234 war die mit Abstand beliebteste, gefolgt von 1111. Deshalb war es äußerst ratsam, sie nicht für einen Safe zu wählen. „Wissen Sie, Mister Wells“, sagte Bell, während er den Apparat zurückgab. „Die Kryptographen hatten es doppelt einfach: 1234 ist nicht nur der geläufigste Verschlüsselungscode, das Schließfach in der Grand Central Station trug die Nummer 123. Es sieht ganz so aus, als ob sich da jemand nicht allzu viel Mühe gegeben hat.“ Herbert George blickte auf das Gerät. Hinter der Scheibe waren nun über den ganzen Bildschirm unterschiedliche Symbole verstreut. Manche waren trotz ihrer abstrakten Darstellung in ihrer Bedeutung relativ einfach zu erahnen: ein Zahnrad, eine Weltkugel, eine Uhr, ein Kalender, eine Kamera, ein Telefonhörer. Andere wiederum ergaben für Herbert George keinen Sinn: ein weißes kleines f in einem blauen Kreis, ein rotes großes N in einem schwarzen, ein weißes umgekipptes Dreieck in einem roten und drei schwarze Wellen in einem grünen Kreis. „Was passiert, wenn ich da draufdrücke?“, fragte Herbert George an Bell gerichtet und zog sich dabei den Handschuh von seiner rechten Hand. „Kommt drauf an, auf welches der Symbole. Probieren Sie eines.“ Herbert George drückte auf die Uhr, sie schien ihm am unverfänglichsten. „Weltuhr, Chicago“, war zu lesen. Daneben die Zahlen „11:30“. Wenn es halb zwölf bedeuten sollte, ging die Uhr falsch. „Man kann die Symbole übrigens auch verschieben“, sagte Bell. Er bat Herbert Georg, ihm das Gerät noch einmal zurückzugeben, und führte es ihm vor. Er zog mit der Spitze seines unbehandschuhten rechten Zeigefingers eines der Zeichen von oben nach unten. Die Technik war verblüffend. Sie erinnerte Herbert George an seine Experimente in seiner Kindheit mit Eisenspänen auf einer Scheibe, die er mithilfe eines Magneten unter dem Glas in Bewegung setzte. Bell gab ihm das Gerät zurück. „Probieren Sie ruhig noch andere aus.“ Doch bei jedem weiteren Symbol, das Herbert George anwählte, passierte wenig bis gar nichts. Es ging nicht weiter. Es stockte. Bei manchen erschien ein Zwischentitel mit den Worten: „Du benötigst eine Internetverbindung.“ „Ein Funkgerät, das keine Frequenzen findet, funktioniert nicht“, schaltete sich Pinker ein. „Unsere Leute gehen davon aus, dass es sich bei , Internet‘ um eine Art Kommunikationssystem handelt. All unsere Anstrengungen führten bislang nicht dazu, dass wir uns darin einwählen konnten.“ „Einige Anwendungen funktionieren jedoch auch ohne. Sehen Sie hier“, sagte Bell und drückte auf ein Symbol mit den vier mathematischen Zeichen für Plus, Minus, Mal und Ge- teilt. „Sagen Sie mal irgendeine Zahl“, bat er. „Eintausendzweihundertvierunddreißig“, erwiderte Herbert George. Der Code für das Gerät. „Und jetzt noch eine.“ „Hundertdreiundzwanzig.“ Die Nummer des Schließfachs. „So und jetzt sagen Sie mir: Was ergibt eintausendzweihundertvierunddreißig plus hundertdreiundzwanzig?“ Bell strahlte. Er schien kindliche Freude an diesem Spiel zu haben. Während Herbert George noch im Kopf rechnete, tippte Bell die Zahlen ein. Und schon erschien „1357“ auf der Schei- be. „Wahnsinn, welche Geschwindigkeit!“, sagte Pinker mit Begeisterung. „Unsere Leute haben noch nicht herausfinden können, wie das Gerät dies schafft. Anders sieht es mit einer weiteren Funktion aus.“ Er gab Bell ein Zeichen, der sich bereits diebisch auf das zu freuen schien, was er jetzt vorführen konnte. Er tippte auf das Kamerasymbol. Dann hob er das Gerät, schaute kurz auf die Seite mit dem Glas, die er von Herbert George abgewandt hielt, und drückte auf sie drauf. Ein Licht blitzte hell auf. Herbert George war kurzzeitig geblendet. Anschließend drehte Bell das Gerät so, dass alle Personen am Tisch bequem auf die Scheibe blicken konnten. Herbert George fuhr vor Schreck zusammen. Hinter dem Glas war eine farbige Fotografie von ihm zu sehen. Wie hatte sich diese so schnell entwickeln können? In diesem winzigen Gerät steckten gleich mehrere Apparate. Wie war es möglich, dass sie alle in dieses kleine Gehäuse passten? Sein Gehirn durchzuckte erneut der Gedanke, es mit einer technischen Entwicklung zu tun zu haben, die nicht aus dieser Zeit oder Welt stammte. Pinker gab erneut ein Zeichen. Bell legte das Gerät auf den Schreibtisch. „Mister Wells“, sagte Pinker. „Sie fragen sich sicher schon die ganze Zeit, warum wir Sie hinzugezogen haben. Was Sie als Schriftsteller zu der ganzen Sache beizutragen haben, da doch all unsere Männer, die seit Wochen auf Hochtouren ermitteln, noch keine heiße Spur haben. Unsere Experten sind allesamt kluge Menschen, das steht außer Frage. Es fehlt ihnen aber an einer besonderen Gabe. Mister Wells, kurz und gut: Der Krisenstab kam nach einer längeren Sitzung überein, dass wir dringend jemanden mit visionärer Imaginationskraft benötigen. Und dabei sind wir auf Ihren Namen gekommen.“ „Ich mag am liebsten Ihren Roman, in dem Sie sich eine Invasion von Außerirdischen vom Mars ausmalen“, plapperte Bell dazwischen. „Mister Pinker hingegen schätzt Ihr Buch mit der Zeitmaschine.“ Jetzt endlich verstand Herbert George. Und zugleich ärgerte er sich. Er hatte mit seinen 39 Jahren bereits ein umfangreiches Werk geschrieben, darunter Sachbücher, Essays und politische Schriften. Doch immer wieder wurde er auf seine utopischen Fiktionen reduziert. Pinker lächelte Herbert George an und übernahm wieder das Gespräch. „Mister Wells, wir alle in dieser Runde sind uns sicherlich einig, dass wir es hier mit einer Technologie zu tun haben, zu der die uns bekannte zivilisierte Welt derzeit nicht fähig ist. Der Apparat muss von irgendwo weit her kommen. Und mit weit her meine ich räumlich oder auch zeitlich. Was denken Sie darüber, Mister Wells?“ Herbert George schossen viele Überlegungen durch den Kopf. Es fiel ihm schwer, sie ad hoc laut zu artikulieren. Leise und stockend hörte er sich reden: „Das Gerät, seine Gestaltung und Ausrüstung, wirken auf mich zutiefst menschlich. Wenn es von Außerirdischen stammen sollte, sind sie entweder uns Menschen sehr ähnlich oder sie haben es für uns er- schaffen.“ „Sehen Sie, Mister Pinker! Ich sagte es doch, die Zeitma…“ „Ich bitte Sie, Mister Bell. Lassen Sie doch Mister Wells in seinen Ausführungen fortfahren.“ „Wenn der Apparat allerdings tatsächlich von extraterrestrischen Wesen kommen sollte“, fuhr Herbert George fort, „dann hätte ich momentan keine Erklärung dafür, warum sie ihn in einem Schließfach in einem Bahnhof auf der Erde deponiert haben. Anders hingegen sähe es mit einem Zeitreisenden aus. Da hätte ich viele Ideen.“ Herbert George pausierte kurz und fragte schließlich: „Haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht, wie ein Zeitreisender mit den Menschen aus seiner Zeit kommunizieren kann?“ Pinker und Bell schüttelten die Köpfe. „Er kann ja nicht einfach aus der Vergangenheit oder der Zukunft mit einem Telefon anrufen.“ Herbert George lachte kurz auf. Pinker stieg in sein Lachen ein. Aus den Augenwinkeln registrierte Herbert George, wie sich Bells Mundwinkel nach unten verzogen. „Nein, er kann es“, fügte Herbert George mit fester Stimme hinzu, „indem er Artefakte hinterlässt.“ Pinker und Bell schauten ihn fragend an. „Alles von Menschen Gemachte kommt dazu in Frage“, gab Herbert George zur Erklärung. „Ein Brief zum Beispiel, den er wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit irgendwo an einem geheimen Ort deponiert. Das Problem ist nur, der Brief könnte von einer Person gefunden werden, an die er nicht adressiert ist. Im harmlosen Fall könnte der Finder ihn für das Zeugnis eines Verrückten halten.“ „Und im ernsten Fall?“, fragte Pinker. „Könnte das, was auf dem Brief steht, den Gang der Geschichte beeinflussen. Nicht auszudenken, was zum Beispiel passiert wäre, wenn Marie Curies Aufzeichnungen über Radioaktivität in die Hände von Kaiser Nero gelangt wären. Ein vorsichtiger Zeitreisender sollte seine Spuren gut verwischen. In diesem Fall“ – Herbert George deutete auf das Gerät – „trifft das nur teilweise zu. Der Apparat war zwar in einem Schließfach einigermaßen sicher versteckt. Zudem sind auf ihm keine bis kaum für uns lesbare oder auswertbare Informationen hinterlassen. Der Adressat könnte möglicherweise über Einwählen in das Netz, das uns heute noch nicht zur Verfügung steht, an für ihn bestimmte Informationen gelangen. Aber der Zeitreisende machte meines Erachtens einen schwerwiegenden Fehler: Er recherchierte nicht gründlich genug in den Archiven, ob die Schließfächer in der Grand Central Station in Chicago noch mehrere Jahrzehnte überdauern.“ Pinker nickte still. „Das alles klingt schlüssig“, sagte er. „Allerdings sehe ich einen weiteren Fehler: Hätte der Zeitreisende einfach einen Brief deponiert, hätte dies bei weitem nicht für ein solches Aufsehen gesorgt. Auf Papier schreiben Menschen seit Jahrhunderten. Das Gerät hingegen stellt uns nun vor große Herausforderungen. Wir haben eine Erfindung gefunden, die es noch gar nicht gibt. Wie sollen wir damit umgehen? Wir könnten sie jetzt kopieren und damit eine Apparatur in die Welt setzen, deren Zeit noch gar nicht gekommen ist.“ „Es könnte aber auch gut möglich sein, dass das Artefakt selbst die Botschaft ist.“ Pinker und Bell blickten Herbert George fragend an, der erklärte: „Liest zum Beispiel ein Mensch des Jahres 2006 in einer Zeitung des Jahres 1906, dass in der Grand Central Station in Chicago ein schwarzes Telefon unbekannter Herkunft mit integrierter Kamera und Rechenmaschine gefunden wurde, kann er daraus schließen, dass der Zeitreisende angekommen ist.“ Pinker nickte still. „Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit“, fuhr Herbert George fort. „Es könnte etwas schiefgegangen sein. Irgendwas kam dem Zeitreisenden dazwischen, so dass er das Gerät nicht mehr aus dem Schließfach holen konnte. Oder aber er hatte es dort gar nicht für die Nachwelt deponiert, sondern für einen Mitreisenden. Je länger ich darüber nachdenke, kommt mir diese Möglichkeit fast als die wahrscheinlichste vor.“ Pinker und Bell schwiegen lange. Schließlich fragte Pinker: „Was schlagen Sie vor, Mister Wells?“ Herbert George antwortete nicht. Stattdessen schielte er kurz herüber auf Bell. Dann beugte er sich über den Schreibtisch und flüsterte Pinker etwas ins Ohr. Pinker nickte. „Mister Bell, könnten Sie uns bitte für fünf Minuten alleine lassen?“ Bell war sichtlich pikiert. Er wollte etwas entgegnen, aber es hatte ihm die Stimme verschlagen. „Bitte!“, insistierte Pinker. Bell stand widerwillig auf und verließ den Raum. Nachdem die Tür hinter ihm verschlossen war, sprudelte Herbert George mit seiner Idee los: „Mein Vorschlag wäre: Deponieren Sie das Gerät einfach wieder in Schließfach 123 der Grand Central Station in Chicago. Falls die Nummerierung dort jetzt eine andere ist und es keine 123 mehr geben sollte, sorgen Sie dafür, dass sie wieder existiert. Und auch, dass der Schlüssel des früheren Stahlschranks in den neuen passt. Notfalls bauen sie einfach den alten wieder ein. Anschließend breiten alle Beteiligten den Mantel des Schweigens über die ganze Angelegenheit.“ Herbert George stoppte kurz. „Und bitte, Mister Pinker, stellen Sie keine Wachposten an Schließfach Nummer 123 auf. Es könnte sein, dass sie hundert Jahre warten müssen.“ Er lachte kurz auf und fügte mit ernster Stimme an: „Und denken Sie daran: Gerade das Ergreifen des Zeitreisenden könnte den Gang der Geschichte erheblich verän- dern.“ Mister Pinker schwieg. Er schwieg lange. Schließlich stand er von seinem Stuhl auf und schritt auf Herbert George zu. Auch er stand auf und die beiden Männer reichten sich die Hand. „Ich danke Ihnen, Mister Wells. Ich werde Ihren Vorschlag in die Beratungen des Krisenstabs einfließen lassen.“ Er nickte und hob die Stimme: „Mister Bell!“, rief er. „Sie können wieder hereinkommen.“ Bell betrat mit sichtlich beleidigtem Gesichtsausdruck den Raum. „Mister Wells ist im Begriff zu gehen“, sagte Pinker. „Sagen Sie ihm auf Wiedersehen.“ Sie gaben sich die Hand. Herbert George blickte dabei in Bells rot angelaufenes Gesicht. Er hörte, wie er beim Händeschütteln leise schnaubte.
Zwei Monate später erreichte Herbert George ein Einschreiben in seinem Haus in Sandgate. Er war frisch von seiner Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt und brütete über seinem Essay. Der Absender auf dem Umschlag war ihm unbekannt. Als er ihn aufriss, bemerkte er, dass der Name fingiert war. Der Brief kam vom NBCI. Unterzeichnet hatte ihn Anthony Pin- ker.
„Sehr geehrter Mister H. G. Wells,
bitte behandeln Sie die Informationen, die Sie mit diesem Schreiben erhalten, streng vertraulich. Sobald Sie diesen Brief gelesen haben, verbrennen Sie ihn. Ihr Vorschlag, den Sie meiner Person am 3. April 1906 im Hafen von New York unterbreitet hatten, traf im engeren Kreis des Krisenstabs auf große Zustimmung. Es wurden unmittelbar Schritte dazu eingeleitet, ihren Anweisungen zu folgen. Allerdings ist uns ein Fehler unterlaufen. Eine Sicherheitslücke trat auf. Das Gerät sollte gleich nach dem Gespräch zwischen mir, Ihnen und Mister Bell wieder zurück in den Tresor, in dem es sich bis zu Ihrer Ankunft in New York befunden hatte. An dieser geheimen Stelle wähnten wir es auch an jenem Tage, der für die Überführung an den von Ihnen vorgeschlagenen Ort ausgewählt war. Der NBCI fand den Tresor nach Öffnung jedoch leer vor. Ermittlungen ergaben, dass sich einer der beiden Polizisten, die Sie am Tage Ihrer Ankunft am New Yorker Hafen in Empfang genommen hatten, mit einer beträchtlichen Summe Geldes dazu hatte bestechen lassen, das Gerät zu entwenden und seinem Auftraggeber zuzuführen. Nach intensiver Fahndung wurde der Polizist in Kalifornien aufgegriffen. Als seinen Auftraggeber benannte er den schwedischen Erfinder und Telefonfirmengründer Lars Magnus Ericsson. Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Auftraggeber vielmehr dessen schärfster Konkurrent, Alexander Graham Bell, war. Was der bestochene Polizist allerdings an der Westküste wollte, konnte auch Bell nicht erklären. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Delinquent das Artefakt zum Zeitpunkt seiner Ergreifung nicht mehr bei sich trug. Er sagte, er habe es auf seiner Flucht im Santa Clara Valley, südlich von San Francisco, verloren. Alle Versuche, es zu finden, waren bisher erfolglos.
Hochachtungsvoll, Anthony Pinker (NBCI)
Herbert George zerknüllte das Briefpapier zu einer Kugel und warf es in das Kaminfeuer. Während es hell aufloderte und danach langsam zu Asche zerfiel, wünschte er sich viel, sehr viel Regen im Santa Clara Valley. Er hoffte, dass die abrutschenden Erdmassen das Artefakt tief unter sich begraben und frühestens in hundert Jahren wieder zurück ans Licht bringen würden.
Das neue Jahr
Ich starre von innen auf die Hotelzimmertür. Außen trägt sie die Nummer 101. Seit Jahren schon gebe ich sie zum Spaß beim Einchecken als Wunsch an der Rezeption an. Ein kleiner Scherz, den ich mir erlaube. Sonia fand ihn immer ziemlich makaber. In einem meiner Romane geschieht in einem Raum 101 Grausames. Unten im Saal warten sie bereits auf mich. Sie wollen feiern. Gleich werden sie jemanden hochschicken, mich abzuholen. Die Zeiger rücken vor. Sie zeigen fünf Minuten vor. Wie erbärmlich symbolhaft. Bald ist es zwölf. Besser gesagt: null Uhr. Diesen Ausdruck für Mitternacht mochte ich schon immer lieber. Weil er weder nach Anfang noch Ende klingt, sondern nach Auflösung. Nach Auslöschung, nach dem Nichts. Sonia ist seit drei Jahren tot. Ich vermisse sie. Um ein Haar wäre ich vor ihr gestorben. Sehr lange vor ihr. Vor beinahe 34 Jahren, um genau zu sein. Der 21. Januar 1950 hätte mein Todesdatum sein können. An diesem Tag hätte mich beinahe eine Lungenblutung dahingerafft. Nach meinem Beinahe-Ableben kam zum Glück dieses neue Antibiotikum auf den Markt, Isoniazid. Damit bekam ich meine Tuberkulose in den Griff. Sonia war Redaktionsassistentin bei der Zeitschrift meines Freundes Cyril. Sie war 15 Jahre jünger als ich. Fast wäre unser gemeinsames Glück nur von kurzer Dauer gewesen. Sonia. Ich blicke auf das Buch auf meinem Nachttisch. Sie wollen natürlich, dass ich es gleich mit herunternehme. Unten im Saal sind einige Verlagsleute vertreten. Sie haben einiges zu feiern. Mein vor 35 Jahren erschienener Roman schaffte es noch einmal auf die Bestsellerlisten. Wegen dieses vermaledeiten Jahres. Ich mag die aktuelle Ausgabe des Buchs nicht. Ich kann mich an Taschenbücher nicht gewöhnen. Diese schrecklich bunten Cover. Seit jüngerer Zeit drucken sie auch noch diese furchtbaren Strichcodes hinten auf die Hülle. Irgendwann tragen wir alle einen Strichcode auf der Stirn, denke ich. Vielleicht sollte ich diesen Satz gleich in meiner Ansprache sagen. Wohin soll das alles noch führen? Vor kurzem gaben Australien, Kanada und die Vereinigten Staaten schon die ersten maschinenlesbaren Reisepässe heraus. Ich öffne die Minibar. Mit 80 Jahren vertrage ich längst nicht mehr so viel wie früher. Ich sollte es besser lassen. Sie werden mich später noch genügend nötigen zu trinken. Oh nein. Jetzt ist auch schon auf Whiskyflaschen dieser Strichcode. Schnell schließe ich den Kühlschrank wieder. Es klopft. Da sind sie. Ich nehme das Buch, gehe zur Tür und öffne sie. Draußen auf dem Flur stehen ein Hotelpage und ein Verlagsmensch von Secker & Warburg. Der hält ein Walkie-Talkie in den Händen und macht auf wichtig. Der Anblick seines Geräts löst in mir Erinnerungen an meine Zeit im Spanischen Bürgerkrieg aus. Es ist kein Walkie-Talkie, es ist ein Mobiltelefon. Ein Motorola. Davon habe ich in den Zeitungen gelesen. Kostet ein Heidengeld und doch sollen schon mehrere tausend Menschen eines besitzen. Angeblich tätigte sein Erfinder den ersten Anruf damit von einem Bürgersteig in Manhattan aus. Er rief gleich mal bei seinem schärfsten Rivalen in den Bell Laboratories an. Entwickler sind längst dabei, für Mobiltelefone ein digitales Netz aufzubauen. Nur eine Frage der Zeit also, bis sie sie mit Computern verbinden. Ist eine Idee erstmal gedacht, kann sie nicht mehr aus der Welt. Information hat die Neigung, frei zu sein, und der Staat hat eine Tendenz dazu, Freiheit zu regulieren. Und ein Telefonnetz war schon immer ein probates Mittel, Menschen zu überwachen. Vor allem in Kriegszeiten. Und Krieg ist eigentlich immer. Auch Kalter Krieg ist Krieg. Ich fühle mich zu alt, aus all dem jetzt noch einen neuen Roman zu entwickeln. Ich hake mich bei dem Hotelpagen unter. Wir gehen zusammen die Treppe herab. Kaum haben wir das Foyer betreten, kommen sie auch schon auf mich zu. Sie drücken mir ein Glas Sekt in die Hand und geleiten mich in den Saal. Durch die Fenster sehe ich, wie die Raketen draußen aufsteigen. Sie zählen: „Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins.“ Einer nach dem anderen kommt auf mich zu, stößt mit mir an und wünscht: „Ein gutes neues Jahr 1984, Mister Orwell!“
Eberhard Malwitz
Kurze Geschichte über Smartphones
Ich bin 84 Jahre alt und kann mich noch gut an die Anfänge der digitalen Datenverarbeitung erinnern. Bis zum modernen Smartphone – im Volksmund meist noch Handy genannt – war es ein weiter Weg. Letztlich sind Smartphones ein Nebenprodukt bei der Entwicklung diverser Computer, nachdem die Miniaturisierung technisch so weit gediehen war, dass sie in Hosentaschen passten. Mit der digitalen Computertechnik kam ich erstmals 1962 während meines Studiums in Berührung. Beiläufig erwähnte unser Dozent das Hollerith-System. Dabei kamen stapelweise Lochkarten zum Einsatz, mit denen die Großrechner gefüttert werden mussten, bevor sie überhaupt in der Lage waren, etwas zu rechnen. Der erste Großrechner glich einem Monster, das gerade mal in eine Turnhalle passte. Der digitale Fortschritt faszinierte mich trotzdem, denn als Studenten mussten wir immer noch mit Rechenschiebern auskommen.
30 Jahre meiner beruflichen Laufbahn arbeitete ich in Darmstadt, am heutigen GSI-Helmholtzzentrum für Schwer- ionenforschung. Mein Freund und Studienkollege ging zum CERN, dem europäischen Forschungszentrum in der Schweiz. Dadurch lernten wir frühzeitig, mit der Digitalisierung und diversen Programmiersprachen umzugehen. Die Forscher verbanden mit der Entwicklung neuer Rechenmaschinen die Hoffnung, die Flut der gemessenen Daten endlich schneller auswerten zu können.
In meiner Jugendzeit waren Telefone in Privatwohnungen noch Luxus. Um eine wichtige Nachricht zu versenden, ging man zur Post und gab ein Telegramm auf: „Wir kommen morgen − Gruß von Tante Emma.“ Oft standen die Besucher unangemeldet vor der Tür: „Hier sind wir.“ „Wie schön, kommt erst mal rein.“ Selbstverständlich hätten sie ihr Kommen lieber mit einem Mobiltelefon angekündigt. Aber dass es solche Geräte für Otto und Emma Normalverbraucher jemals geben würde, konnten sie sich nicht vorstellen. Zwar gab es schon mobile Funkgeräte, diese wurden aber hauptsächlich von Polizei und Militär be- nutzt.
Wie kommunizierten die Menschen nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Denn Post- und Telefonwesen waren ja weitgehend zerstört worden. Ich weiß es nicht. Aber als junger Zeitzeuge kann ich berichten, wie die Kinder das Problem gelöst haben. Millionen Familien waren vor der Roten Armee aus dem Osten Deutschlands Richtung Westen geflohen, unter anderem auch nach Rügen, in ein kleines Dorf. Dort lebten sie zusammengepfercht in engen Wohnverhältnissen. Die Kinder spielten notgedrungen auf Straßen und in der Umgebung des Dorfes, egal bei welchem Wetter. Ihre Mütter mussten bei den Bauern für wenig Geld arbeiten. Die Väter waren entweder im Krieg getötet worden oder in Gefangenschaft geraten. Dadurch blieben die Kinder nach der Schule und in den Ferien sich selbst überlassen. Sie trafen sich täglich in Scharen auf dem Dorfplatz oder an anderen beliebten Treffpunkten. Sie schienen einen sechsten Sinn zu haben, denn sie wussten immer, wo die anderen sich aufhielten, auch ohne Handys. Der soziale Zusammenhalt und die Gruppendynamik funktionierten prächtig. Im direkten Dialog wurde alles ausdiskutiert, beispielsweise, was man alles noch anstellen könnte. Trotz des ärmlichen Daseins – oder gerade deswegen – war das für mich eine glückliche und kreative Zeit. Wir mussten uns alles selbst bauen, was uns die Eltern nicht bieten konnten, vom Spielzeug bis zum Fahrrad. Hätten wir Smartphones gehabt, wir hätten sie genau so gerne benutzt wie die heutige Generation.
Dennoch hatte die Kommunikation ohne Handys einen ganz anderen, einen besonderen Reiz. Sie war wesentlich intensiver, voller Emotionen und Gefühle. Den direkten zwischenmenschlichen Dialog kann weder heute noch in Zukunft ein Smartphone ersetzen. Mit Sprache und Bild jederzeit die anderen digital erreichen zu können, ist zweifellos eine große Errungenschaft. Aber sobald es ums Persönliche geht, ist der direkte Kontakt ehrlicher. Ich möchte die Mimik, die Gesten und den feuchten Glanz in den Augen meiner Gesprächspartnerin oder meines Gesprächspartners hautnah erleben. Wichtige Inhalte einer Unterhaltung bestehen nicht nur aus nackten Worten. Auch das digitale Visualisieren der Gesprächspartner ist kein echter Ersatz, weil man nur das zu sehen bekommt, was der andere zulässt. Sogar der Geruch spielt während der Kommunikation eine Rolle − mehr, als es uns bewusst ist, behauptet die Wissenschaft.
In den 1950er-Jahren, als die Forscher noch ohne leistungsfähige Rechenmaschinen auskommen mussten, wurde im CERN ein genialer Mathematiker eingestellt. Seine einzige Aufgabe bestand darin, die manuellen Berechnungen der Experimentatoren zu überprüfen. Nachdem die ersten Großrechner seine Arbeit übernommen hatten, schlich er nur noch über den Hof, zu nichts mehr nutze. Beim abendlichen Kegeln war er aber immer dabei. Eines Tages stellten ihn die Kegelbrüder auf die Probe. Er sollte bis zum nächsten Treffen drei Seiten des Genfer Telefonbuchs auswendig lernen. Natürlich bestand er diese Prüfung mit Bravour.
Die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung begeisterten mich derart, dass ich unser Konstruktionsbüro bei der GSI komplett auf Computer-Aided-Design (CAD) umstellen ließ. Mit der Software „CATIA“ von Dassault wurde immerhin das Kampfflugzeug Mirage konstruiert. Mercedes und BMW verwendeten sie ebenfalls. Und nun sollte der neue Teilchenbeschleuniger für unser Forschungszentrum damit designt werden? Anfänglich hatte ich schlaflose Nächte, doch schließlich überzeugte mich die Software und ist heute in der GSI zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel geworden. Ich hatte einen Mathematiker und einen Physiker als professionelle Berater und lernte diverse Programmiersprachen. Ständig verwickelte ich die beiden in Diskussionen, wie man einem Computer beibringen könnte, mit Pattern Recognition eine von Hand gezeichnete Gerade oder einen Kreis zu erkennen. Unzählige Stunden verbrachte ich bis spät nachts an einer der Workstations, die damals in den Fluren des Forschungszentrums zur freien Verfügung standen. Zweifellos war ich damals süchtig, Programme zu schreiben und habe meine eigentlichen Aufgaben vernachlässigt.
In den achtziger Jahren stürmte ein Mitarbeiter in mein Büro, um mir etwas Wichtiges mitzuteilen. Er fuchtelte wild mit der freien Hand umher und presste mit der anderen ein Mobiltelefon mit Tasten ans Ohr. Übrigens, das erste, das ich zu Gesicht bekam. So lief er wichtigtuerisch durch die Flure des Forschungszentrums. Alle machten sich über ihn lustig. Aber nicht lange, denn er war immer bestens informiert.
Die digitale Technik entwickelte sich rasant und wurde immer komplexer. Eines Tages brachten meine Kinder Handys mit nach Hause, die sie sich von Freunden geliehen hatten. Noch beobachtete ich dieses Teufelszeug mit Argusaugen, denn außer Telefonieren konnte man nicht viel mit diesen Dingern anfangen. Es vergingen Jahre, bis ich mir ein Handy zulegte . Diese Winzlinge wurden immer besser und waren vielseitig verwendbar, beispielsweise als Taschenrechner. Längst konnten sie sich in ihrer Leistung mit Personal Computern messen, lediglich die Handhabung auf dem kleinen Display war sehr mühsam. Wenn mein Freund vom CERN mich besuchte, unterhielten wir uns stets über Teilchenbeschleuniger. Aber schließlich landeten wir immer beim Thema Smartphone. Dann tauschten wir uns über die neuesten Apps aus. Niemand brauchte mehr Angst zu haben, dass einem während des Stadtbummels die Partnerin oder der Partner – oder noch schlimmer: das Auto – abhandenkommen könnte. Ein Anruf per Smartphone genügte und schon hatte man sich wieder gefunden. Und wenn man nicht mehr wusste, wo man das Auto geparkt hatte, kein Problem, nur wenige Klicks und eine Computerstimme lotste einen sicher hin. Die Adressensammlung digital im Smartphone zu haben, war sehr nützlich. Und wenn man sich nicht mehr erinnern konnte, ob die gesuchte Person Meier oder Geier hieß, auch kein Problem: Man brauchte einfach nur „eier“ als Suchbegriff einzugeben. Früher hätte man mühselig das gesamte Adressbuch durchlesen müssen. Ebenso gab es einem ein Gefühl von Sicherheit, den digitalen Terminplaner immer zur Hand zu haben.
Als ich wieder einmal meinen Hausarzt aufsuchen musste, war das Wartezimmer voll besetzt. Junge Patienten saßen nach vorn gebeugt und bearbeiteten mit fliegenden Daumen ihre Smartphones zwischen den Knien – mit Zugang zum Internet und Tausenden Apps. Vertieft in eine andere Welt, huschte bisweilen ein Lächeln über ihre Gesichter. Einige hatten Sorgenfalten auf der Stirn. In einer Ecke bellte ein Hund, ach nein, ein Smartphone. Ich wollte nicht mehr nur Zuschauer sein, während die jungen Leute auf ihren Geräten herumhackten, und zückte meins ebenfalls. Ich las die E-Mails, überprüfte meine Termine und schrieb meiner Frau eine WhatsApp. Die älteren unter den Wartenden oder exakter ausgedrückt, jene, die schon so alt waren wie ich, aber diese Wunderwerke nur vom Sehen kannten, warfen mir mitleidige Blicke zu. Auch ohne mich anzusprechen, glaubte ich zu wissen, was sie dachten: „Warum müht sich der alte Opa so ab? Mit nur einem Finger! Der sollte mal unsere Enkel sehen, die schreiben mit zwei Daumen, schneller als ein Maschinengewehr, sogar blind unterm Tisch“. Ich dachte mir meinen Teil: „Ist ja schon gut, ich weiß, eure Enkel sind lauter kleine Einsteins.“
In meinem Alter braucht man das Smartphone nicht mehr für Liebesgeflüster. Eher in Notfällen, um den Hausarzt anzurufen. Aber da nimmt ohnehin niemand ab. Falls ich jemals dringend ärztliche Hilfe benötigen sollte, würde ich also per Smartphone einen Notruf absetzen – selbstverständlich nur, wenn ich dazu noch imstande wäre. Der Rettungs-Hubschrauber würde mich finden, sogar im tiefsten Wald, weil er durch den Notruf auch meine Koordinaten wüsste. Ohne Handy würde ich in solchen und ähnlichen Situationen keine Chance haben. Eine Eigenschaft moderner Smartphones liebe ich besonders: Man kann mit den Winzlingen mittlerweile reden und wird hervorragend verstanden. Auch Texte kann man diktieren. Einfach auf das Micro-Symbol klicken und sprechen: „Was bedeutet Zensus?“ Oder: „Wie viele Einwohner hat Köln?“
Mittlerweile lässt sich das Smartphone auch als Navi verwenden. Vorbei ist die Zeit, als man in der Stadt Passanten nach dem Weg fragen musste. In seriösen Datenbanken recherchieren zu können, ist ein wahres Geschenk. Die Huldigungen ließen sich noch endlos fortsetzen. Ich versuche mir vorzustellen, wozu Smartphones in der Zukunft noch fähig sein würden, und bastele mir im Kopf verschiedene Szenarien zusammen. Die Zukunft kann niemand vorhersagen, aber die bisherige Entwicklung zu extrapolieren, erlaube ich mir trotzdem. Angenommen, Smartphones könnten eines Tages riechen, womöglich so gut wie Hunde. Unmöglich? Geht nicht gibt es nicht! Sicherheitshalber stelle ich meinem Smartphone noch vorher die Frage: „Gibt es euch auch mit Geruchssensoren?“ Prompt kommt die Antwort: „Der Bosch-Konzern entwickelt Smartphones, die den Gehalt von Kohlendioxid in der Raumluft messen können und bei Überschreiten des zulässigen Grenzwertes Alarm schlagen.“ Wenn Bosch schon eine derartige Entwicklung betreibt, wie weit mögen dann erst Samsung und Apple sein, frage ich mich.
Falls es eines Tages tatsächlich gelingen sollte, Smartphones das Geruchsvermögen von Hunden einzuverleiben, entstünden unvorstellbare Nutzungsmöglichkeiten. Beispielsweise wäre es dann mit dem Fremdgehen vorbei. Hierzu eine erfundene Geschichte:
Irgendwann werden fast alle Erwachsenen und Jugendlichen Smartphones nutzen, auch die älteren Semester, weil alle im Zeitalter der Digitalisierung geboren worden sind. Dadurch ergäben sich insbesondere für totalitäre Staaten ungeahnte Möglichkeiten, dem Volk ihren Willen aufzuzwingen. Noch können wir selbst entscheiden, ob wir uns ein Smartphone zulegen oder nicht. Aber was wäre, wenn eine Regierung per Gesetz das Smartphone als Ersatz für Ausweispapiere jeglicher Art deklarieren würde? Das hieße, dass die Daten aller Dokumente wie Personalausweis, Fahrerlaubnis, Bankkarte, Gesundheitskarte usw. zukünftig im Smartphone oder auf einem Server gespeichert sein müssten. Damit wäre die Verpflichtung verbunden, das Smartphone immer bei sich zu haben, wie vorher einige Papiere. Eine solche Umstellung würde man den Bürgern selbstverständlich als große Erleichterung verkaufen. Das wäre sie tatsächlich, denn egal mit welchem Amt oder welcher Institution wir es zu tun bekämen, die Vorlage unseres Handys als Identitätsnachweis würde ausreichen. Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir zu gläsernen Menschen werden, die beliebig von oben gesteuert werden können? Natürlich nicht. Spätestens, wenn Smartphones durch künstliche Intelligenz in der Lage sind, sich nachts heimlich einzuschalten, um sich zu unterhalten oder sich gar zusammenzurotten, um ihren Besitzern eins auszuwischen, brauchen sie uns nicht mehr. Hoffen wir, dass derartige Zukunftsvisionen niemals Realität werden. Was mich betrifft, werde ich mein Smartphone auf alle Fälle mit ins Altenheim nehmen, es sei denn, meine Augen würden nicht mehr mitspielen.
Thomas Fuhlbrügge
Adel verpflichtet
Könige und Schlösser hatten es mir schon immer angetan. Seit ich von meiner Mutter Märchen vorgelesen bekam. Vor allem Dornröschen. Dumm nur, wenn man so gewöhnlich ist wie der Dreck unter den Fingernägeln. Ab und zu so zu tun, als ob man dazugehörte, ist aufregend. Es ist mein Hobby und das meiner Freundin Ilona. Wir beide arbeiten bei derselben Zahnmedizinerin. Sie als Arzthelferin. Ich, Martina, 28 und Dauersingle, an der Anmeldung. Unsere Kaffeetassen ziert die Queen. Ihre Beerdigung haben wir in voller Länge live verfolgt. Genauso wie die Hochzeiten ihrer verzogenen Brut. Freitagabend war es wieder so weit. Wenn andere ins teure Konzert gehen oder ein Heidengeld für den Urlaub ausgeben, fahren Ilona und ich nach Kronberg. Ins Schlosshotel. Vor 120 Jahren zog Victoria Kaiserin Friedrich, wie sie offiziell hieß, in den Taunus. Sie war die Mutter von Willi II und die Tochter der Queen von England. Die Dame ließ sich den Altersruhesitz nach eigenen Vorstellungen erbauen. Ihre Herkunft spiegelte sich in der Architektur wider: deutsche Renaissance, englische Tudorgotik und hessischer Fachwerkstil. Das gesamte Anwesen erinnert an das schottische Königsschloss Balmoral. Vor 60 Jahren wurde der ehemalige Wohnsitz in ein luxuriöses Hotel umgebaut. Es ist unser Lieblingsort. Wo ist es sonst möglich, in einem kaiserlichen Schloss mit Originaleinrichtung zu wohnen? Zugegeben, dort zu nächtigen können wir uns nicht leisten. Wer das Zimmer von Wilhelm zwo bucht und an seinem Originalschreibtisch sitzen will, gibt über 2000 € pro Nacht aus. Das 5-Gänge-Menü im Restaurant für 155 € – ohne Käse – liegt ebenfalls nicht in unserem Budget. Aber einen Abend in der dortigen Bar Frederick’s ausklingen zu lassen, dafür lohnt es sich zu sparen. Schon Wochen zuvor haben wir reserviert. Denn uns interessiert ein ganz bestimmter Platz: Der Tisch vor dem Bild Venedig im Nebel. Das ist ein echter William Turner. Das einzige Gemälde des Künstlers in Privatbesitz. Nicht Stiefelriemen-Bill Turner aus dem Film Fluch der Karibik. Sondern der weltberühmte und bedeutendste Maler Englands. 16.00 Uhr. Der Feierabend rückte näher. Natürlich kam ein Notfall in die Praxis und die Chefin machte Überstunden. Wir daher ebenfalls. Endlich. Ilona und ich nahmen die Jacken. Wir verabschiedeten uns ins Wochenende. Dann ging es zur Freundin nach Hause. Meine Garderobe hatte ich im Auto. Erst einmal vorglühen. Sie mixte alkoholfreie Cocktails. Dazu Minipizzen aus dem Backofen. Und während ihre drei Katzen um unsere Beine schnurrten, machten wir uns bereit. Das edle Kleid aus dem Versandhaus. Die neuen Schuhe. Die Perlenkette. Ein Erbstück von Oma. Does Your Mother Know von ABBA dröhnte aus dem Lautsprecher. Es dauerte, bis wir mit unserem Look zufrieden waren. Ein Blick auf mein Handy: dreiviertel acht. Ins Auto und los. Wir waren bester Stimmung. Nach einer halben Stunde erreichten wir das Ziel. Sobald das Eingangstor des Schlossparks passiert war, hatten wir das Gefühl, in einem Rolls Royce zu sitzen und durch einen englischen Park zu fahren. Nur, dass es ein verbeulter, alter Corsa war. Daher parkten wir am Ende des Platzes, zwischen einem Jaguar und einem Porsche. „Lass Dich nicht blöd anquatschen“, sagte Ilona zu ihrem Opel, als sie abschloss. Die Begrüßung durch den Doorman und das Betreten des Schlosshotels Kronberg versetzen jeden Gast in eine andere Welt. In die des royalen, englischen Luxus. Sobald wir das Hotel betraten, gelangten wir in die einladende Eingangshalle. Sie ist Treffpunkt und zugleich wohnlicher Salon. Mit Sofa, großem Kamin und Gemälden. Die Rezeption liegt diskret in der rechten Seite der Halle. Dort führte unser Weg in die Bar. Dezente Klaviermusik geleitete uns. Dunkle furnierte Wände. Alle Sessel mit edlem Leder bespannt. Frische Blumen und Kerzen auf jedem Tisch. Wir sind beileibe keine Stammgäste. Trotzdem begrüßte uns Carsten hinter der Bar mit einem Lächeln. „Schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen.“ Er deutete auf unseren Platz. „Möchten Sie zur Begrüßung einen Cosmopolitan, wie beim letzten Mal?“ „Dass Sie sich das gemerkt haben ...“ Ich war beeindruckt. „Gern.“ Wir setzten uns. Mein Platz war direkt vor dem Bild. Ilona saß gegenüber. Sie machte erst einmal ein Selfie. Venedig im Nebel. Zarte Farben, Silhouetten der Stadt. Ein massiver Holzrahmen. Darunter ein kleines Messingschild. JMW Turner. Nach kurzer Zeit standen die Cocktails und eine Schale mit Nüssen vor uns. Der Pianist in der Ecke spielte zu unserer Entzückung ABBA in verspielten Variationen. Im Laufe des Abends wechselte er auf Queen. Wir unterhielten uns prächtig. Die Gespräche drehten sich um Katzen, Männer, Reisen und nur wenig um den Job. Das hatten wir uns geschworen, ließ sich aber nie ganz vermeiden. Ilona war wie ich Single. Und wir tummelten uns auf diversen Dating-Seiten im Netz. Manchmal schlugen wir uns gegenseitig die Profile der Männer vor. Und wir erzählten uns von jedem Kennenlerntreffen. Zu diesem Zweck hatten wir beide eine App installiert, auf der man sah, wo sich die Freundin aufhielt. Aus Sicherheit. Würde eine abgeschleppt und in Not geraten, ermittelte die andere den genauen Aufenthaltsort. Das war allerdings noch nie nötig gewesen. Neben uns waren kaum Besucher anwesend. Zwei Herren an der Bar. Gesetztes Alter. Unternahmen eine Whiskyprobe. Wahrscheinlich auf Firmenkosten. Das Paar im Golfdress. Sie dünn wie ein Hering und geschminkt wie eine Bordsteinschwalbe. Er mit geölten Haaren und doppelt so alt. Dazu ein einzelner kahlköpfiger Mann links vom Flügel. Soeben brachte Carsten erneut zwei Gläser Long Island Ice Tea. Ich überschlug unsere Rechnung und die Menge des getrunkenen Alkohols. Dies würde das letzte Getränk sein. Hoffentlich kamen wir in keine Alkoholkontrolle. Ein Zimmer hier oder ein Taxi waren definitiv nicht drin. Ein Blick auf das Display. Kurz nach Mitternacht. „Irland. Da würde ich sofort hin“, griff ich den Faden unseres Gesprächs wieder auf. „Der Ring of Kerry ist traumhaft. Hier, ich habe noch Fotos von 2017.“ Ein Wischen über den Bildschirm. Etwas polterte an der Tür zur Bar. „Ruhig bleiben. Dann passiert niemandem was!“ Zwei Männer stürmten in den Raum. Dunkle Klamotten. Basecaps. Pistolen. Was war hier los? Sie rannten in die Mitte des Saals. Einer trug eine schwere Sporttasche. Der andere deutete auf uns. „Los! Beiseite!“ Niemand rührte sich. Der Pianist machte eine Bewegung. Ob er sich in den Flur absetzen wollte? Da zog der glatzköpfige Gast eine Waffe. „Keine Dummheiten.“ Er stand auf. Kam zu seinen Komplizen. Beide stürmten auf uns zu. „Weg hier!“ Geschockt rückte ich beiseite. Der Erste griff zum Bild. Also darum ging es. Die Sporttasche landete auf dem Tisch. Unsere Gläser klirrten zu Boden. Der Inhalt tropfte über die Platte. Einer fasste zum Reißverschluss. In der Tasche befand sich Werkzeug. Beide Gangster griffen nach massiven Brecheisen. Einer hob den Turner an. Ein lautes Kreischen ertönte. Wir hielten uns die Ohren zu. Die junge Frau schrie. Der glatzköpfige Räuber brüllte ihr etwas entgegen. Im Lärm ging es unter. Unbeirrt rammten die Diebe ihre Eisenstange an die Wand und zerrten mit urtümlicher Gewalt. Der Rahmen splitterte. Einer nahm sich eine Beißzange und hantierte hinter dem Bild. Direkt vor mir stand die Tasche. Niemand achtete in diesem Moment auf mich. Zwei Räuber bearbeiteten das Gemälde, der dritte hatte sich der kreischenden Frau zugewandt. Ich reagierte. Ließ das Smartphone aus meiner Hand in die Tiefen der Tasche gleiten. Ein letzter Widerstand. Dann hielten die Verbrecher den Turner vor sich. Sofort schnappten sie sich die Tasche und stürmten aus der Bar. Ich lugte aus dem Fenster in Richtung Parkplatz. Dort wartete ein Van. Vier Personen sprangen hinein. Einer hielt sich bestimmt in der Eingangshalle auf. Bedrohte womöglich die Frau an der Rezeption und den Türhüter. Über allem kreischte die Alarmanlage. Tumult. Leute liefen umher. Bedienstete kamen. Die hysterische Golferin erlitt einen Schwächeanfall. Ihr Begleiter fächelte ihr mit einer Serviette Luft zu. Ilona und ich setzten uns. Meine Freundin zückte ihr Handy und filmte. Die umherirrenden Menschen. Und den ramponierten Fleck, an dem bis eben ein weltbekanntes Kunstwerk hing. Dann nahm ich es ihr aus der Hand und tippte auf dem Display. Keine zehn Minuten später Blaulicht in der Auffahrt. Polizisten von der Polizeistation Königstein. Endlich verstummte die Sirene. Welche Wohltat für unsere Ohren. „Wir müssen Sie bitten, sich für Vernehmungen zur Verfügung zu halten.“ Ein Mann in einem Anzug. Womöglich von der Hotelleitung. „Bitte begeben Sie sich in die Halle.“ Wir standen auf. Im pompösen Eingangsbereich war es wie in einem Ameisenhaufen. Hotelgäste in Schlafanzug, Köche, Uniformierte. Ich ging auf einen wichtig aussehenden Polizisten zu. Er instruierte zwei Männer in Zivil. „Die Kollegen aus Oberursel bereiten Fahrzeugkontrollen vor. Das SEK aus Frankfurt ist verständigt. Der Hubschrauber in Eschborn ist gleich in der Luft.“ Anscheinend der Einsatzleiter. „Entschuldigen Sie. Ich war bei dem Überfall Zeuge.“ „Wir kommen nachher zu Ihnen. Bitte bleiben Sie in der Nähe.“ „Ich habe den Dieben mein Smartphone in ihre Tasche untergejubelt. Sie können es orten. Es hat eine entsprechende Funktion.“ Ich zeigte dem Polizisten Ilonas Smartphone. Auf dem Bildschirm war eine Karte eingeblendet. Auf einem kaum sichtbaren Feldweg bewegte sich ein Kreis. Der Vorgesetzte war nähergetreten. Zuerst blickte er mich verständnislos an. Dann schaute er genauer hin. „Die versuchen, querfeldein nach Neuenhain zu gelangen. Damit umgehen sie die Straßensperren.“ Er gab Anweisungen in ein Funkgerät. „Das ist fantastisch. Bitte geben Sie mir das Smartphone.“ Meine Freundin gesellte sich zu mir. „Hoffentlich bekomme ich es nachher wieder.“ „Das wirst Du schon. Es war doch praktisch, dass wir beide diese App installiert haben.“ Es wurde spät. Ilona und ich saßen auf einer bequemen Couch. Die goldene Standuhr zeigte halb zwei. Wir bekamen einen weiteren Espresso gereicht. Stilvoll auf Silbertablett mit Zuckervariationen, Gebäck und einem Glas Wasser serviert. Inzwischen war der Erkennungsdienst angekommen. Sicherte Spuren. Verteilte Nummernkärtchen und schoss hunderte Fotos. Ein Blick aus dem Fenster verriet, dass das Fernsehen eingetroffen war. Der Hessische Rundfunk. Scheinwerfer flackerten auf. Ich hatte bereits die Personalien zu Protokoll gegeben. Einer netten Beamtin meine Geschichte erzählt. Da hörten wir Jubel aus Richtung des Restaurants. Die Soko hatte dort ihre Zentrale eingerichtet. „Sie haben die Gangster!“ Einer der Kellner lief in die Eingangshalle. Offenbar war er anwesend, als die Nachricht durchgegeben wurde. „Und das Bild wurde sichergestellt.“ Eine Viertelstunde später kam der Einsatzleiter zu uns. „Die Strolche haben es tatsächlich bis auf die A66 geschafft. Aber mithilfe Ihres Smartphones waren wir ihnen auf der Spur. Der Hubschrauber ortete sie ebenfalls und verfolgte sie mit der Nachtsichtkamera. Über das Westkreuz sind sie auf die A5 bis zum Rastplatz Eschborn. Dort hatten sie zwei gestohlene Fahrzeuge abgestellt. Wollten die Autos wechseln. Hier erfolgte der Zugriff. Niemand wurde verletzt.“ Ich strahlte. „Konnte der Turner gerettet werden?“ „So ist es. Er ist nur leicht beschädigt.“ „Wer würde denn ein solches Bild verkaufen können? Das kennt doch jeder.“ „Sie glauben nicht, wie viele russische Oligarchen für ihre Privatsammlungen bereitstünden. Aber dank Ihres Einsatzes wurde das vereitelt. Ich muss Ihnen danken.“ „Dann können wir jetzt endlich nach Hause fahren?“ Der Polizist blickte mir in die Augen. „Aber nicht in Ihrem Zustand. Eine Kollegin bringt Sie heim.“ Damit waren wir einverstanden. Am kommenden Tag waren die Zeitungen voll. Mein Telefon stand keine Sekunde still. Ich musste Interviews geben. Wurde in die Sendung Maintower eingeladen. Die größte Überraschung erwartete uns allerdings, als wir Ilonas Corsa abholten. Die Geschäftsleitung des Schlosshotels empfing uns und bedankte sich mit je einem gigantischen Blumenstrauß. Außerdem luden Sie uns zum Dank auf ein Verwöhnwochenende ein. Mit allem Drum und Dran. Und Übernachtungen in der Kaiser-Suite. Bis wir unsere Smartphones wiederbekamen, dauerte es allerdings drei Wochen. Marina & ChatGPT:
1. marina an ChatGPT:
nähere dich dem stil von marina d’oro an. ich reduziere, was ich sehe, sprache wird bild. kurz, überflüssige wörter meidend, pars pro toto, verdichtung, verschiebung … gerne auch fehlerhafte formulierungen, wenn sie treffender sind. und wörter trenne ich oft in ihre bestandteile wie bei gänse-blümchen.
schreibe ein eigenes gedicht angelehnt an folgendes gedicht von marina d’oro:
prompt schreibt chatGPT los. sein ‚ergebnis‘:
Die glänzenden Stiefel wie Lack, knochenhoch geschnürt, Trotzen sie dem Wiesengrund, auf dem Gänseblümchen blühen.
Ich reduziere, was ich sehe, Sprache wird Bild, in der Erzähltperspektive.
Vor ihm das Smartphone, ein Fenster zur Welt, Doch im wahren Leben, stirbt der Stadtwald langsam dahin.
Von Wiesensamen in Tütchen, spricht man zum Erhalt der Vielfalt, Doch was ist mit den Bäumen, die seit Jahren hier standen.
Stämme und braune Blätter liegen neben seinem Kopf, Während die Bahn drei Stationen mit blauem Licht passiert. Ich suche nach Worten, die das Bild verdichten, Pars pro toto, Verschiebung, wie bei Gänse-Blümchen.
Das Bild des jungen Mannes im Zug, Ein Moment des Innehaltens, des Nachdenkens, Über das, was wir tun und was wir lassen, Für eine Welt voller Wiesensamen und Bäume, die bleiben.
Marc Mandel & ChatGPT
Julia und Marc
Auftrag an ChatGPT: Schreibe eine Geschichte über Julia und Marc. Julia ist neu im Büro. Zum Feierabend fragt ihr Kollege Marc, ob er sie nach unten begleiten könne. Im Aufzug prahlt Marc, dass er für alle Datenbanken des Unternehmens verantwortlich ist. Julia will mit zu ihm in die Wohnung. Er kocht Kaffee in der Küche und sie fragt ihn, ob sie auf seinem Computer nach ihren Mails schauen kann. Auf einem Zettel unter dem Laptop steht sein Passwort, das sie sofort fotografiert und weiterschickt. Gleichzeitig bucht sie einen Flug. Als Marc zurückkommt, lehnt Julia den Kaffee ab; sie müsse sofort los. Am nächsten Morgen ist sein Zugang gesperrt und alle Daten verschlüsselt – von Julia keine Spur.
Text von ChatGPT: Julia war gerade neu im Betrieb und hatte noch nicht viele Freunde gefunden. Eines Abends, als sie allein im Büro war, traf sie auf Marc, einen Kollegen, der sie freundlich begrüßte und ihr anbot, gemeinsam nach unten zu gehen. Da sie denselben Weg hatten, nahm sie das Angebot an. Während sie im Aufzug waren, erzählte Marc, dass er alle Datenbanken ihres Arbeitgebers betreue. Julia war beeindruckt, aber auch besorgt, dass jemand mit so viel Macht möglicherweise unethisch handeln könne. Als sie in Marcs Wohnung ankamen, bat sie ihn, auf seinem Laptop ihre E-Mails zu checken, während er Kaffee kochte in der Küche. Während Marc in der Küche beschäftigt war, nutzte Julia die Gelegenheit, um das Passwort zu fotografieren, das auf einem Zettel unter dem Laptop lag. Sie verschickte das Passwort an ihren eigenen E-Mail-Account und buchte sofort einen Flug in eine andere Stadt. Als Marc zurückkam, bemerkte er nichts von Julias Plan und fragte, ob sie jetzt einen Kaffee trinken wolle. Julia lehnte ab und verabschiedete sich höflich von ihm, bevor sie leise die Wohnung verließ. Am nächsten Morgen, als Marc zur Arbeit kam, bemerkte er, dass seine Zugangsdaten geändert und alle seine Datenbanken gehackt worden waren. Er wusste nicht, wer dahintersteckte, aber er wusste, dass er sich nicht mehr auf seinen Job verlassen konnte. Julia hatte ihm gezeigt, dass Macht auch missbraucht werden konnte, und er hatte den Preis dafür bezahlt.
Biobibliographische Angaben
Stefan Benz Geboren 1966 in Darmstadt. Seit 1985 Kulturjournalist mit den Schwerpunkten Theater, Tanz und Film. Studium der Germanistik, Amerikanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Frankfurt (Master 1992). Seit 1994 Redaktionsmitglied beim Darmstädter Echo, arbeitet als Kulturredakteur. Seit 2016 schriftstellerische Tätigkeit. Zuletzt erschienen: „Theaterherz – Herr Beck und der Tod des reichen Mannes“ (Roman, Hamburg 2020); „Theaterpest“ (Kurzgeschichte in der Anthologie „CO-RO-NA“, Darmstadt, 2020); „Theaterhölle“ (Kurzgeschichte in der Anthologie „Tatort Darmstadt“, Darmstadt 2021).
Fritz Deppert Geboren 1932 in Darmstadt und immer noch dort lebend. Dr. phil., promoviert über Ernst Barlachs Dramen, Gründungsdirektor der Bertolt-Brecht-Schule (Oberstufengymnasium) in Darmstadt, Mitglied des PEN, Ehrenpräsident der europäischen Autorenvereinigung „Die Kogge“, Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Merck-Ehrung der Stadt Darmstadt, Goethe-Plakette des Landes Hessen. Jüngste Veröffentlichungen: „Möglichkeiten zu Trauern“, „24 Episteln“, 2021; „Alles in allem“, Prosa und Gedichte, 2022.
Alex Dreppec Geboren 1968, promovierter Psychologe. Über 300 Veröffentlichungen u. a. im deutschen und englischen Sprachraum, z. B. in „Der Große Conrady“ (Neuauflage 2008), „Cincinnati Review“ (USA) und „Orbis“ (GB), seit 2019 u. a. in Anthologien und Literaturzeitschriften auf allen fünf Kontinenten. Regelmäßiger Autor u. a. bei „Das Gedicht“ und „Parody in Impression“ (New York, eingestellt). U. a. Wilhelm Busch-Preis 2004 (erster Platz). Erfand den Science Slam, der sich international ausbreitet. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Gedichtband: „Tanze mit Raketenschuhen / Dance with Rocket Shoes“, 2016. 2020 u. a. Mitherausgeber der online-Anthologie „Lockdown-Lyrik“ für dasgedicht. de. www. dreppec. de
Marina D’Oro Geboren: ja, im Stutengarten. Studium der Germanistik und Politologie. Volontariat, Redakteurin, Vorstandsstab Kommunikation. Seit 1985 lebhaft in Frankfurt am Main. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Jüngste Veröffentlichungen: „Kasinostraße 3“, Anthologie der Darmstädter Textwerkstatt, 2014; „Lockdown-Lyrik 121“, Gedichtblog, 2020.
Elena Feder Geboren 2005 in Darmstadt. Abitur 2023 an der Viktoriaschule, Leistungskurse Deutsch, Mathematik. Seit früher Kindheit Begeisterung für Literatur und das Schreiben. Mitglied der Textwerkstatt für Jugendliche bei Kurt Drawert.
Thomas Fuhlbrügge Jahrgang 1974. Lehrer für Katholische Religion, Politik und Wirtschaft, Ethik und Philosophie an der Bachgauschule in Babenhausen. Der Autor, Musiker und Liedermacher lebt mit seiner Frau und seinem Sohn im südhessischen Altheim. Ehrenpreis „Riedschreiber 2022“ der Riedbuchmesse in Stockstadt. Letzte Werke: Massengrab (2020), Muna (2021), Wolkshatz (2022), Kindgerecht (2023), alle erschienen im Coortext-Verlag.
PH Gruner Geboren 1959. Seit 1982 in Darmstadt. Politik- und Sprachwissenschaftler, Dr. phil., Autor, Publizist, bildender Künstler. 1996 bis 2016 Redakteur beim Darmstädter Echo. Mitglied des PEN Deutschland und des VS-Hessen. Geschäftsführer der Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde. Gründer der Literaturgruppe POSEIDON (www. literaturgruppe-poseidon. de). Diverse Preise und Stipendien. Jüngste Publikationen: „Die extrem kurze Zeit der Seligkeit. Zehn Kurzgeschichten und ein Hörspiel“, Darmstadt 2018; „Das Ohr. Ein Märchen für Erwachsene und solche, die es werden wollen“, Darmstadt 2022. „Drei Frauen“, Novelle, Ludwigsburg 2022. www. phgruner. de
Tamara Krappmann 1982 in Darmstadt geboren. Studierte Literaturwissenschaft und hat über die Namen in Uwe Johnsons „Jahrestagen“ promoviert. Für die Echo-Medien (Darmstadt) ist sie seit 2006 in wechselnden Rollen tätig, unter anderem als Freie Mitarbeiterin, Online-Redakteurin, als Senior-Editorin und Reporterin. 2021 und 2023 zählte sie zu den Preisträgern der Riedbuchmesse Stockstadt. Kurzgeschichten erschienen in den zugehörigen Sammelbänden „Das Viertel“ und „Himmel und Hölle“.
Eberhard Malwitz Geboren 1938. Seit 1970 in Darmstadt. Als Diplom-Ingenieur (FH) Abteilungsleiter am GSI-Helmholtzzentrum für Schwer- ionenforschung. Parallel dazu bildender Künstler. Autor von Kurzgeschichten und wissenschaftlicher Literatur. Das erste Buch „Donnerkeile“ mit Zeichnungen über das Ende des Zweiten Weltkriegs erschien 2003. Seit 2008 Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. 2014 erschien der Roman „Neckarstrahl“, ein Krimi und Wissenschaftsthriller. 2017 Initiator, Mitherausgeber und Mitautor des interdisziplinären Buchprojekts „Vom Targetrad zum Federkiel. Elf Physiker der GSI treffen auf neun Autoren der Literaturgruppe POSEIDON“. „Vor dem Nebel“, Autobiografie, erschien 2021. www. malwitz-art. de
Marc Mandel Geboren 1948 im Saarland. Seit 1997 in Darmstadt. Rockmusiker, Hotelpianist, Philosoph und Literaturwissenschaftler. Freier Journalist (u. a. für das Darmstädter Echo und die Jüdische Allgemeine) sowie Autor. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Jüngste Veröffentlichungen: „Möbiusschleife – Wie frei willst du sein?“ (Thriller). „Mädchenlieder – Gedichte über ausgezogene Mädchen in frischbezogenen Betten“, beide Altheim 2023. www. marcmandel. jimdo. com Sorosh Masudi Geboren in Afghanistan, wohnhaft in Darmstadt, verarbeitet seine Erlebnisse und Beobachtungen aus Vergangenheit und Gegenwart und seine Gedanken dazu mit Zeichnungen. Er hat jüngst an der Alice-Eleonoren-Schule (AES) in Darmstadt sein Deutschzertifikat B1 erworben. Die AES bietet wie andere Berufliche Schulen jungen Geflüchteten, Spätaussiedlern und Zuwanderern mit anfangs keinen oder geringen Deutschkenntnissen Intensivklassen (InteA-Klassen) an, die auch zur beruflichen Bildung beitragen und durch ein sozialpädagogisches Angebot flankiert werden. In seiner Klasse fiel den Lehrkräften Masudis zeichnerisches Talent auf.
Gerty Mohr Geboren in Darmstadt, wo sie heute wieder lebt. Studium der Kunstgeschichte, Archäologie, Komparatistik, Germanistik und Anglistik in Bochum, Essen, Grenoble und Pisa. Schreibt Lyrik, Kurzprosa, Buchrezensionen sowie Ausstellungskritiken, übersetzt aus dem Englischen, arrangiert Lesungen und Ausstellungen. Langzeitleseprojekt mit dem bildenden Künstler Klaus Kiefer. Zehn Jahre Redaktionsarbeit bei einer Frauenzeitschrift, Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller, Mitglied im Verein Für die Schwarze Kunst, Mitglied im PEN-Förderkreis International, Vorstandsmitglied im IADM (Internationaler Arbeitskreis Druck und Medien), Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Herausgeberin von „Bretagne“, Bibliophile Taschenbücher, Harenberg-Verlag, „Ewwerschter Kunststickscher“, Odenwald-Verlag, sowie der Anthologie „Vollzug – Knastliteratur gitterfrei“, ebenfalls Odenwald-Verlag. Ewart Reder Geboren 1957 in Berlin, lebt in Maintal bei Frankfurt. Seit 1999 veröffentlicht er Literatur verstreut und in Buchform. Freier Mitarbeiter des Literat, Berlin, 1999 bis 2008, freier Mitarbeiter der Frankfurter Rundschau, bei neues deutschland und beim Kritischen Lexikon der Gegenwartsliteratur, Mitbegründer und Redakteur der Literatursendung WortWellen, Radio X, Ffm (seit 2001), Teilnehmer internationaler Literaturfestivals und -Kongresse, Fernsehfilm Buch auf! Ein Porträt des Schriftstellers Ewart Reder, von Bernhard Bauser, Offenbach 2000. Letzte Buchveröffentlichungen: „Reise zum Anfang der Erde“, Roman, Axel Dielmann Verlag, Frankfurt am Main 2016, „Die hinteren Kapitel der Berührung“, Gedichte, Pop Verlag, Ludwigsburg 2021. Diverse Auszeichnungen, z. B. Stipendium der Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2012-2014. htpps://literatur. net
Andreas Roß Geboren 1962, lebt seit 1985 in Darmstadt, von berufs wegen seit mehreren Jahrzehnten als „Mundwerker“, also Sozialarbeiter, unterwegs. Neben zwei Kurzgeschichtensammlungen „Begegnung mit dem Berserker“ (2011) und „Das Leben ist eine Zicke“ (2018) sind fünf Kriminalromane erschienen: „abgedrückt“ (2013), „weißkalt“ (2015), „Tage, die alles verändern“ (2017), „Innere Schreie“ (2020) und „Der Mäzen“ (2023). Von 1996 bis 2008 monatlich Kurzkrimis im Darmstädter Stadtmagazin „Vorhang Auf!“. Seine Zuneigung zum Krimi-Genre entwickelte er insbesondere in der Zeit, als er in verschiedenen Justizvollzugsanstalten tätig war und so Geschichten hörte, die ihn inspirierten – zumal anscheinend nichts unwahrscheinlicher ist als die Realität. Dazu kommt die Liebe zu seiner Wahlheimat Darmstadt. www. krimiautor-ross-darmstadt. de
Frank Schuster Geboren 1969, lebt in Darmstadt. Journalist und Autor; Redakteur des Darmstädter Echo, davor Öko-Test-Magazin und Frankfurter Rundschau. Studium der Germanistik, Anglistik, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt am Main, Marburg und Oxford. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Jüngste Veröffentlichungen: „Odenwald“, Klima- Thriller, 2023; „Sternenfutter“, dystopischer Roman, 2018; „Das Haus hinter dem Spiegel“, Jugendbuch, 2014. facebook/Frank Schuster
Tom Wolff Jahrgang 1962, Journalist und Sänger, aufgewachsen in Norddeutschland, seit Mitte der 80er Jahre Wahl-Hesse, lebt und arbeitet in Darmstadt. Studium der Kunstgeschichte und Filmwissenschaften. Redakteur u. a bei der taz und Frankfurter Rundschau, derzeit beim Darmstädter Echo. Freie Beiträge zu Kultur, Architektur, Reise und Alltag u. a. für Die Zeit, NZZ Folio und Der Freitag. Textet für die Bands „Salon Erika“, „Aloha Bros“ und „La Source Bleue“. Letzte Veröffentlichung auf CD: Salon Erika, „Die Letzten ihrer Art“, 2021.
Iris Welker-Sturm Die Wortstellerin verknüpft Wort, Bild und Objektkunst in Ausstellungen und Text-Konzerten. Studium der Kommunikationswissenschaften. Mehrere Jahrzehnte als Lehrkraft tätig und in der Lehrerfortbildung (Freinetpädagogik). Mitglied der Künstlerinnengruppe GEDOK und der Literaturgruppen Die Kogge und POSEIDON. Veröffentlichungen u. a.: „das unerhörte zwischen. gedichte & mokka kaos“, Hamburg 2014; „aus der stimmhaft. Roman über Luise Büchner“, Frankfurt 2021. Auszeichnungen u. a.: ver. di: Stimmen gegen rechts 2013, Dagmar-Morgan-Preis 2016, Landschreiberpreis 2019. www. wortstellerin. de
Barbara Zeizinger Geboren 1949 in Weinheim, Studium der Germanistik, Geschichte und Italienisch, schreibt Lyrik und Prosa. Redaktionsmitglied bei den Zeitschriften Bawülon und Matrix des Pop Verlages. Ihr Roman „Am weißen Kanal“ wurde ins Italienische übersetzt. Mehrfache Stipendiatin des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Mitglied u. a. in der Europäischen Autorenvereinigung Die Kogge, des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, des Exil-P. E. N. und des PEN-Zentrums Deutschland. Mitglied der Literaturgruppe POSEIDON. Im Zusammenhang mit der internationalen Lyrikergruppe QuadArt mehrere mehrsprachige Bücher, alle herausgegeben von der polnischen Autorin Małgorzata Płoszewska. Letzte Veröffentlichungen: „Bevor das Herz schlägt“, Roman 2021 und „Schon morgen wird alles gewesen sein“ Gedichte 2023, beide im Pop Verlag Ludwigsburg erschienen. Die Literaturgruppe POSEIDON
. . . wurde aus der Taufe gehoben im Sommer 2005 von den Freunden PH Gruner und Wigand Lange (1946-2021). Ihr Vorhaben: In Südhessen beheimatete Autoren sollten weniger über- als miteinander sprechen. Obwohl das Sprechen übereinander bekanntlich äußerst beliebt ist. Jedoch wenig zielführend, wenn es ums Kennenlernen oder gar ums Kennen geht. So bringt POSEIDON also Lyriker, Essayisten, Erzähler, Romanciers, Dramatiker, Feuilletonisten, Satiriker und sonstige Schreibende an einen Tisch. POSEIDON ist keine Sezession, kein Club, kein Verein, sondern Ideenbörse und Plattform für Austausch, Debatte und gemeinsame Aktion. Die ersten zehn Autoren-Treffen im griechischen Restaurant POSEIDON in Darmstadt gaben der Gruppe ihren Namen.
POSEIDON hat Lesungen an typischen wie ungewöhnlichen Orten umgesetzt, zum Beispiel in Eisenbahnwaggons, in einem Schleichkatzenkäfig (Darmstädter Vivarium), inmitten einer großen Expressionismus-Ausstellung (Mathildenhöhe Darmstadt), bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, im Darmstädter Keller-Klub, in alternativen Kleinkunsttheatern, Kulturzentren und in interdisziplinären Projekten mit Künstlerverbänden wie dem BBK.
POSEIDON gibt es in Buchform, als Hörbuch und im Kunstkatalog: