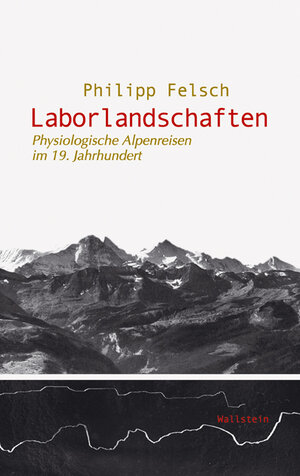
×
![Buchcover ISBN 9783835308084]()
'Felsch verfolgt die damals noch nicht entscheidende Frage, welches die besten Bedingungen für ein Experiment sind: Druckkammer oder Messung unter freiem Himmel? Und er zeigt, wie mühsam sich die Forschung nur von den alltäglichen Assoziationen löste, die an einem Begriff wie 'Ermüdung' hängen. (.) Der Leser erwischt sich bei der Lektüre ständig dabei, all dies auch nicht zu wissen. Und das ist ein interessanter Nebeneffekt der Untersuchung: Man denkt unwillkürlich, wie unsinnig es ist, auf Leute herabzusehen, die 'Emma Bovary' nicht kennen oder nicht wissen, wann der Dreißigjährige Krieg endete, wenn man selber nicht einmal imstande ist zu sagen, wie sich Stützen, Tragen und Heben derselben Menge zueinander verhalten. Insofern war es (.) raffiniert von Philipp Felsch, einen wissenschaftlichen Irrtum zu untersuchen - weil die allermeisten von uns eben nicht einmal heute in der Lage wären, ihn als solchen zu erkennen. Man lernt also viel aus diesem Buch.'(Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.7.2007)'Die kleine Studie ist in ihrer argumentativen wie stilistischen Prägnanz vorzüglich und blättert ein spannendes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte auf. Erhellend für Experten wie für Laien. (.) Das reichlich beigefügte Bildmaterial macht die Untersuchungen gut nachvollziehbar.'(Florian Welle, Süddeutsche Zeitung, 13.11.2007)
Eine Wissenschaftsgeschichte vom Verhalten des Körpers oberhalb der Baumgrenze. Die Entdeckungsreise führt vom romantischen Gefühl der Erhabenheit hoch in den Alpen bis in die Labors der modernen Arbeitswissenschaft.
Die Alpen und kein Ende: Berg- und Gipfelerlebnisse haben nach wie vor literarische Konjunktur. Dabei sind die Seelen- und Körperlandschaften des Gebirges längst vermessen, seine erhabenen Schrecken längst Klischee. Philipp Felsch ermöglicht in seiner Kulturgeschichte der Physiologie in den Alpen einen neuen Zugang zum anhaltenden Faszinosum »Mensch am Berg«. Er richtet sein Augenmerk auf jene modernen Erben der romantischen Alpenbegeisterung, die den Körper in der Höhe zum Gegenstand von physiologischen Experimenten machten. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Turiner Experimentalphysiologe Angelo Mosso (1846-1910), der weniger durch seine Konzepte und Theorien als durch seine innovative Forschungspraxis und auch durch seine Persönlichkeit bekannt wurde. Schon immer besaß das Erhabene medizinisch-pathologisches Potential. Im Jahrhundert der positiven Wissenschaften wurde das Erhabene zum Ausgangspunkt einer Physiologie des alpinen Menschen, die alle Körperobsessionen ihres Zeitalters teilte: utopische Hoffnungen auf den Übermenschen ebenso wie vitale Ängste vor seiner schleichenden Erschöpfung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mündete die Höhenphysiologie in die Testreihen von Arbeitswissenschaftlern und Flugmedizinern. Felsch zeigt, dass die Alpen nicht nur der Zufluchtsraum, sondern auch die Laborlandschaft der Moderne gewesen sind.
Zur Reihe:
Die Alpen und kein Ende: Berg- und Gipfelerlebnisse haben nach wie vor literarische Konjunktur. Dabei sind die Seelen- und Körperlandschaften des Gebirges längst vermessen, seine erhabenen Schrecken längst Klischee. Philipp Felsch ermöglicht in seiner Kulturgeschichte der Physiologie in den Alpen einen neuen Zugang zum anhaltenden Faszinosum »Mensch am Berg«. Er richtet sein Augenmerk auf jene modernen Erben der romantischen Alpenbegeisterung, die den Körper in der Höhe zum Gegenstand von physiologischen Experimenten machten. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Turiner Experimentalphysiologe Angelo Mosso (1846-1910), der weniger durch seine Konzepte und Theorien als durch seine innovative Forschungspraxis und auch durch seine Persönlichkeit bekannt wurde. Schon immer besaß das Erhabene medizinisch-pathologisches Potential. Im Jahrhundert der positiven Wissenschaften wurde das Erhabene zum Ausgangspunkt einer Physiologie des alpinen Menschen, die alle Körperobsessionen ihres Zeitalters teilte: utopische Hoffnungen auf den Übermenschen ebenso wie vitale Ängste vor seiner schleichenden Erschöpfung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mündete die Höhenphysiologie in die Testreihen von Arbeitswissenschaftlern und Flugmedizinern. Felsch zeigt, dass die Alpen nicht nur der Zufluchtsraum, sondern auch die Laborlandschaft der Moderne gewesen sind.
Zur Reihe:



